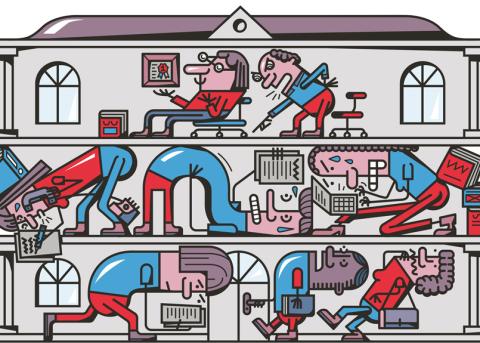Geisteswissenschaften: ForscherInnen aller Länder, vereinigt Euch!
Erneut stellt ein Evaluationsbericht die Geisteswissenschaften an den Pranger, weil sie den Ansprüchen der ökonomischen Verwertungslogik nicht zu entsprechen vermögen. Es wird Zeit, diese Logik zu hinterfragen.
«Wozu noch Geschichte?» lautete der Titel eines der ersten Texte, die ich zu Beginn meines Studiums zu lesen hatte. Das ist über zwanzig Jahre her. Sein eigenes Tun kritisch zu hinterfragen, gehört auch heute noch zum Kern aller geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Gleichzeitig mutet es wie aus der Zeit gefallen an. Wie überhaupt die Geisteswissenschaften zunehmend als anachronistisch wahrgenommen und marginalisiert werden, seit Mitte der neunziger Jahre mit dem weltweiten Siegeszug des Neoliberalismus eine Ökonomisierung der Wissenschaften einsetzte. Wissen mutiert damit zur Ware, die im Wettbewerb produziert und vermarktet wird – von öffentlichen Hochschulen, die sich als Unternehmen gebärden.
Das an Universitäten generierte Wissen in Lehre und Forschung untersteht seither dem Imperativ der Nützlichkeit, der praktischen Verwertbarkeit zum «Wohl der Gesellschaft». Was im Klartext bedeutet: zur Steigerung des Bruttosozialprodukts. Entsprechend sollen Forschung und Lehre mit den Mitteln des New Public Managements auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Quantitative Leistungsindikatoren sind so zum alleinigen Mass wissenschaftlichen Erfolgs geworden. Publikationszahlen (Impact Factors), die zählen, wie häufig Publikationen zitiert werden, Drittmittelquoten und Hochschulrankings sind ebenso Ausdruck davon wie eine um sich greifende Evaluationitis auf Verwaltungsebene.
Dass sich die Geisteswissenschaften mit dieser Entwicklung schwertun, ist kein Geheimnis. Ihre Forschungsergebnisse lassen sich nicht in Patente ummünzen und generieren keine Spin-off-Unternehmen. Die europäischen Forschungsrahmenprogramme, die aus der materiellen Verwertungslogik heraus entstanden sind, waren anfangs gar nicht an einer Teilnahme der Geisteswissenschaften interessiert, ebenso wenig die ähnlich orientierten Nationalen Forschungsprogramme der Schweiz.
Um die Jahrtausendwende schritt der Bund ein und erarbeitete zusammen mit den Universitäten eine Reihe struktureller Massnahmen, um der wachsenden Marginalisierung der Geisteswissenschaften entgegenzuwirken: Spezifische Forschungsförderung zählte ebenso dazu wie Graduiertenprogramme und Stipendien für Doktorierende oder neue Assistenz- und Förderprofessuren.
Vom Unvermögen zu genügen
Was haben diese Massnahmen gebracht? Nichts. Im Gegenteil: Die Situation hat sich zwischen 2002 und 2012 sogar noch verschlechtert, wie ein eben veröffentlichter Bericht der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) konstatiert. Im Fokus steht die prekäre Lage des akademischen Nachwuchses. Insbesondere die Doktoratsstufe gleicht einem «survival of the fittest»: Kaum in institutionelle Strukturen eingebunden, unterfinanziert und mehrheitlich gezwungen, einer ausseruniversitären Erwerbsarbeit nachzugehen, um sich den Lebensunterhalt zu sichern, bleibt die Hälfte aller Dissertierenden auf der Strecke. Von jenen, die durchhalten, schliesst jedeR Dritte das Doktorat erst im Alter von 35 bis 39 Jahren ab.
Zu schlecht betreut im Studium, zu lang am Promovieren, zu viele, die die Dissertation abbrechen, zu alt für eine akademische Laufbahn, kaum erfolgreich in der Beteiligung an grossen Forschungsprogrammen – der Bericht stempelt die Geisteswissenschaften in allen akademischen Belangen als defizitär, als negativ von der Norm abweichend ab.
Inhaltlich ist an diesen Erkenntnissen nichts neu. Doch endlich, so betont der SAGW-Bericht, beruhen sie auf einer empirisch gestützten Datengrundlage (auch wenn die quantitativen Indikatoren der Evaluation mangelhaft und eigentlich unbrauchbar sind, wie es an einer Stelle des Berichts heisst).
Wer sich indes allein daran orientiert, was messbar und vergleichbar ist, wird selbst Teil des Problems, indem er in der Logik der Ökonomisierung der Wissenschaften gefangen bleibt. Das zeigt die zu Beginn formulierte Prämisse des Berichts: «Erwartet werden employability, verwertbare Ergebnisse, gesellschaftliche Problemlösungen sowie die Dokumentation und Kontrolle der Leistungen.»
Doch führen die Resultate der SAGW-Evaluation nicht gerade vor Augen, dass ein Beharren auf dieser Prämisse die Geisteswissenschaften weiter marginalisieren und schwächen wird? Profitiert von den Fördermassnahmen haben nämlich in erster Linie die Sozialwissenschaften, die sich zunehmend quantitativer Methoden befleissigen, um soziale Phänomene zu untersuchen: Die Hälfte aller neu geschaffenen Professuren wurde ihnen zugeteilt, während an der Universität Zürich trotz enorm angewachsener Studierendenzahlen in den historischen und Kulturwissenschaften seit 2006 kein neuer Lehrstuhl eingerichtet worden ist.
Mittlerweile hat der Nationalfonds praktisch das Fördermonopol in den Geisteswissenschaften, wie der Bericht deutlich macht – ausser ihm scheint sich niemand für geisteswissenschaftliche Forschung zu interessieren. Und sein Engagement bröckelt, wie die neue Publikationsstrategie zeigt, die digitale Veröffentlichungen fördert und Buchpublikationen zurückbindet. Solche Entscheide dürften «nicht von einer Wissenschaftsbürokratie gefällt werden, die mehr und mehr als autoritäres Bevormundungsorgan auftritt», so der Zürcher Wissenschaftshistoriker Michael Hagner kürzlich in der NZZ.
Man kann das auch als Signal lesen: Die GeisteswissenschaftlerInnen selbst haben sich lange genug in kritischer Selbsthinterfragung geübt, sich an Kongressen Gedanken zu einer neuen Wissenschaftskultur gemacht und Positionspapiere für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften verfasst – alles im Bemühen, sich an die materielle Verwertungslogik anzupassen. Schluss damit!
Besinnen auf die eigenen Stärken
Es ist nämlich keineswegs so, dass die Geisteswissenschaften Gefahr laufen, auf dem Abstellgleis der Geschichte zu landen. Während allenthalben die Förderung der sogenannten Mint-Fächer, also der Technik- und Naturwissenschaften, gefordert und über den Mangel an Ingenieuren und Informatikerinnen geklagt wird, boomen geisteswissenschaftliche Studienfächer an den Universitäten. Auch der akademische Nachwuchs lässt sich vom «survival of the fittest» nicht abschrecken – im Gegenteil: In zahlreichen Fachrichtungen hat sich die Zahl der Doktorierenden in den vergangenen zehn Jahren um über fünfzig Prozent erhöht.
In einer Welt, die sich so komplex und widersprüchlich präsentiert wie heute im Zeitalter der Informationsgesellschaft, sind Orientierungswissen und kulturelle Übersetzungsleistungen, wie sie die Geisteswissenschaften bieten, gefragter denn je. Hier muss angesetzt werden, um aus der ökonomischen Verwertungslogik auszubrechen.
Die Zeit dazu ist reif, der Widerstand nimmt zu. So hat der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat im April 2013 im Report «‹Economization› of Science» moniert, der akademische Wettbewerb funktioniere zunehmend nach ausserwissenschaftlichen Regeln, indem Produktivität über Erkenntnisgewinn gestellt werde. Hochschulleitungen würden Wirtschaftskontakte und Drittmittelerfolge zu Kriterien für die Auswahl von Lehrenden und Forschenden machen.
Das zeigen die jüngsten öffentlichen wie wissenschaftsinternen Kontroversen um das UBS-Sponsoring der Universität Zürich, die Nestlé-Lehrstühle an der ETH Lausanne (EPFL) und insbesondere das Agieren von EPFL-Präsident Patrick Aebischer.
Auch auf internationaler Ebene beginnt sich Widerstand zu formieren, innerhalb der Naturwissenschaften etwa: Mit der «San Francisco Declaration on Research Assessment» haben im Mai 2013 zahlreiche ForscherInnen und wissenschaftliche Organisationen dagegen protestiert, den Impact Factor weiter als Messgrösse zu verwenden, um individuelle ForscherInnen und wissenschaftliche Arbeiten zu beurteilen oder über Anstellungen, Beförderungen und Projektfinanzierungen zu entscheiden.
Wenn also auch sie sich gegen das Korsett zu wehren beginnen, in das sie die Ökonomisierung der Wissenschaften gezwängt hat – weshalb sollten es sich die GeisteswissenschaftlerInnen dann erst umzuschnallen versuchen? Weshalb das Abweichen von der Norm nicht zu einer neuen Stärke formen? Sich mit den KritikerInnen aus anderen Wissenschaftsgebieten verbünden und eine Wissenschaftsgewerkschaft gründen, um den gemeinsamen Interessen politische Durchschlagskraft zu geben?
Immerhin lehrt die Geschichte, dass sie zwar nicht umkehrbar, aber veränderbar ist.
«Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002–2012. Grundlagenbericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften». Swiss Academies Reports, Bd. 9, Nr. 3, 2014.