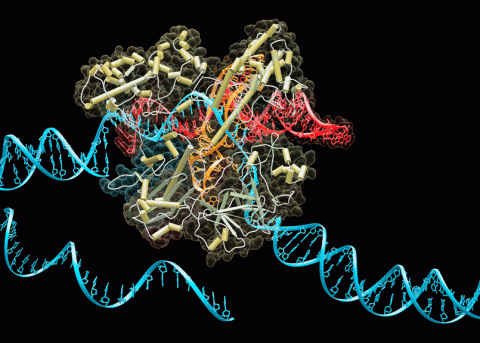Fortpflanzungsmedizin: Das gescreente Wunschkind als Konsumgut
Schweren Vorwürfen sehen sich derzeit feministische GegnerInnen der Präimplantationsdiagnostik ausgesetzt. Dabei gibt es zahlreiche gute Gründe für Skepsis – aus gesellschaftlicher, ethischer wie auch aus gesundheitlicher Sicht.
Es war im Jahr 2006, als der Berliner Kinderwunscharzt Matthias Bloechle entschied, sich selbst anzuzeigen. Vor Gericht musste er sich dafür verantworten, entgegen damaligen gesetzlichen Bestimmungen Embryonen im Reagenzglas auf eine Chromosomen-Anomalie untersucht und gezielt einen nicht mit der falschen Erbinformation belasteten Embryo verpflanzt zu haben. Der Fall, der damals weit über deutsche Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt hatte, endete mit einem Freispruch, der die deutsche Politik in Zugzwang brachte. Seit 2011 ist die sogenannte Präimplantationsdiagnostik (PID) in engen Grenzen in Deutschland zugelassen.
Aber nicht nur Eltern, die befürchten, eine Erbkrankheit wie die Muskelkrankheit Mukoviszidose oder die Nervenkrankheit Chorea Huntington an den Nachwuchs weiterzugeben, setzen ihre Hoffnungen in diese Methode. Auch Paare, deren Versuche, durch künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, IVF) zu einem Kind zu kommen, erfolglos bleiben, sehen in der Vorauswahl im Labor die letzte Chance. Die Embryonen werden dabei auf Chromosomenabweichungen untersucht, und es wird derjenige ausgewählt, von dem man glaubt, dass er sich am besten entwickle.
Die PID, über die die Schweizer Stimmbevölkerung am 14. Juni entscheidet, empfiehlt sich also als der letzte Ausweg für leidgeprüfte Paare: Heilsversprechen für diejenigen, die sich wegen bestimmter erblicher Krankheiten um ihren Nachwuchs sorgen, und Hoffnung für ungewollt Kinderlose. Der Verfassungsartikel zum Fortpflanzungsmedizingesetz sieht vor, die PID zuzulassen, wenn eine schwere Erbkrankheit vorliegt oder wenn sie vorgenommen wird, um Sterilität zu überwinden. Die Freigabe der PID würde bedeuten, dass künftig bis zu zwölf Eier befruchtet werden dürfen statt wie bisher höchstens drei. Die übrig bleibenden werden «nach dem Stand der Wissenschaft» für höchstens fünf Jahre eingefroren.
Unheilige Allianz mit den Fundis
Die Parteien haben sich mittlerweile relativ eindeutig positioniert: Die BDP ist klar für die Änderung des Verfassungsartikels, ebenso die FDP und sogar die Grünen. Bei der CVP war der Entscheidungsprozess holprig, aber am Ende ist die Partei mit dem Hinweis, «viel Leid zu vermeiden», auf ein Ja eingeschwenkt. Die SP hat sich für die Stimmfreigabe entschieden.
Angesichts dieser überwältigenden Zustimmung zur PID fällt es kritischen Stimmen schwer, ihre Argumente vorzubringen, ohne in den Verdacht zu geraten, sich als technikfeindliche BedenkenträgerInnen herzlos über die Probleme betroffener Paare hinwegzusetzen. Zumal sich linke oder feministische KritikerInnen plötzlich in einer unheiligen Allianz mit Fundamentalchristen und Lebensschützerinnen wiederfinden, die Frauen auch das Recht auf Abtreibung streitig machen wollen.
Wollen PID-GegnerInnen, so der Vorwurf, betroffenen Paaren die Last der Angst, ein weiteres behindertes Kind zu bekommen, aufbürden? Oder Frauen zu einer den Embryo möglicherweise schädigenden Pränataldiagnostik und gegebenenfalls zur Spätabtreibung nötigen, statt ihnen die angeblich schonendere PID zu gönnen?
Das sind schwerwiegende Anwürfe, denen man sich stellen muss, wenn man sich nicht einfach hinter dem per se angenommenen Lebensrecht des Embryos verschanzen will wie die LebensschützerInnen. Und es wird nicht einfacher dadurch, dass das feministisch stets hochgehaltene Selbstbestimmungsrecht nun von den BefürworterInnen der PID in Anschlag gebracht wird. Aber gibt es das überhaupt, ein Menschenrecht auf ein Kind? Und haben Paare das selbstverständliche Recht, sich aus den vorhandenen Möglichkeiten ein möglichst gesundes Kind auszusuchen? Zumal aufgrund der hohen Hormongaben, die nötig sind, damit sich genügend Eier entwickeln, die PID mit erheblichen Nebenwirkungen und gesundheitlichen Risiken für die Frau verbunden ist (vgl. «Präimplantationsdiagnostik» im Anschluss an diesen Text).
Ein Kind, egal zu welchem Preis
Dass Menschen gerne ein Kind möchten und der Staat sie davon nicht abhalten darf, ist unumstritten, Eingriffe in die Fortpflanzungsautonomie müssen abgewehrt werden. Aber ein Abwehrrecht kann nicht einfach umgemünzt werden in ein Konsumrecht: Ich möchte ein Kind, egal um welchen Preis. Vergessen geht dabei die Frage, warum es unbedingt ein leibliches Kind sein muss. In den Fällen wiederum, wo es darum geht, ein gesundes Kind haben zu wollen, sind auch andere Rechtsgüter betroffen: zunächst einmal die der befruchteten, nicht verpflanzten Embryonen, die entweder eingefroren oder «entsorgt» werden.
Aber selbst wenn man dem Embryo keine Menschenwürde zugestehen will, tangiert das Geschehen diejenigen lebenden Menschen, die die Merkmale der verworfenen Embryonen tragen, Menschen mit allen Arten von leichten oder schwereren Einschränkungen oder Krankheiten. Die Schwere einer Ausprägung lässt sich im Labor nämlich nicht feststellen, ein «gelingendes Leben» von oder mit Behinderten ist technisch nicht vorhersehbar, ganz abgesehen davon, dass über neunzig Prozent aller Krankheiten und Behinderungen ohnehin erst während oder nach der Geburt entstehen und durch die PID gar nicht vermieden werden können. Mit der Aussonderung «belasteter» Embryonen im Reagenzglas verbindet sich jedenfalls eine Wertehaltung: Die einen sind erwünscht, die anderen wollen wir lieber nicht.
Wie kontrollieren ohne Daten?
Eine so verstandene, konsumorientierte Selbstbestimmung, ein Recht, das auf die Ausschöpfung von Möglichkeiten rekurriert, birgt aber noch weitere Probleme. Denn der antizipierte Schwangerschaftskonflikt – also die Furcht, darüber entscheiden zu müssen, eine Schwangerschaft in einem späteren Entwicklungsstadium abzubrechen – und die Auseinandersetzung mit einer Umwelt, die signalisiert, ein behindertes Kind müsse heute doch nicht mehr sein, kann Frauen unter Druck setzen. Ihre Entscheidung wird von Erwartungshaltungen beeinflusst. Aus dem Recht wird dann eine – wenn vielleicht auch nicht ausgesprochene – Pflicht zu einem gesunden Kind, aus der verständlichen individuellen Leidvermeidung eine «selbstbestimmte» Vermeidung von gesellschaftlichen Lasten, etwa von Integrationskosten.
Zugunsten der PID wird oft ins Feld geführt, dass der Zeitpunkt der Entscheidung zeitlich vorverlegt wird, in eine Phase, wo noch gar keine Schwangerschaft besteht. Doch dies forciert auch eine genetisch angeleitete, eugenische Denkweise: Mein Kind ist so gut wie seine Gene. Sie spielt auch in der Debatte um den Praena-Test eine Rolle. Dabei handelt es sich um eine kürzlich auf den Markt gebrachte Blutuntersuchung der Schwangeren, bei der (vorerst nur) nach Trisomie 21, also dem Downsyndrom, gefahndet wird.
Vor einigen Monaten fragten Abgeordnete in diesem Zusammenhang bei der deutschen Regierung an, ob Erkenntnisse über diskriminierende Folgen der herkömmlichen Pränataldiagnostik (PND) vorlägen. In der Antwort wurde deutlich, dass es – wie übrigens auch in der Schweiz – bislang überhaupt keine Daten gibt, die darüber Verlässliches aussagen. Bekannt ist nur, dass in Ländern wie Britannien, wo der Einsatz der PID von Fall zu Fall entschieden wird, eine Neigung zur Anwendungserweiterung besteht.
Wie aber will man verhindern, dass man mit der Zulassung der PID auf eine «abschüssige Bahn» gerät, wenn dazu keine Forschungsaufträge erteilt und flankierende Massnahmen ergriffen werden? Wer garantiert, dass der momentan engmaschige Katalog der Anwendungsfälle nicht erweitert wird? Die Pränataldiagnostik, in vielen Ländern zunächst nur für über 35-jährige Schwangere vorgesehen, hat sich schliesslich auch zu einer Routineangelegenheit entwickelt.
Geschäftsmodell Wunschkind
Und welches Schicksal erwartet die «überflüssigen» Embryonen? Kürzlich wurde bekannt, dass sie in einem zweifelhaften Experiment chinesischer ForscherInnen eingesetzt wurden, die im Rahmen des Genome-Editing-Verfahrens erstmals gezielt durch Eingriff in die Keimbahn des Menschen das Erbmaterial verändern wollten. Die Forschungsbegehrlichkeiten an diesem «Material» sind gross. Aber auch Paare, die Eltern werden und einen Embryo adoptieren wollen, könnten Interesse anmelden.
Beim Geschäftsmodell PID geht es ohnehin nicht um die insgesamt sehr geringe Zahl von Paaren, die befürchten, eine Krankheit zu vererben – in Deutschland sind das rund 200, in der Schweiz handelt es sich nach Angaben des Zürcher Reproduktionsmediziners Bruno Imthurn um 50 bis 100 Fälle –, sondern um die viel grössere Gruppe, die keine Kinder bekommt. Seit 1999 veröffentlicht die Europäische Gesellschaft für Humane Reproduktion und Embryologie (ESHRE) entsprechende Daten: Danach greift knapp ein Viertel der Paare auf die PID zurück, weil sie einen Gendefekt befürchten, in allen übrigen Fällen werden die Embryonen gescreent, um Unfruchtbarkeit zu überwinden oder um das Geschlecht des Kindes auszuwählen.
Die Chance der 4000 von der ESHRE erfassten Frauen, die 2008 mithilfe der PID einfach nur zu einem Kind kommen wollten, war aber nicht viel grösser als bei der herkömmlichen IVF. Es fehlt nämlich bislang der Nachweis, dass dieser Weg tatsächlich erfolgreicher ist. Die klinische Schwangerschaftsrate pro Embryonentransfer liegt bei 32 Prozent, die Geburtenrate bei 25 Prozent, also etwa auf dem Niveau wie nach einer künstlichen Befruchtung ohne PID.
Der Markt mit dem Wunschkind allerdings wächst rasant. Social Freezing, die Möglichkeit, Eizellen einzufrieren und bei Bedarf zu befruchten und einzusetzen, wird ihn noch ausweiten. Über 700 000 IVF-Versuche werden weltweit jährlich unternommen, der Umsatz mit Fruchtbarkeitshormonen liegt bei rund 1,2 Milliarden US-Dollar. In Deutschland kostet ein Durchgang IVF rund 3000 Euro, die PID etwa noch einmal so viel, hinzu kommen Kosten für Hormone und andere Eventualitäten. Während die gesetzlichen Krankenkassen bis zu drei Versuche der künstlichen Befruchtung finanzieren, zahlen sie nicht für die Präimplantationsdiagnostik. 2014 urteilte das Bundessozialgericht, dass es sich bei der PID «um keine Krankenbehandlung» handle und sie deshalb nicht zu erstatten sei.
Auf der Website des schweizerischen Nein-Komitees, das von einer beeindruckenden Zahl von Organisationen unterstützt wird, ist viel darüber zu lesen, dass mit der PID und den dabei produzierten Embryonen eine Situation geschaffen werde, die anderen Fortpflanzungstechnologien, etwa Eizellenspende, Embryonenadoption und Leihmutterschaft, fast zwangsläufig Tür und Tor öffne. Auch die Auslese, die Behinderte diskriminiere, wird kritisiert.
Wenig ist die Rede von den Folgen für die Frauen, die sich mit ihrem Kinderwunsch immer stärker in die Hände von ExpertInnen mit hoher Definitionsmacht begeben und deren angeblich selbstbestimmte Entscheidungen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Fragwürdig ist auch ein Familienbild, das Glück nur in leiblichen Kindern erfüllt sieht. Es huldigt einem biologistischen und heterosexuellen Konzept von Familie, das der Realität vielfältiger Familienformen kaum entspricht.
Präimplantationsdiagnostik
Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Embryonen im Reagenzglas gezielt ausgewählt und verpflanzt werden. Um eine angemessen grosse Anzahl von Eiern zu gewinnen, wird die Frau mithilfe von Tabletten einer stärkeren Hormonbehandlung unterzogen als bei der herkömmlichen In-vitro-Fertilisation. Dies ist mit gesundheitlichen Risiken (wie zum Beispiel Blutungen, Infektionen, Überstimulation der Eierstöcke, Thrombosen, Ödemen oder Infarkten) und psychischen Belastungen bis hin zu Depressionen verbunden.
Die Eientnahme erfolgt unter Narkose. Nach der Befruchtung der Eizelle werden den Embryonen Zellen entnommen, die auf genetische Marker beziehungsweise auf chromosomale Abweichungen überprüft werden. Nach dem Test werden geeignete Embryonen ausgewählt und einer oder mehrere in die Gebärmutter verpflanzt. Die übrigen werden bis zu fünf Jahre eingefroren.