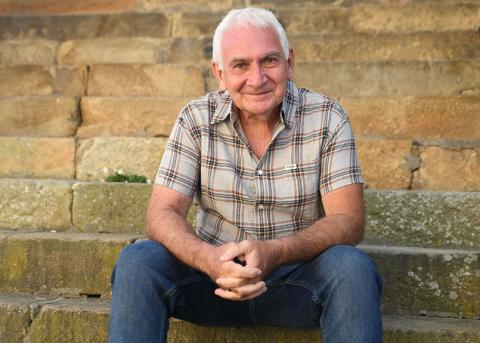Baskische Musikszene: Wenn die Subkultur auf dem Dorfplatz spielt
Die Musik hat nicht nur den Widerstand im Baskenland tanzbar gemacht, sondern auch eine Kultur der Selbstverwaltung geprägt. Heute kämpft die Szene erneut mit der Repression – und mit der Wirtschaftskrise.

Der letzte verhinderte Konzertauftritt liegt erst drei Monate zurück. Betroffen war die Punkband Soziedad Alkoholika. Die Polizei begründete das Auftrittsverbot in Madrid mit möglichen Ausschreitungen und dem Inhalt der Songs. Die selbst ernannte musikalische Trinkvereinigung konterte, dass es bei ihren 800 Konzerten nie zu einem Gewaltausbruch gekommen sei – es gelte die Meinungsfreiheit.
Obwohl die bewaffnete Unabhängigkeitsorganisation Eta im November 2011 einen Waffenstillstand verkündete und faktisch nicht mehr existiert, werden von der spanischen Justiz nach wie vor Organisationen verboten, Jugendliche verhaftet und Bars geschlossen. Zu den Opfern der Repression gehören regelmässig auch baskische Kulturschaffende. Gerechtfertigt wird dies mit einem immer wieder verschärften Antiterrorgesetz (siehe WOZ Nr. 10/2015 ).
Betroffen von Auftrittsverboten war auch schon der bekannteste Botschafter der baskischen Politik und Kultur, der Musiker und Filmemacher Fermin Muguruza. «Ich bin als Sänger geboren, ich will als Sänger leben, und mit Singen vertreibe ich meinen Kummer und mein Leid», erklärte er in seinem Buch über sein musikalisches Schaffen. Mit seinem Bruder Iñigo gründete Muguruza die beiden international bekannten Bands Kortatu (aufgelöst 1989) und Negu Gorriak (aufgelöst 2001). Seither ist er weltweit erfolgreich als Sänger mit seinen Musikprojekten unterwegs, unter anderem mit Manu Chao. Dazu dreht er Dokumentarfilme, vor kurzem ist zudem sein Comicbuch «Black is Beltza» erschienen – Musik und Politik kommen darin nicht zu kurz.
Befreiung der Sprache
Dass die Musik ins Visier einer Justiz gerät, die jegliche Bestrebungen nach Autonomie unterdrücken will, kann nicht weiter überraschen: Die Musik hat die baskische Sprache Euskera erst wieder in die Gesellschaft zurückgebracht. Während der von 1939 bis 1975 dauernden Franco-Diktatur war sie verboten. Das führte dazu, dass zwei Generationen die eigene Sprache nicht mehr öffentlich sprechen konnten. Dadurch, dass die Bands wieder anfingen, auf Euskera zu singen, ebneten sie der Sprache den Weg zurück in die Gesellschaft.
Als die Fesseln der Diktatur weg waren, wuchs der ausserparlamentarische Widerstand zunehmend. Einerseits mit den Aktivitäten der ETA, andererseits aber auch durch eine aktive Widerstandskultur gegen den Zentralstaat, die Repression und eine als verkrustet empfundene Gesellschaft. Durch die schwere Wirtschaftskrise nach dem Ende der Diktatur gab es viele leer stehende Häuser und Fabrikgebäude, ein idealer Nährboden für Hausbesetzungen.
Ein wichtiger Teil der Bewegung war die alternative Rockmusik, der sogenannte Rock Radical Vasco. Die Bands unterstützten den Widerstand in ihren Songtexten oder mit Solidaritätskonzerten. Die politischen Themen waren, neben der Forderung nach Unabhängigkeit vom spanischen Staat, ähnliche wie im Rest Europas: Antikapitalismus, Antirassismus, Häuserkampf, Selbstorganisation, Antiatomkraft, Feminismus. Aktuell war in Spanien nach dem Ende der Diktatur zudem der Kampf gegen die alten Seilschaften der FaschistInnen.
Es gab und gibt unter den Bands, häufig auch unter ihren einzelnen Mitgliedern, Unterschiede in der politischen Ausrichtung. Von offener Unterstützung der Eta und ihres Kampfs für die Unabhängigkeit mit Bomben, Schusswaffen und Entführungen bis zur Ablehnung dieses militärischen Wegs des Widerstands. Einigkeit besteht bis heute in der Kritik an der Repression des spanischen Staats gegenüber der baskischen Bevölkerung.
Mit der Polit-Ska-Punk-Band Kortatu fand die baskische Musik ab 1985 auch den Weg in die Schweiz. Es folgten Konzerte der Kortatu-Nachfolgeband Negu Gorriak, die aus dem Umfeld der Roten Fabrik gefördert wurden. Der Austausch funktionierte auch in der Gegenrichtung: Die Zürcher Frauenband Wemean spielte Konzerte mit Negu Gorriak und veröffentlichte auf einem baskischen Label ein Album.
Neben den Rock-, Punk- und Ska-Bands des Rock Radical Vasco gibt es weitere Musikrichtungen wie Techno, Hip-Hop, Volksmusik, Pop und Chorgesang, deren InterpretInnen sich teilweise politisch äusserten. Zu nennen sind beispielsweise die Hip-Hop-Pioniere Selektah Kolektiboa und MAK sowie die Volksmusikgruppen Tapia eta Leturia und Ene Bada.
Eine weitere baskische Besonderheit sind die sogenannten Bertsolaris. Das ist eine dem Poetry-Slam ähnliche alte Tradition, allerdings werden die Verse gesungen. Ein Bertsolari improvisiert Themen, die kurz vor dem Auftritt festgelegt werden, und singt dann Verse in der baskischen Sprache darüber. Die Themen sind vielfältig: Der Bogen reicht von Politik über die Liebe bis zur Natur. Beim grossen Finale der Bertsolari-Meisterschaft treffen sich bis zu 15 000 Menschen, um die besten acht Bertsolaris live gegeneinander antreten zu sehen.
Bedrohte Sommerfeste
Von Anfang an war in der alternativen Musikszene die Selbstorganisation wichtig. Schon bald wurden erste Fanzines herausgegeben und unabhängige Radiostationen gegründet. Bands produzierten Musikkassetten und Langspielplatten und vertrieben diese selber. Später wurden diese Strukturen teilweise professioneller, und es entstanden Musiklabels wie Gor-Discos, Esan Ozenki, Mil a Gritos Records, Oihuka, Skunkdiskak, Metak und viele andere. Die Labels unterstützten alle das Wachstum der baskischen Musikszene, indem sie Bands die Möglichkeit boten, zu fairen Bedingungen Aufnahmen zu machen und Alben zu produzieren.
Entstanden ist so eine Subkultur, die gewissermassen auf dem Dorfplatz spielt: Vor allem während der «jaiak», der mehrtägigen Sommerfeste in den grossen und kleinen Ortschaften, gibt es im Baskenland viele Auftrittsmöglichkeiten für Musik- und Tanzgruppen. Die tiefe Verankerung der Musik in der Gesellschaft und teilweise gut bezahlte Auftrittsmöglichkeiten haben zu einer der aktivsten und vielseitigsten Musikszenen in Europa beigetragen.
Iñigo Muguruza, eine der wichtigsten Personen der baskischen Musikszene, sagt auf Anfrage dazu: «Die ‹gaztetxes›, die autonom organisierten Jugendzentren, sowie die ‹tabernas› sind elementar für Bands, um sich zu etablieren. Die vielen Auftrittsmöglichkeiten im Sommer an den Festen sind wichtig für die Professionalisierung und Finanzierung.» Eine Unterstützung allerdings, die Muguruza derzeit bedroht sieht: «Leider wird es in diesem Sommer aufgrund der ökonomischen Krise viel weniger Konzerte geben, da die Kommunen weniger Geld zur Verfügung haben.»
Vom 19. bis 26. September 2015 lädt die WOZ zu einer Reise durchs rebellische Baskenland: Auf dem Programm stehen auch Besuche von Volksfesten mit Musik. Reiseleiter ist WOZ-Autor Raul Zelik. Programm und Anmeldung: www.woz.ch/wozunterwegs/2015. Anmeldeschluss ist der 11. Juni 2015.