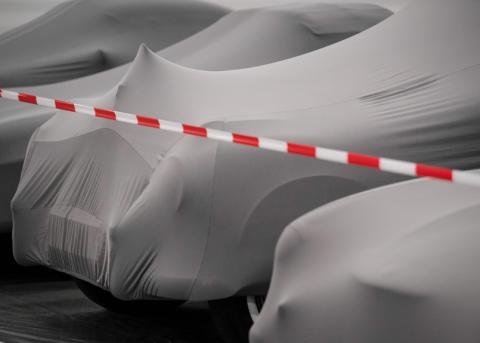Klima und Gerechtigkeit: Für einen Klimaschutz für die 99 Prozent
In der Vergangenheit lassen sich Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft finden – insbesondere wenn es darum geht, die Klimafrage mit der sozialen Frage zu verknüpfen.
Sind die Interessen der ArbeiterInnen unvereinbar mit den Interessen an einer intakten Umwelt? Befinden wir uns im Zeitalter des Klimawandels in einer Zwickmühle zwischen Arbeitsplätzen und Klimaschutz? Diese Fragen sind so alt wie die Umweltbewegung selbst. In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen der ArbeiterInnenbewegung und der Klima- und Umweltschutzbewegung alles andere als einfach. Umweltschutzorganisationen zeigten sich nicht immer empfänglich für Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite schenkten linke Parteien und Gewerkschaften ökologischen Anliegen häufig nur wenig Aufmerksamkeit. Bis heute verteidigen gewisse Gewerkschaften die fossile Industrie, anstatt einen sozial- und umweltverträglichen Umbau dieser Produktionszweige anzustreben. Einige AktivistInnen in der deutschen Gewerkschaft IG Metall etwa wehren sich immer noch gegen griffige Klimaschutzmassnahmen.
Doch seit dem Aufkommen der aktuellen Klimabewegung ist einiges in Bewegung geraten. Mit ihrer Forderung nach Klimagerechtigkeit zeigen AktivistInnen auf, dass die Klimafrage auch eine soziale Frage ist. Besitzt Klimagerechtigkeit das Potenzial, Fragen des Umweltschutzes, des menschlichen Zusammenlebens, der Gesundheit, der Anerkennung von Diversität sowie der Gerechtigkeit miteinander zu verbinden? Dass dies möglich sein kann, zeigt ein Blick in die Geschichte.
Naturschutz «von oben»
Die Sorge um eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen reicht weit zurück. Seit der Entstehung des Kapitalismus vor 500 Jahren sprachen sich verschiedene Stimmen immer wieder für eine weitsichtige Bewirtschaftung der Naturschätze aus. Grosse Aufmerksamkeit galt dabei der Forstwirtschaft. Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts schlug der britische Architekt und Gartenbauer John Evelyn Massnahmen gegen einen befürchteten Holzmangel vor. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Regulierung der Waldbestände entstand Anfang des 18. Jahrhunderts der deutsche Begriff der «nachhaltenden» Bewirtschaftung. Urheber dieses Begriffs war der Forstwirtschafter Hans Carl von Carlowitz, der sich vor allem mit Blick auf die sächsischen Minenregionen um eine nachhaltige Nutzung der Ressource Holz sorgte.
Nun zielten aber diese Politiken der nachhaltigen Ressourcennutzung meistens auf die Absicherung von Herrschaft und Profit und verschärften dadurch soziale Ungleichheiten. So stand die staatliche Regulierung der Waldbestände im Dienst kriegswirtschaftlicher und kommerzieller Interessen: Um Schiffe bauen zu können, mit denen Handel getrieben, Kriege geführt und entlegene Gegenden kolonialisiert werden konnten, vertrieb man die lokale Bevölkerung aus den Wäldern. John Evelyn war nicht zufällig Befürworter des Kolonialismus und gleichzeitig Gegner von gemeinschaftlichen Formen der Waldnutzung, dank derer lokale Bevölkerungsgruppen ihren Lebensunterhalt sichern konnten.
Weniger um eine nachhaltige Ressourcennutzung als um den Schutz einer unberührten, majestätischen Natur ging es dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, als zuerst in den Vereinigten Staaten Nationalparks gegründet wurden. Doch auch hier handelte es sich in erster Linie um eine elitäre Politik mit rassistischen und kolonialistischen Konsequenzen, verstand man die schützenswerte Natur doch als frei von menschlichem Eingriff. Wer direkt von den natürlichen Ressourcen lebte, wurde zu einem Eindringling erklärt, der das angeblich spontane Gleichgewicht der Natur störe. Deshalb ging die Gründung der amerikanischen Nationalparks mit der gewaltsamen Vertreibung der Indigenen aus diesen Gebieten einher.
Umweltschutz «von unten»
Doch die Geschichte des Natur- und des Umweltschutzes hat ihre Wurzeln nicht nur in der Schaffung von Naturreservaten. Einer anderen Geschichte des Umweltschutzes lässt sich in den Dörfern, Fabriken, ArbeiterInnenquartieren und Haushalten nachspüren. Dort also, wo Arbeitstätige – und dazu gehörten nicht nur die stereotypen weissen, männlichen Industriearbeiter – Bedarfswirtschaft betrieben, produzierten und lebten. In ihren Kämpfen für körperliche und geistige Integrität und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie in ihren Gemeinschaften manifestiert sich ein ökologisches Bewusstsein, das dem Zusammenhang zwischen Ausbeutung der Menschen und Ausbeutung der Natur auf den Grund geht.
Nebst ländlichen Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten für den Schutz der Ökosysteme kämpfen, von denen ihr Leben abhängt, zeigen sich auch in einigen Industrien Ansätze eines solchen Umweltschutzes «von unten». Im Jahr 1888 wehrten sich zum Beispiel Minenarbeiter aus der andalusischen Stadt Huelva gegen die britische Rio Tinto Company. Sie forderten nicht nur höhere Löhne, sondern prangerten auch die giftigen Schwefeldioxidemissionen an, die durch den Kupferabbau in grossen Mengen entstanden. Dabei erhielten die Minenarbeiter auch von den Bauern Unterstützung, gemeinsam bildeten sie die «Liga gegen den Rauch».
Es war wahrscheinlich Maximiliano Tornet, der in Kuba geborene Anarchist und Anführer der kämpfenden Arbeiter aus Huelva, der für eine anarchistische Zeitung aus Barcelona in einem anonym publizierten Artikel schrieb: «Felder, die früher für ihr üppiges Leben und ihre glänzende Schönheit gepriesen wurden, wurden zu Ödland wegen der stinkenden Atmosphäre, die entsteht, weil ein Unternehmen den Ruin eines Landkreises in Reichtum für einige wenige verwandelt.» Die britischen Unternehmer hatten kein Verständnis für solche Anliegen und liessen die Armee eingreifen, die ein Massaker anrichtete.
Forderungen nach mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert auch von europäischen Gewerkschaften immer wieder aufgegriffen. Für diesen Umweltschutz «von unten» war der Schutz der Natur demnach auch immer der Schutz des eigenen Körpers: Schutz vor Rauch, giftigen Substanzen, gefährlichen Maschinen, langen Arbeitstagen, schlechter Nahrung und vielem mehr. Soziale und ökologische Anliegen waren eng verstrickt.
Engagierte Gewerkschaften
Nach dem Zweiten Weltkrieg drängte die Umweltfrage zunehmend ins öffentliche Bewusstsein, nicht zuletzt dank Gewerkschaften in den USA und Europa, die das Thema in den sechziger und siebziger Jahren aufgriffen. Die US-amerikanische Automobilgewerkschaft UAW etwa forderte entschieden höhere Umweltschutzstandards. In Detroit gründete sie Ende der 1960er Jahre die Downriver Anti-Pollution League, ein Kollektiv, das sich gegen Wasserverschmutzung wehrte. Die Gewerkschaft unterstützte auch den 1970 erstmals durchgeführten Tag der Erde, an dem im ganzen Land an die zwanzig Millionen Menschen auf die Strasse gingen. Für den Leiter der Gewerkschaft, Walter Reuther, war die Umweltverschmutzung Ausdruck «einer Krise in unserem Wertesystem», und er wehrte sich dagegen, den Kampf um Arbeitsplätze gegen Umweltschutzforderungen auszuspielen. Ein Mitglied einer UAW-Sektion aus St. Louis schrieb damals gar: «Es wäre besser, wenn wir die Fabriken niederreissen, die Minen verlassen, die Ölquellen zustopfen und Zucker in die Autotanks füllen würden, statt mit diesem apokalyptischen Wahnsinn weiterzumachen.» Zur selben Zeit kooperierten in Italien Soziologinnen mit Gewerkschaftern und entwickelten einen «Umweltschutz der ArbeiterInnen». Dabei sollten die Erfahrungen und Kenntnisse der Lohnabhängigen ernst genommen werden und nicht hinter einem technokratischen Expertenwissen verschwinden.
Auf diese Weise entwickelte eine junge Generation von GewerkschaftsaktivistInnen eine neue Form des Engagements, das über lohnspezifische Forderungen hinausging. Selbst Themen wie Wohnen und Konsumieren tauchten jetzt auf den Agenden der Gewerkschaften auf. Joseph Yablonski, Gewerkschafter der US-amerikanischen Minenarbeiter, hielt Mitte der siebziger Jahre fest: «Was bringt uns eine Gewerkschaft, die den Kohlenstaub in den Minen reduziert, wenn die Minenarbeiter und ihre Familien dann Chemikalien über die Luft und das Wasser aufnehmen und verschmutzte Nahrungsmittel essen?» Aus solchen Ansätzen entstanden auch Allianzen mit Umweltschutzorganisationen. Der Sierra Club etwa unterstützte gewerkschaftliche Forderungen nach mehr Sicherheits- und Umweltschutzstandards. Und 1973 riefen elf grosse US-amerikanische Umweltorganisationen zu einem Boykott des Ölunternehmens Shell auf, das Arbeitende bestreikten.
Nicht zufällig nahmen solche Allianzen in den sechziger und den siebziger Jahren Form an, als die Antikriegsbewegung, die zweite Welle des Feminismus, die Bürgerrechtsbewegung und eine antiimperialistische Internationale die herrschende Gesellschaftsordnung radikal infrage stellten. Auch Umweltschutzanliegen wurden teilweise als grundlegende Kritik am energiehungrigen und ressourcenverschwendenden Kapitalismus formuliert. «Die Emanzipation verlangt tiefer greifende Veränderungen als eine einfache Mehrung der Konsumgüter», war 1976 in einer Zeitschrift der französischen Gewerkschaft CFDT zu lesen. «Die sozialistische Gesellschaft ist nicht eine des ‹grossen Fressens›, sondern eine, in der die Produktion wirklich nach den Bedürfnissen ausgerichtet ist und die ökologischen Gleichgewichte berücksichtigt werden.»
Der Wirtschaftskrise der siebziger Jahre und der darauffolgenden neoliberalen Offensive hielt diese Öffnung der Gewerkschaften gegenüber Umweltschutzforderungen allerdings nicht stand. In Zeiten der Prekarisierung und der Auslagerung von Industriestandorten priorisierten die meisten Gewerkschaften in den westlichen Ländern erneut die Verteidigung von Arbeitsplätzen. Unter der erdrückenden Last der neoliberalen Alternativlosigkeit brach auch die Kooperation zwischen Umweltschutz und Gewerkschaften zusammen.
Die Systemfrage stellen
Gegenwärtig intensiviert sich die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und der Klimabewegung, auch in der Schweiz, wo verschiedene Gewerkschaften den für den 15. Mai geplanten Strike for Future unterstützen. In einer Resolution aus dem letzten Jahr wies der VPOD auf die gemeinsamen Anliegen von Klimastreik und Gewerkschaften hin: Weil der Klimawandel die «Arbeits- und Lebensbedingungen von hunderttausenden von Lohnabhängigen» gefährde, müsse die Klimabewegung auch «auf die Arbeitsplätze ausgedehnt werden». Die Klimafrage ist auch eine soziale Frage.
Dennoch setzen im Kampf gegen die Klimaerhitzung auch hierzulande noch viele Linke vornehmlich auf technologische Lösungen. Es fehle das explizite Ziel, «die herrschenden Machtverhältnisse und die heutigen Lebens- und Konsumgewohnheiten ernsthaft zu verändern», stellt Beat Ringger in seinem «System-Change-Klimaprogramm» fest.
Prägnantestes Beispiel ist der «Klima-Umbauplan», den die Unia-Zeitschrift «Work» im vergangenen September publizierte. Er schürt nicht nur die utopische Hoffnung auf einen «klimaneutralen» Flugverkehr bis 2030. Auch den äusserst umstrittenen Handel mit Emissionsrechten heisst er mittelfristig gut, ebenso die umweltpolitisch sehr problematische Elektrifizierung des Privatverkehrs. Soziale Forderungen wie eine grundlegende Umverteilung des Reichtums fehlen dagegen. Dasselbe gilt für eine Reduktion der Arbeitszeit, obwohl diese Forderung bereits 1983 in einem Programm für grüne Arbeitsplätze der Gewerkschaft Bau und Holz – einer Vorgängerorganisation der Unia – zu finden war. Unerwähnt bleiben schliesslich der Finanzplatz und die hiesigen Grosskonzerne, die auf globaler Ebene massgeblich für Klimawandel und Umweltzerstörung verantwortlich sind und gegen die vonseiten der Klimabewegung zunehmend Kritik laut wird.
Einzig mit neuen Technologien ist der Klimakrise nicht beizukommen. Ringger zeigt: Wer wirksam gegen Klimawandel und Umweltzerstörung vorgehen und das Ziel von Gleichheit und Emanzipation nicht aus dem Blick verlieren will, muss die Systemfrage stellen.
Kein grenzenloses Wachstum
Die Wachstumslogik des Kapitalismus kollidiert zwangsläufig mit der Funktionsweise unserer Ökosysteme. Deshalb kann der Ausweg aus der Klimakrise nur über einen grundlegenden Umbau von Produktion und Konsum führen. Ressourcenverschwendende und energiehungrige Produktionsformen müssen radikal zurückgefahren, Arbeiten im Care-Bereich hingegen ausgebaut werden. So bietet sich auch die Chance, fruchtbare Brücken zur feministischen Bewegung zu schlagen.
Denn in der Klimakrise manifestiert sich eine grundlegende Krise der kapitalistischen Zivilisation. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als die Reproduktion des Lebens, wie es die Feministin Silvia Federici treffend formuliert. Umweltkatastrophen, Ernteeinbrüche, Enteignung von KleinbäuerInnen, Beschränkung reproduktiver Rechte von Frauen, Abbau der öffentlichen Dienste, geschlechterspezifische Gewalt, Armut und Prekarität sind verschiedene Folgen eines Systems, das Profite über Leben stellt.
So sind es nicht zufällig Frauen, die heute an vorderster Front gegen diese vielfältigen Krisen kämpfen. Die feministischen Bewegungen der letzten Jahre haben nicht nur die rechtliche Gleichstellung, sondern auch die Aufwertung und gerechtere Verteilung der Sorgearbeit aufs Tapet gebracht. In ihren Kämpfen werden die Konturen einer Welt erkennbar, in der die Sorge um Mitmenschen und die Natur ins Zentrum unserer menschlichen Tätigkeiten rückt. Anders ausgedrückt: Wenn soziale und ökologische Anliegen verknüpft werden sollen, dann muss dies auch aus einer feministischen Perspektive geschehen.
Viele aktuell zur Diskussion stehenden Klimaschutzmassnahmen weisen Parallelen zum früheren Naturschutz «von oben» auf. Um CO2 zu kompensieren, werden erneut Indigene vertrieben, wie viele Berichte über Kompensationsprojekte in Ländern des Globalen Südens verdeutlichen. Treibstoffsteuern werden überproportional auf Geringverdienende abgewälzt. Gleichzeitig beschneidet man die Rechte von Lohnabhängigen, verlängert die Arbeitszeit, senkt Steuern, privatisiert Energie- und Stromunternehmen und baut öffentliche Dienste ab. Solche marktliberalen Massnahmen verschärfen nicht nur soziale Ungleichheiten, sie unterminieren zugleich die Möglichkeiten einer kollektiven, demokratischen Mitbestimmung – Instrumente, die zur Verwirklichung eines sozialverträglichen Klimaschutzes dringend nötig sind.
Dass politische EntscheidungsträgerInnen angesichts des Klimawandels komplett untätig bleiben, ist eine verbreitete Fehleinschätzung. Klar, ihre Massnahmen zur Reduktion des Treibhausgasausstosses sind absolut ungenügend. Sie handeln aber sehr wohl in anderen Bereichen. Indem sie weltweit Grenzmauern bauen und die Aussengrenzen Europas militarisieren, schneiden sie Klimaflüchtlingen systematisch Fluchtwege ab. Und mit dem Schüren fremdenfeindlicher und unsolidarischer Stimmung grenzen sie bestimmte, ausserordentlich stark vom Klimawandel betroffene Bevölkerungsgruppen aus. Schliesslich ist auch die globale militärische Aufrüstung unter anderem als Vorbereitung auf künftige geopolitische Konflikte um Ressourcen zu verstehen. Seit Jahren beziehen zum Beispiel US-Militärstrategen den Klimawandel in ihre Erwägungen ein – das hat sich auch unter dem Klimawandelleugner Donald Trump nicht geändert. Alle diese Politiken zielen darauf ab, den Mächtigen und Reichen auch in einer wärmer werdenden Welt ihre Privilegien zu sichern.
Vom besseren Leben träumen
Dieser Politik für das eine Prozent muss ein Klimaschutz für die 99 Prozent entgegengestellt werden: ein Klimaschutz, der mehr soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Selbstbestimmung sowie Solidarität einfordert. Systemwandel bedeutet auch, verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden und sich auf eine wichtige Stärke der historischen ArbeiterInnenbewegung zurückzubesinnen: die Fähigkeit, zu streiken – sprich: Gehorsam zu verweigern – und das aktuell auf die Klimakatastrophe hinführende «business as usual» zu unterbrechen. Dass der Klimastreik im vergangenen Jahr auch von einer feministischen und ökologischen Bewegung als Aktionsform aufgenommen wurde, sollte uns darin bestärken, diese Anknüpfungspunkte mehr denn je zu suchen.
Ein Klimaschutz für die 99 Prozent ist somit sowohl Fortsetzung alter Kämpfe als auch Neuerfindung. Er hat seine Wurzeln im Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus und Internationalismus von emanzipatorischen Bewegungen der Vergangenheit. Er ist deshalb entschieden links. Gleichzeitig verlangt ein Klimaschutz für die 99 Prozent auch neue, kreative Alternativen. Ein menschenwürdiges Leben für alle ist nur möglich, wenn der Produktivismus vieler linker Strömungen überwunden wird. Soziale Absicherung, Umverteilung und Gleichheit können nicht mehr einfach durch Produktivitätssteigerungen und neue Technologien erreicht werden.
Wie wir in die Vergangenheit blicken, bestimmt auch, wie wir handeln und von welchen Alternativen wir träumen. So ermöglicht der emanzipatorische Horizont eines Klimaschutzes für die 99 Prozent, an das Vorhaben anzuknüpfen, das bereits vor gut hundert Jahren die US-amerikanische Sozialistin, Feministin und Gewerkschafterin Pauline Newman antrieb. Als sie sich 1912 für eine Reduktion der Arbeitszeit aussprach, träumte sie auch von einem reichhaltigeren Leben und anderen Beziehungen zur Natur: «Was für eine herrliche Zeit ist doch der Frühling. (…) Wie gerne würdest du über das jüngst zum Leben erweckte Land rennen, statt vor einer Maschine zu sitzen! Oh, wie gerne würdest du die reine Luft einatmen und von den Sonnenstrahlen gewärmt werden! Wie gerne würdest du über die Felder streifen, vor dich hinträumen und die Schönheit der Natur bewundern!»