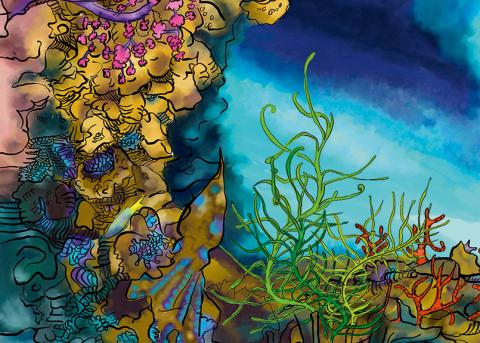Klima und Ressourcen: Hinter dem Horizont
Kapitalismus und Nachhaltigkeit lassen sich nicht vereinbaren. Aber es gibt trotzdem viel zu tun. Ein Plädoyer.
Diese Einigkeit ist schon seltsam. Überall die gleichen Bilder: Flutwellen, ausgedörrte Böden, schmelzende Gletscher, aussterbende Eisbären. Und überall die gleiche Botschaft: Es ist schlimm und bedrohlich - aber der Kapitalismus wird die Kurve schon kriegen. Und die Klimaschutzmassnahmen führen sogar zu neuen Märkten! Zu Wachstum, sogenannt nachhaltigem. Wir brauchen Minergiehäuser und Hybridautos, aber sonst kann alles weitergehen wie bisher. Und wir sollten mehr ins Theater, damit die Wirtschaft ökologisch wächst, wie Daniel Lampart, der Zentralsekretär des Gewerkschaftsbundes, kürzlich vorschlug (siehe WOZ Nr. 44/06). Glauben die eigentlich, was sie sagen?
Es geht nicht nur ums Klima, sondern auch um die Ressourcen. Das Wort «Nachhaltigkeit» kommt aus der Forstwirtschaft und bedeutet, nicht mehr Bäume zu fällen, als nachwachsen. Aber Erdöl, Erdgas, Eisen und alle anderen Stoffe aus dem Erdinnern wachsen nicht nach. Eine Wirtschaft, die auf solchen Stoffen basiert, kann nie nachhaltig sein. Wachstum verbraucht Ressourcen und setzt CO2 frei - auch Minergiehäuser fressen Boden, auch Hybridautos fahren auf Strassen. Und wer das Wachstum mit mehr Kulturkonsum ankurbeln will, soll einmal ausrechnen, wie lange es dauert, bis wir das ganze Leben im Theater verbringen.
«Es ist kein politischer Entscheid, der sagt: Wachst! Es ist eine Folge unseres Systems», sagt Gewerkschafter Daniel Lampart. Genau. Und dieses System infrage zu stellen, wagt fast niemand. Für die FDP wie für den Gewerkschaftsbund, für die Grünen und den WWF wie für die CVP ist es der «unüberschreitbare Horizont», wie es die streitbaren Gewerkschafter Hans Schäppi und Willi Eberle kürzlich im «Widerspruch» genannt haben. Es ist Zeit, hinter diesen Horizont zu blicken.
Was tun? Die WOZ hat diesmal nicht die grossen Umweltorganisationen oder Parteien gefragt. Sondern Leute, die in ihrem Leben, in ihrer Arbeit mit Ökologie und Ressourcen zu tun haben und darüber nachdenken, was sich ändern sollte.
1. Besser leben
Daniel Marti aus Meilen ist ein Förster ohne Wald - er pflegt und fällt Bäume bei den KundInnen zu Hause. Ausserdem organisiert er naturkundliche Spaziergänge im Wald. Er schlägt eine Art Maximallohn vor: «Ein Lohn über 6000 Franken ist für niemanden vertretbar. Wer mehr verdient, konsumiert zu viel. Weniger konsumieren schont alles: die Erdölvorräte, den Regenwald, die Nerven der Menschen.»
Konsumverzicht ist eine alte, unpopuläre Forderung der Ökologiebewegung. Wahlen lassen sich damit nicht gewinnen. Gerade auch die Linken sträuben sich dagegen, ist doch Wohlstand für alle seit je eine zentrale Forderung der ArbeiterInnenbewegung gewesen. Aber was heisst Wohlstand? Gutes Essen, Bildung, Wohnung? Oder Auto, Flugreisen, Einfamilienhäuschen?
Daniel Marti hat letztes Jahr im Auftrag der Stadt Bern einen Wettbewerb organisiert. Neunzig Personen machten mit. Sie liessen sich ausrechnen, wie hoch ihr persönlicher CO2-Ausstoss war. Nach einem halben Jahr wurde wieder ausgerechnet; wer seine Bilanz am stärksten verbessert hatte, gewann einen Preis. «Aber nur noch neun der neunzig Personen nahmen überhaupt an der zweiten Berechnung teil», sagt Marti. «Alle andern hatten wohl ein schlechtes Gewissen.»
Bei den verbleibenden TeilnehmerInnen stellte Marti allerdings etwas Interessantes fest: «Mehrere Leute hatten ihre CO2-Bilanz stark verbessert - und das nicht einmal gemerkt. Sie waren zum Beispiel näher an ihren Arbeitsort gezogen und konnten nun mit dem Velo zur Arbeit. Oder sie hatten eine geplante Flugreise abgesagt. Sie hatten nicht den Eindruck, auf etwas verzichtet zu haben. Im Gegenteil.» Dieses Resultat lässt Daniel Marti hoffen. Und in diese Richtung könnte es gehen: endlich weg von der Vorstellung, wir verpassten etwas ohne Auto, Flugreisen und den neuen Fernseher. Langsamer leben und das auch propagieren, Gemeinschaftsgärten mit den feinsten Gemüsen anlegen. Weniger Geld, dafür mehr Zeit haben.
Das ist ja schön. Aber es wird nicht genügen. Die Mehrheit wird nicht mitmachen. Und sowieso lässt sich ein politisches Problem nicht auf privater Ebene lösen. Also weiter zum zweiten Punkt.
2. Politisch handeln
Hannes Reiser aus Basel gehört zu Longo Mai. Das Kooperativennetzwerk versucht, selbst verwaltete ökologische Landwirtschaft und politische Aktion zu verbinden - in Basisarbeit für Sans-Papiers oder Kampagnen gegen die neue Agrarpolitik. «Wir brauchen einen grossen Paradigmenwechsel», sagt Reiser. «Der Kapitalismus ist ein Relikt aus der Zeit, als man dachte, die Ressourcen seien unendlich.» Er ist zuversichtlich: «Wenn ein System die Grundbedürfnisse - und saubere Umwelt ist ein Grundbedürfnis - nicht mehr erfüllt, wehren sich die Leute.» Bewusstseinsbildung ist ein wichtiges Stichwort für Hannes Reiser. «Wenn wir auf unserer Kooperative in Ostdeutschland eine Solarheizung installieren, wissen wir, dass das nicht die grosse Veränderung bringen wird. Es geht darum, das Bewusstsein zu verbreiten, dass es auch anders geht. Dass eine Wirtschaft möglich ist, die sich nach den Grundbedürfnissen und dem persönlichen Kontakt zwischen den Menschen ausrichtet.»
Neben einer neuen Konsumkultur im Privatleben braucht es die Politik in allen Formen. Kampagnen gegen multinationale Unternehmen und Anti-Wef-Proteste genauso wie das Fördern und Fordern von umweltfreundlichen Technologien und Arbeitszeitverkürzung. Demonstrationen und lokale Umwelt- schutzgruppen genauso wie parlamentarische Politik. Es braucht materielle Anreize für ökologisches Verhalten, zum Beispiel die längst fällige Kerosinsteuer, damit Bahnfahren wieder günstiger wird als Fliegen. International gibt es zwar Ansätze für eine ökologische Steuerung (siehe WOZ Nr. 11/06), doch der Spielraum ist politisch begrenzt - in der geplanten EU-Verfassung sollte sogar die neoliberale Politik festgeschrieben werden. Diese Verfassung ist genau daran gescheitert - aber die EU hält weiter an ihrem neoliberalen Kurs fest, der politische Eingriffe zunehmend einschränkt.
3. Vorausdenken
Monika Böckle wohnt in Zürich. Nach einigen Jahren im WOZ-Verlag hat sie sich entschlossen, ihr angefangenes Jus-Studium zu beenden. Ökologie und globale Gerechtigkeit sind für sie nicht zu trennen. Lange hat sie ehrenamtlich in einem Weltladen gearbeitet. «Ich bin ziemlich resigniert. Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, es werde einmal Fairtrade-Kaffee im McDonald's geben, hätte ich es nicht geglaubt. Aber ist es das, was wir wollten? Die Uni hat einen Leitfaden für sprachliche Gleichberechtigung herausgegeben, und es gibt jetzt das Fach Wirtschaftsvölkerrecht. Das sind alles gute Ansätze. Natürlich sind sie nicht radikal genug, aber wie realisieren wir radikale Forderungen?» Wie Daniel Marti glaubt Monika Böckle, dass ein viel ökologischeres Leben ohne Verlust an Lebensqualität möglich wäre: «Wenn die Leute aufhören würden, für jede Saison eine neue Garderobe zu kaufen, wären Berge von Waren gespart. Aber wer nicht die neuste Mode trägt, fällt auf. Eine umfassendere Bildung wäre nötig: Dass es andere Methoden der Frustbewältigung gibt, als shoppen zu gehen, sollte in der Schule ein Thema sein.»
Dass die Ressourcen beschränkt sind und sich der heutige Lebensstil nicht beibehalten lässt, sollte in alle politischen Fragen einbezogen werden: Es ist kurzsichtig, heute die Landwirtschaft zu industrialisieren und dadurch noch erdölabhängiger zu machen. Es ist unverantwortlich, grosse landwirtschaftliche Flächen im Berggebiet aufzugeben, die vielleicht bald wieder dringend gebraucht werden, weil es keine Billigimporte mehr gibt. Wenn das Erdöl knapp wird, ist es auch vorbei mit billigen Faserpelzen und Nylonstrümpfen, und Schafwolle ist wieder gefragt. Und so weiter.
4. Diskutieren
Hans Jörg Geiger ist Primarlehrer und Künstler. Er lebt in Wald-Schönengrund, an der Grenze zwischen Toggenburg und Appenzell Ausserrhoden. Er bezeichnet sich als Umweltbewegten und hat immer wieder an diesem Thema gearbeitet, in künstlerischen Aktionen genauso wie im Schulalltag. «Sensibilität entsteht nur in einem entschleunigten Feld, also auch um zu erkennen, was wir wirklich brauchen», schreibt er in seinem Mail. «Man lernt dabei ja auch, mit den eigenen Energien verträglich, was auch ökonomisch genannt werden kann, umzugehen.» Er beobachte immer wieder, dass Menschen, die mit Waren und Energie verschwenderisch umgingen, auch zu ihren eigenen Ressourcen keine Sorge trügen, sagt Hans Jörg Geiger. Er hört nicht auf, darüber nachzudenken, wie es möglich wäre, «den Schrebergarten Erde kultiviert zu behandeln».
Wie ist ein gutes Leben für alle möglich? Was ist ein gutes Leben? Wie ist eine Regulierung des Konsums ohne autoritäre Massnahmen möglich? Wie kann festgelegt werden, wie viel verbraucht werden darf? Wie wird gerecht verteilt? Die Diskussion über alle diese grossen Fragen sollte heute beginnen, an den Universitäten und am Küchentisch. Die Auseinandersetzung sollte wohl auch härter werden, weg von den heute beliebten Argumenten, Umweltschutz sei für alle gut, auch für die Wirtschaft.
Auch wenn alle WOZ-LeserInnen ab sofort diese vier Punkte berücksichtigen, wird es nicht genügen. Der Klimawandel wird dramatisch, die Ressourcen werden knapp, die Verteilungskämpfe hässlich. «Der Malediver steht im Vorgarten und möchte den gestundeten Benützungslohn für den nun versunkenen Badestrand einfordern», wie Hans Jörg Geiger schreibt. Aber wer ob diesen Prognosen zynisch wird oder sich selbst belügt, wird auch kein angenehmes Leben führen. Wir können weiter in die falsche Richtung rennen und hoffen, dass erst die übernächste Generation dafür zahlen wird. Oder wir können versuchen, uns vorzubereiten.