Die Krise von oben: Mitten in die Paranoia
Superreiche bunkern Schweizer Gold, Passhändler wittern in der Krise eine Chance – und ein Privatjetunternehmer sammelt in der Welt gestrandete SchweizerInnen ein. Szenen aus der Coronawelt der Privilegierten.
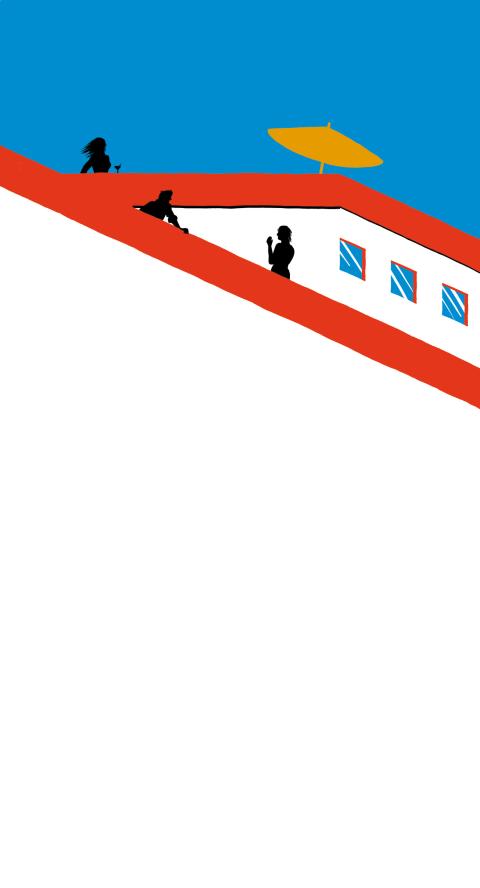
Luxus kann überraschend schäbig daherkommen, denkt man sich auf dieser Terrasse am Zürcher Limmatquai. An der Hauswand ein Teppich aus Efeu. Davor steht eine monströse, vierbeinige Lampenkonstruktion, die aussieht wie das Werk eines Hobbyschlossers. Drei LED-Leuchten geben bloss ein schwaches Licht ab, das vierte ist kaputt. Über der Treppe, die auf ein Dach mit Liftschacht-Kabäuschen führt, ist eine Metallplatte angebracht, darin eingefräst: das leuchtende Logo der «Le Bijou»-Kette.
Die Appartements der Luxuskette kosten zwischen 400 und 1200 Franken – pro Nacht. Das Exemplar am Limmatquai mit seinen etwa 80 Quadratmetern mit Parkettböden, zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern kann man auf den Buchungsplattformen derzeit für 650 Franken mieten. Für den Preis bekommt man Sicht auf die Limmat und den «Le Bijou»-typischen «Chaletchic»: Er manifestiert sich im Schlafzimmer in künstlichen Cheminées mit glimmender Fake-Kohle und Wasserdampf. Das echte Brennholz daneben ist bloss Dekor. Wer hier residiert, kann sich komplett von der Aussenwelt abschotten: Das Einchecken läuft über einen Code, Besorgungen lassen sich über den digitalen Butler «James» machen, eine App, die in der Wohnung auch das Licht dimmt oder die Musik einstellt, wenn man «James» darum bittet. Das Fazit nach einer Testnacht: Lohnt sich nicht.
Lockdown – aber mit Komfort!
Le Bijou vermietet in Zürich, Bern, Basel, Luzern und Zug mehr als vierzig Wohnungen, alle an «Toplage». Mitbegründer Alexander Hübner sagt am Telefon: Trotz des Coronareiseverbots seien die Wohnungen derzeit zu rund sechzig bis siebzig Prozent ausgelastet. Das Unternehmen bewirbt das kontaktfreie Konzept nun als spezielles Quarantäneangebot. Dazu arbeitet Le Bijou mit der Privatklinik Double Check zusammen, die bei Bedarf Coronatests in die Wohnungen liefert und medizinische Überwachung auf Abruf anbietet.
Hübner fragt zwar nicht nach den Buchungsgründen. Er stellt aber einen Trend zu längeren Aufenthalten fest – und manche KundInnen teilten ihm auch direkt mit, dass sie die Appartements zu Quarantänezwecken nutzen. Während seine Kundschaft früher vor allem aus Businessreisenden bestanden habe, die ein paar Tage gebucht hätten, vermietet er die Wohnungen nun meist für ein, zwei Wochen. Seltener auch für ein, zwei Monate. Manche der Gäste seien in der Schweiz gestrandet und wollten hier möglichst komfortabel durch den Lockdown kommen. Andere gingen nach einem Auslandsaufenthalt in Quarantäne, bevor sie zu ihren Familien zurückkehrten. Auch ältere RisikopatientInnen würden das Angebot nutzen, um sich von ihrem Umfeld zu isolieren.
Die Angst vor dem Crash
Die Schweiz bleibt in der Krise, was sie immer war: Hafen und Drehscheibe für die Privilegierten dieser Welt. Je exklusiver die Sphären, desto mehr Selbstverständlichkeit schlägt einem entgegen. Während sich Le Bijou spürbar um eine luxuriöse Aura bemüht, macht man im Klub der obersten zehn Prozent auf «Du und Du». Paddy Blewer, PR-Verantwortlicher von Henley & Partners, zeichnet seine E-Mails locker mit «Paddy». Die Firma, für die er arbeitet, ist der Marktführer einer globalen Milliardenbranche: dem Handel mit Pässen und Aufenthaltsbewilligungen.
«Henley & Partners»-Gründer Christian Kälin hat das Geschäft vor knapp 25 Jahren auf den karibischen Offshore-Inseln erfunden. Heute können sich Superreiche auch in zahlreichen Ländern Europas einkaufen: Einen Pass gegen Investitionen in Immobilien und Staatsfonds gibts etwa auf den Mittelmeerinseln Malta und Zypern. Viele weitere europäische Länder, zum Beispiel Portugal, Griechenland oder Bulgarien, bieten gegen Investitionen immerhin eine Aufenthaltsgenehmigung. Reisefreiheit sowie der Zugang zum europäischen Banken- und Businesssystem oder zu exklusiven Privatschulen verleiten internationale Grossverdiener zum Passkauf. Die Branche macht immer wieder Schlagzeilen mit Verstrickungen in die Halbwelt: wenn sich etwa russische Oligarchen mit Verbindungen zum Kreml in Europa einkaufen.
Für Firmen wie Henley & Partners gilt: je volatiler die Welt, desto besser das Business. Das Unternehmen habe in den letzten zehn Jahren der Krisen und Kriege ein deutliches und konstantes Wachstum verzeichnen können, sagt der PR-Verantwortliche. Nun versucht Henley & Partners, auch aus der Coronakrise Profit zu schlagen. Diese trifft die oberen zehn Prozent mitten in ihre Paranoia: Die Angst vor dem grossen Wirtschaftscrash steigert die Angst vor dem Vermögensverlust. Blewer sagt, was auf der Welt gerade passiere, sei auf einer menschlichen Ebene schrecklich. Doch die prognostizierten langfristigen Marktturbulenzen wirkten sich auch massiv auf die globalen Vermögensportfolios aus. Die Reichen suchten deshalb nach sicheren Investitionen. Sie wollten weg von den High-Risk-Anlagen. Es gehe nun um «Portfolio Diversification». Da biete sich das Passprogramm seiner Firma an. Die KundInnen erhielten in der Krise nicht nur die bekannten Vorteile eines Zweit- oder Drittpasses. Sie könnten ihr Geld auch sicher in Staatsfonds und Immobilien anlegen. In einem PR-Text preist Henley & Partners ihr Angebot deshalb als «die neuste Option in der Safe-Haven-Anlageklasse» an.
Blewer kann noch nicht abschätzen, wie sich die Coronakrise mittelfristig auf die Geschäfte von Henley & Partners auswirken wird. Das Prozedere des Passkaufes dauere schliesslich, sagt er. Eine Bilanz könne man also erst in ein paar Monaten ziehen. Derzeit stelle man aber zumindest ein gesteigertes Interesse fest.
Goldrausch
Anruf bei einem grösseren Goldhändler im Raum Zürich. Viel fragen muss man nicht, der Mann legt sofort los. «Es ist etwas in den Köpfen», sagt er, «etwas Psychologisches.» Die Leute lesen in der Zeitung von Depression, Rezession, Hyperinflation. «Und wenn sie Angst kriegen, dann ‹secklen› sie ins Gold.» Zu Beginn der Coronakrise sei die Nachfrage in seinem Geschäft plötzlich um das Sieben- oder Achtfache angestiegen, sagt der Händler. Gleichzeitig hätten die Raffinerien im Tessin ihre Türen schliessen müssen. «Das war der perfekte Sturm.» Seine KundInnen hätten in der Zeit sein ganzes Sortiment leer gekauft, ganz egal, in welcher Form. Einfach alles, was im Laden vorrätig gewesen sei. «Viele haben nicht einmal nach dem Preis gefragt.»
Er habe zwei Wochen lang jeden Tag vierzehn, fünfzehn Stunden gearbeitet. Der Goldpreis hält sich seit dem coronabedingten Aktiencrash stabil auf einem Langzeithoch. Nach Ostern kletterte er auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Keine überraschende Entwicklung. Was für den Passhandel gilt, gilt auch für den Goldhandel: je unsicherer die Welt, desto sicherer das Geschäft. «Ob damals, als die Flugzeuge in die Türme flogen», sagt der Mann am Telefon, «oder beim Crash von Lehman Brothers: In diesen Momenten werden die Leute nervös.»
Der Goldhändler ist die Antithese zur Schweizer Weissgeldstrategie, mit der sich das Land in den letzten Jahren langsam von seinem Image als sicherem Schwarzgeldhafen zu distanzieren versuchte. Seine besten Geschäfte macht der Zürcher nicht mit den KundInnen, die ein paar hundert Franken in Goldvreneli investieren, sondern mit Superreichen, die Millionen in Gold oder Edelmetall anlegen und dieses im Zollfreilager in Kloten oder Embrach einlagern. Hier wird der sonst redselige Mann plötzlich wortkarg. Das Zollfreilager habe zu Unrecht ein schlechtes Image, sagt er nur. Dabei werden alle, die viel Geld in Gold anlegen, von Unternehmen wie seinem auf Herz und Nieren geprüft. Den AnlegerInnen gehe es nicht um Geldwäsche, sondern um das nach wie vor grosse Vertrauen in die Schweizer Stabilität.
«Unser Ansehen hat zwar hier und da ein paar Kratzer abbekommen, aber gerade in der Krise zeigt sich, dass die Schweiz nach wie vor als besonders vertrauenswürdig wahrgenommen wird.» Seine Kundschaft bestehe etwa je zur Hälfte aus SchweizerInnen und ausländischen KundInnen, sagt der Händler. Während man innerhalb der Schweiz das Gold nach Hause liefere, lagere man Bestellungen aus dem Ausland eben ein. Entweder in den Depots des Zollfreilagers oder in den eigenen Tresoren. «Zumindest so lange, bis die Grenzen wieder öffnen.»
«Home Force One»
Mit Luna Jets ist auch die grösste europäische Privatjetfirma in der Schweiz beheimatet, genauer in Genf. Ansprechperson «Eymeric» sagt, man sei zu Beginn der Coronakrise extrem ausgelastet gewesen damit, KlientInnen schnell und komfortabel in ihre Heimatländer zu fliegen. Inzwischen seien aber die meisten dort im Lockdown. Es gebe also nicht mehr viel zu berichten.
Ein anderer Schweizer Privatjetunternehmer hat in der Krise seine wohltätige Ader entdeckt. Luca Forcignano, der Gründer des Kleinunternehmens Sky & Me, das nur aus einer Cessna 414 besteht, ist beim Anruf schwer beschäftigt. Er muss gerade einen Flug organisieren. «Rufen Sie in einer halben Stunde wieder an.» Je nach Distanz kostet die Buchung der Cessna, mit der Forcignano sonst nur die Vermögendsten herumfliegt, derzeit zwischen 2500 und 6000 Franken. Er fliege täglich, sagt er später. «Zum Selbstkostenpreis.»
Forcignano hat seine Mission «Home Force One» getauft, wie in einem kitschigen US-amerikanischen Kriegsepos. Der Bieler holt mit seiner Maschine SchweizerInnen nach Hause, die irgendwo in Europa gestrandet sind. Heute habe er Heimflüge aus der Türkei, Italien und Spanien organisiert, sagt er. Die meisten seiner KundInnen hätten zu Beginn des Lockdown noch auf dessen baldiges Ende gehofft und seien geblieben, wo sie waren. Nun müssten sie aber dringend in die Schweiz zurück. Im Privatjet geht das nicht nur komfortabler, das Corona-Ansteckungsrisiko ist auch kleiner, weil man weder im Flugzeug noch in den privaten Terminals vielen anderen Menschen begegnen muss.
Forcignano sammelt in seinem Umfeld Geld, das er anteilsmässig an die KundInnen zurückverteilen will. Das Ziel seien tausend Franken pro Person, sagt er. Und weil oft auch noch die Reiseversicherung einen Anteil übernehme, blieben den KundInnen am Ende vielleicht noch durchschnittlich 2000 Franken zu bezahlen. «Das kann sich in der Schweiz im Notfall jeder leisten.»
Forcignano hat mit seiner Aussage recht. Sie erinnert einen daran, dass sich die Schweizer Privilegiertheit nicht nur unter Reichen manifestiert – sondern auch dort, wo keine künstlichen Kohlen in falschen Cheminées glühen.
