«Candy Haus»: Die Tränen des Glücks sind unzählbar
In ihrem virtuosen neuen Roman spürt Jennifer Egan den Verheissungen von Big Data nach – und weckt selbst dort Sympathie, wo wir nie damit rechnen würden.
Alte Bildungsbürgerweisheit: Lesen fördert Empathie. Sicher nicht falsch, aber halt banal, zumal der Gemeinplatz vor allem bemüht wird, wenn es darum geht, Literatur als pädagogisch wertvolle moralische Anstalt zu adeln. Doch interessant und potenziell beunruhigend wird es dann, wenn wir beim Lesen Mitgefühl für Figuren entwickeln, mit denen wir uns kaum identifizieren können. Die müssten nicht einmal menschlich sein: Mitgefühl für einen Regenwurm zum Beispiel oder fürs bedrohte Klima.
So weit geht Jennifer Egan zwar nicht in ihrem Roman «Candy Haus», aber ihre Experimente in Empathie sind auch so virtuos genug. Exemplarisch in Kapitel vier: Da lässt sie einen Ich-Erzähler die Arbeitskollegin beschreiben, auf die er ein Auge geworfen hat. Creepy, denn er rechnet gleich mal ihre Eigenschaften vor, angefangen bei der Zahl der Sommersprossen auf ihrer Nase (4 grosse, etwa 24 kleinere). Dann etwas Statistik: «Sie hat kräftigere Haare als 40 und längere als 57 Prozent meiner Kolleginnen, sie benutzt 24 Prozent der Zeit ein Haarband, 28 Prozent der Zeit Klammern, und 48 Prozent der Zeit trägt sie die Haare offen.» Wer spricht hier? So exakt, wie er das Äussere einer Frau quantifiziert, muss das ein Cyborg sein oder sonst eine künstliche Intelligenz.
Macht nichts, dass man im Roman auch mal den Überblick verliert.
Aber nein, es ist ein Mensch. Der junge Mann heisst Lincoln, und wer Jennifer Egans Episodenroman «Der grössere Teil der Welt» (2012) gelesen hat, ist ihm dort schon begegnet, in einem Kapitel, das wie eine Powerpoint-Präsentation gestaltet war. Damals war Lincoln noch ein Bub mit zwanghaftem Flair für die Länge von Pausen in Popsongs. Jetzt, in «Candy Haus», ist aus dem autistischen Kind ein ausgewachsener Nerd geworden. Seine kindliche Fixierung, damals noch «soziales Gift», wie er sagt, hat er jetzt zum Beruf gemacht, als Metrikexperte bei einem Techkonzern namens Mandala. Lincoln ist die Karikatur eines Datennerds, ein Mann, für den jede Empfindung nur insoweit real ist, als er sie bis ins Kleinste quantifizieren kann – so, wie er das auch mit den Chancen tut, die er sich bei seiner Kollegin ausrechnet.
Im richtigen Leben würde man mit diesem Rechner auf zwei Beinen keine zwei Minuten aushalten. Aber in der Figurenrede der Fiktion gelingt Egan auf gut dreissig Seiten das scheinbar Unmögliche. Denn so befremdlich es ist, die Welt durch Lincolns Datenraster zu sehen: Er, der einem zuerst wie ein sprechender Roboter vorkommt und auch zur elenden Witzfigur geraten könnte, wächst einem ans Herz – auch wenn seine pedantische Sprache eigentlich alles tut, um genau das zu verhindern. Am Ende des Kapitels fliessen gar Tränen des Glücks. Zwar nicht bei Lincoln selber, doch selbst wenn er extra noch erklärt, wieso er diese Tränen nicht zählen konnte: Das scheint ihn nicht mehr zu beunruhigen. Katharsis, irgendwie.
Das Muster wiederholt sich
Jennifer Egan knüpft also beim Personal und bei der schwindelerregenden Konstruktion von «Der grössere Teil der Welt» an. Abermals springt sie mit jedem Kapitel zu einer anderen Figur und in eine andere Zeit, diesmal auf einer Achse zwischen 1965 und 2032. Dass man sich in «Candy Haus» immer wieder neu orientieren muss und zwischendurch auch mal den Überblick verliert: Macht nichts, denn wie die datenanalytische Liebesgeschichte mit Lincoln funktionieren alle Kapitel als in sich abgeschlossene Erzählungen. Weil die Figuren alle irgendwie verwoben sind, ergibt das letztlich doch mehr als die Summe der einzelnen Teile: das Kaleidoskop eines Romans aus Kurzgeschichten. Und wo der Vorläufer lose den Kurven der Musikindustrie entlang führte, steht jetzt vieles im Zeichen von Big Data.
Verbindendes Motiv im Hintergrund ist «Besitze dein Unterbewusstes», ein Tool, das den Leuten erlaubt, ihre Erinnerungen nochmals zu durchleben und mit anderen zu teilen – oder an den Erinnerungen der anderen teilzuhaben. Das erinnert an Kathryn Bigelows Film «Strange Days» (1995), wo Erfahrungen auf Minidiscs wie Drogen auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden. Nur dass die Technologie in «Candy Haus» jetzt eben legal ist und so allgegenwärtig wie heute Facebook oder Instagram.
Erfunden hat sie Bix Bouton, in «Der grössere Teil der Welt» noch eine Randfigur bei einem Drogentrip, der mit einem tödlichen Unfall endete. Seither ist er zum schwerreichen Techguru aufgestiegen, als afroamerikanische Kreuzung aus Mark Zuckerberg und Steve Jobs (mit Letzterem war Egan als Studentin ein Jahr lang liiert). Als Gründer von Mandala hat sich Bouton einst bei den Studien einer Anthropologin bedient, jetzt will er (ähnlich wie Egan mit ihrem Roman) sein Muster wiederholen – und entwickelt dann eben «Besitze dein Unterbewusstes». Wie Forschung von Datenkonzernen gekapert und monetarisiert wird, das ist ein Motiv, das diesen Roman durchzieht. Ein anderes sind die Schattenwelten derer, die ihre Daten nicht preisgeben wollen.
Revierkampf in Suburbia
Aber auch die Literatur, das Erzählen selbst, ist vor dem Zugriff durch die Datenanalyse nicht gefeit. Siehe Chris, der sein eigenes Leben nur noch als Ansammlung von Klischeeformeln sieht, seit er in seinem Techjob die Bestandteile von Geschichten in algebraische Formeln zerlegen muss. Wozu eigentlich? Das kann er selber nicht genau sagen. Die Firma spekuliert wohl darauf, dass sich daraus ein Algorithmus zur effizienteren Storyproduktion bauen lässt.
Jennifer Egan denkt also nicht bloss unseren digitalen Alltag um ein, zwei Drehungen weiter – sie reflektiert auch, was das Primat der Daten für ihre eigene Gilde bedeuten könnte. Doch so schlau dieses «Candy Haus» konstruiert ist, so avanciert und zeitgeistig: Hinter dem komplexen Bauplan ist das auch ein altmodisches Buch, dessen zutiefst humanistisches Interesse am Reichtum menschlicher Charaktere sich noch in den kleinsten Nebenfiguren zeigt. Umwerfend etwa die Vignette mit Chris’ Grossmutter, einer alten Latina, die mittendrin ihren kurzen Auftritt hat. Dank Bitcoin-Investment spät noch reich geworden, hat sie sich einen echten Mondrian gekauft, der jetzt unversichert bei ihr zu Hause hängt. Aber wozu denn alle diese billigen Merchandisingartikel im Mondrian-Look, mit Vasen, Dekokissen, Kerzenständern? Perfekte Tarnung, um Diebe zu täuschen, so die Oma: «Wer einen echten Mondrian besitzt, würde sich nie diesen Schund kaufen.»
Oft bedient Egan unsere Vorurteile, um sie dann unversehens ins Leere laufen zu lassen, weil sie noch jeder scheinbar verächtlich skizzierten Figur eine Form von Gnade zuteilwerden lässt. Etwa dort, wo sie messerscharf die sozialen Revierkämpfe in Suburbia zeichnet – erst aus der Perspektive eines pubertierenden Mädchens und später nochmals ganz anders mit den Augen ihrer grossen Schwester. Weniger gut funktioniert der Roman dort, wo Egan stilistisch mehr wagt. So geht das Kapitel aus dem Jahr 2032 auf ihre Erzählung «Black Box» zurück, die sie einst in Form von Tweets publizierte – für sich genommen ein interessanter Versuch, der aber im Rahmen von «Candy Haus» so gar nicht einleuchtet.
Ganz zum Schluss wirds dann so grundsätzlich, was Literatur und Algorithmen angeht, dass man fast die Autorin selber sprechen hört: Wer alles wisse, wisse gar nichts, denn ohne Geschichten sei alles bloss Information. Auch das ein erzähltheoretischer Gemeinplatz – aber einer, der die Verheissungen von Big Data relativiert. Wer, so scheint Jennifer Egan zu fragen, braucht denn Tools wie «Besitze dein Unterbewusstes», um in grenzenloser Freiheit das ganze Spektrum menschlicher Erfahrungen zu erkunden? Genau das können wir in der Literatur ja seit jeher.
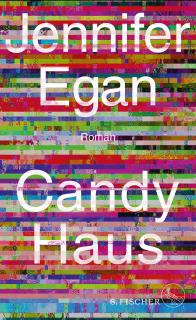
Jennifer Egan: «Candy Haus». Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Henning Ahrens. S. Fischer Verlag. Berlin 2022. 416 Seiten. 37 Franken.


