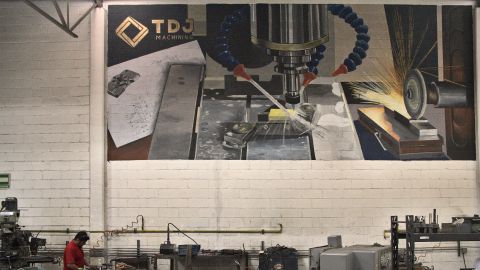Migration in die USA : Gestrandet in Ciudad Juárez
Es wollen so viele Menschen über die mexikanische Grenze in die USA wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Während die Rechte dies politisch ausschlachtet, versuchen die Geschwisterstädte El Paso und Juárez jedoch weiterhin zusammenzuhalten.

Der 3. August 2019 sollte für die texanische Stadt El Paso zu einem Wendepunkt werden. Neun Stunden lang war ein junger Mann vom Haus seiner Eltern im Nordosten des Bundesstaats mit seinem Auto in die Grenzstadt gefahren. Mit dabei hatte er eine halb automatische Waffe wie auch ein festes Ziel: An diesem Samstag, nur wenige Tage nach seinem 21. Geburtstag, wollte er so viele Latinos wie möglich ermorden.
Um 10.39 Uhr Ortszeit zog der Mann in einem Walmart-Supermarkt etwas ausserhalb der Stadt den Abzug. Er tötete 23 Menschen. Nach dem Anschlag sprach das ganze Land über El Paso. Die Bewohner:innen fanden unter einem neuen Slogan zusammen: «El Paso Strong» – El Paso ist stark.
Mehr als achtzig Prozent der Bevölkerung identifizieren sich in Befragungen als «Hispanic». Die mexikanische Stadt auf der anderen Seite des Rio Grande, Ciudad Juárez, bezeichnen sie als Schwester. Und wie es mit Geschwistern so ist: Mal hasst man sich, mal liebt man sich.
Als Juárez in den neunziger Jahren, unter anderem nach einer mysteriösen Mordserie an Frauen, international als gefährlichste Stadt der Welt bekannt wurde, wusste man hier: Das ist eine Phase, und Phasen gehen irgendwann vorüber. Die Kinder aus Juárez besuchten noch immer die Schulen in El Paso und El Pasos Familien noch immer die Restaurants in Juárez. Redet man in El Paso über das Massaker, spricht fast die ganze Stadt mit einer Stimme: Der fremde Rechtsterrorist sei hierhergekommen, um ihre Gemeinschaft zu entzweien. Doch El Paso sei stark.
Die gefährlichste Stadt der USA?
Der Attentäter, der die tödlichste Attacke gegen Latinos in der jüngeren US-Geschichte zu verantworten hat, ist nicht der Einzige, der die Schwestern zu entzweien suchte. Wenige Monate vor ihm war ein damals 72-jähriger Mann aus Washington D. C. in den Südwesten von Texas geflogen und hatte in einer mit Menschen gefüllten Rodeoarena ein Banner mit der Aufschrift «Finish the Wall» aufhängen lassen: Donald Trump.
Der damalige US-Präsident hatte El Paso immer wieder als eine der gefährlichsten Städte des Landes bezeichnet – und die Mauer an der Grenze als einziges Mittel dagegen. Widerspruch erhielt er nicht nur von Demokrat:innen, sondern auch von El Pasos damaligem republikanischem Bürgermeister Dee Margo. «Wir sind eine globale Metropole, in der sich die Traditionen und die Kulturen der USA und Mexikos nahtlos vermischen», sagte er. «Unser Gemeinschaftsgefühl ist stark.» Rückhalt erhält Margo auch von den Statistiken: Die angeblich gefährlichste Stadt des Landes ist seit Jahren auf der Liste der sichersten Grossstädte der USA.
Trotz Geschwisterliebe ist die Unterstützung für Trump jedoch zwischen den Wahlen von 2016 und jenen von 2020 von 27 auf 32 Prozent gestiegen; und bei den Kongresswahlen im November könnte die republikanische Kandidatin Irene Armendariz Jackson der amtierenden demokratischen Kongressabgeordneten El Pasos ein paar Stimmen abnehmen. Landesweit glauben fast sieben von zehn Personen, die sich selbst als Republikaner:innen einordnen, dass die Demokrat:innen weisse, konservative US-Bürger:innen durch Migrant:innen ersetzen wollen. Diese rechte Verschwörungstheorie vom grossen Austausch grassiert auch in El Paso.
Die Rechte spricht nicht von lateinamerikanischen Migrant:innen, sondern von einer «Invasion» – von «Kriminellen» und der angeblichen Notwendigkeit zur Gegenwehr. Der Rechtsterrorist, der in der Walmart-Filiale mordete, griff deswegen zur Waffe. Donald Trump baute seine Mauer aus, womit er den Weg in die USA noch tödlicher machte.
Hoffnung als Antrieb
In einem Punkt haben die Gegner:innen der Migration recht: Aktuell wollen so viele Menschen die Grenze in die USA überqueren wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Pandemie hat die Wirtschaft hart getroffen. Die USA werden für noch mehr verlorene Menschen in Lateinamerika zu einer Insel der Hoffnung.
So etwa für Magloire Labady, der in Juárez darauf wartet, nach El Paso und von dort weiter nach New York zu gelangen. Der 43-Jährige hat 2014 seine Heimat Haiti verlassen. «Ich hatte jeden Tag Angst um mein Leben», sagt der gelernte Lehrer. «Menschen werden dort grundlos getötet – im Bus, auf der Strasse.» Inzwischen soll es in Haiti mehr Mitglieder von Gangs als Soldat:innen geben. Es ist das lateinamerikanische Land mit der grössten Ungleichheit. Der Inselstaat wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht, die teilweise mit der Klimakrise zusammenhängen: 2010 starben 230 000 Menschen bei einem Erdbeben, 2012 und 2016 gab es zwei Hurrikane, 2018 folgte eine Dürre. «Das Schwierigste ist die Instabilität», sagt Labady. «Entweder wirst du kriminell – oder du leidest.»

Zuerst wollte er sich wie viele seiner Landsleute in Brasilien ein neues Leben aufbauen. Er studierte Linguistik, fand jedoch trotz Abschluss inmitten der Pandemie keine Anstellung. Labady verlor sein Einkommen und damit auch die Perspektiven. Von Brasilien zog es ihn nach Kolumbien und durch den von Paramilitärs regierten Dschungel des Darién Gap nach Zentralamerika – immer weiter Richtung Norden, bis hierher nach Juárez. «Ich möchte ein ruhigeres Leben», sagt er. Er will Asyl für die USA beantragen, wo Freunde von ihm leben. Wie seine Chancen stehen, weiss er nicht. «Diese Information kann mir niemand geben.»
Die jüngsten Ereignisse lassen für Labady jedoch nichts Gutes erahnen: Seit September vor einem Jahr hat die Regierung von Joe Biden mehr als 25 000 Haitianer:innen in ihre zerstörte Heimat zurückgeschafft. Die Bilder von berittener Grenzpolizei, die Jagd auf haitianische Migrant:innen machte, gingen um die ganze Welt.
Doch Labady steht nicht nur eine Mauer aus Stahl im Weg, sondern auch eine unsichtbare Mauer aus Gesetzen und Verordnungen. Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, führte der damalige Präsident Trump die Covid-Verordnung Title 42 ein. Diese erlaubt es den Grenzbehörden, Menschen mit Verweis auf den Gesundheitsschutz der US-Bevölkerung die Einreise ohne Verfahren zu verweigern.
Title 42 bleibt auch unter dem Demokraten Joe Biden in Kraft – der Versuch, die Verordnung abzuschaffen, wurde von einem Richter aus Louisiana gestoppt. Inzwischen wurden 1,8 Millionen Menschen aufgrund dieser Verordnung an der Grenze zurückgewiesen. Bis vor kurzem wandte Bidens Regierung auch Trumps «Remain in Mexico»-Programm an, das vorsieht, dass Migrant:innen in Mexiko auf ihren Asylentscheid warten müssen – das Gesetz wurde erst im Sommer von einem Gericht gekippt. Nach Trump geht bisher auch unter Biden das weiter, was 1994 der demokratische US-Präsident Bill Clinton mit der «Operation Gatekeeper» begonnen hatte: der Kampf gegen die Migration.
Migrant:innen leben in Parks
Egal, was Washington entscheidet: El Paso und Ciudad Juárez bleiben durch die drei Brücken über den Rio Grande verbunden. Am südlichen Ende der Brücke Paso del Norte, in einem Hinterhof, in dem voll tätowierte Teenager herumhängen, liegt das Büro von Enrique Valenzuela. Er leitet die staatliche Koordinationsstelle Coespo, die für viele Migrant:innen die erste Anlaufstelle in Juárez ist.
Die Anzahl neu Ankommender habe bereits vor der Pandemie merklich zugenommen, sagt Valenzuela: «Kubaner, Honduraner, Haitianer, Menschen aus Afrika und immer mehr intern vertriebene Mexikaner – wir empfingen manchmal mehrere Hundert Menschen pro Tag.» Die USA gälten noch immer als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wegen des «Remain in Mexico»-Programms hätten viele Menschen hier in Parks gezeltet und unter Brücken gewohnt. «Wir dachten: Was kann noch Schlimmeres passieren?», sagt Valenzuela. Dann folgten die Pandemie und Title 42.
«Früher betrieben wir drei Unterkünfte in Juárez», sagt Valenzuela. «Inzwischen sind es mehr als zwanzig.» Die Unterkünfte seiner Organisation bieten Platz für 3100 Menschen. Insgesamt würden in der Stadt allerdings 10 000 bis 15 000 Migrant:innen leben.
Eine der Unterkünfte liegt an einer Schotterstrasse in einem Armenviertel der Stadt. «Es fühlt sich nicht gut an», sagt Pastor Juan Fierro-García in seinem klimatisierten Büro, «aber wir müssen immer wieder Menschen abweisen, damit unsere Herberge funktionieren kann.» Die Abgewiesenen würden ihr Glück bei einer anderen Herberge versuchen, eine Wohnung mieten – oder sie landeten auf der Strasse. «Dort gibt es Gewalt, Überfälle, Diebstähle», sagt der Pastor.

Seit Bidens Amtsantritt Anfang 2021 hat die Menschenrechtsgruppe Human Rights First mehr als 3000 Übergriffe gegen Migrant:innen in Juárez registriert – die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Hinzu kommt das extreme Klima: Im Sommer steigt die Temperatur tagsüber auf fast vierzig Grad, im Winter fällt sie nachts öfters unter den Gefrierpunkt. «Manche warten drei Jahre in der Stadt», sagt Pastor Fierro-García.
Angesichts dieser Zustände verlassen viele die Stadt wieder in Richtung Heimat oder versuchen ihr Glück an anderen Grenzübergängen. Andere treibt es wiederum in die Hände von Schmuggler:innen. Wie gefährlich dies ist, zeigt eine Tragödie aus dem vergangenen Juni: 53 Menschen starben damals im Laderaum eines Lkws wegen Hitze und Dehydrierung, darunter drei Kinder.
Blühendes Geschäft für Schlepper
Das Leben in Juárez sei hart, sagt ein Schmuggler am Telefon, der anonym bleiben will. «Nenn mich ‹la Rata›», sagt der Mann im Slang der lokalen Drogenkartelle – die Ratte. Er sei bereits seit acht Jahren im Geschäft. Irgendwie müsse man im Leben durchkommen, sagt er. Trotz der engen wirtschaftlichen Beziehungen von Juárez zu den USA leben hier rund 22 Prozent der Bevölkerung in Armut.
Er heuere viele seiner Klient:innen über die sozialen Medien an, sagt der Schlepper. «Ich werde den Migranten von Leuten in Guatemala oder anderen Ländern empfohlen.» Er habe mehrere Angebote im Sortiment: Ein All-inclusive-Paket von Zentralamerika in die USA koste 8000 bis 12 000 US-Dollar. «Von Juárez über die Grenze kostet es etwa 2500», sagt der Schmuggler – und beteuert, dass beim ihm keine Menschen sterben würden. Immer wieder ertrinken jedoch Migrant:innen beim Versuch, über das Kanalsystem des Rio Grande nach El Paso zu gelangen.
«An der Grenze kann sich jede Woche alles ändern», sagt Valenzuela von der Koordinationsstelle für Migrant:innen. Nach der Aufhebung des «Remain in Mexico»-Programms durch ein Gericht zeichnet sich nun im Fall der Covid-Verordnung, die die Biden-Regierung aufheben will, ein monatelanger Rechtsstreit ab. «Viele Leute glauben, dass sich mit der Aufhebung von Title 42 die Grenze öffnen würde», sagt Valenzuela. Für Schmuggler sei das ein gutes Verkaufsargument: Jetzt oder nie.
«Unsere Aufgabe ist es, Migranten klare Informationen zu liefern», sagt er. Doch weder die USA noch Mexiko sagen, wie es nach einer Aufhebung der Covid-Verordnung weitergehen soll. Und so herrscht an der Grenze von Juárez weiterhin das Chaos. Auch in El Paso scheinen die Menschen auf alles vorbereitet. Überall in der Stadt prangen die Worte: «El Paso Strong».