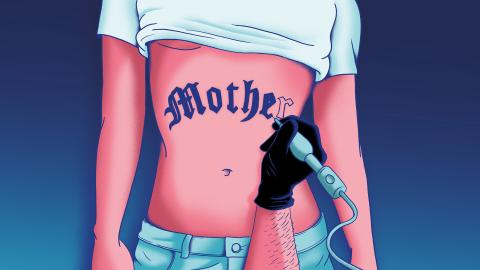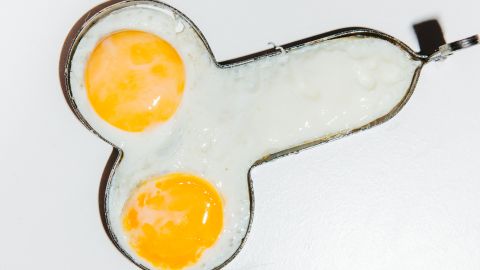David Garcia Nuñez: Grenzgänger im Wilden Westen
Der Gegenwind ist gross, sein Ansporn ist grösser: Mit seiner Abteilung für Geschlechtervarianz am Unispital Basel arbeitet David Garcia Nuñez an einer neuen medizinischen Realität für trans Menschen.

David Garcia Nuñez ist nicht auf Anhieb zu finden. Die nette Frau am Empfang ruft ihre Kollegin an, die ihn erst nach fünfzehn Minuten in den fensterlosen Gängen des Unispitals Basel aufspürt.
Garcia Nuñez, Ende vierzig, entschuldigt sich. Er arbeite in ständig wechselnden Räumlichkeiten, da könne es den Spitalangestellten schon mal schwerfallen, den Überblick zu behalten. Eine Mitarbeiterin wird es später so formulieren: Ihre Abteilung werde ganz schön oft umhergeschoben. Wie in jedem Unternehmen gibt es hier, im grössten Gesundheitszentrum der Nordwestschweiz, eine unterschwellige Hierarchie. Der «Innovations-Focus Geschlechtervarianz», den Garcia Nuñez leitet, steht offenbar nicht zuoberst.
Dabei darf er durchaus als Aushängeschild des Spitals verstanden werden. Sieben «Focusse» gibt es hier, interdisziplinäre Schwerpunkte in Klinik, Forschung und Entwicklung, von denen sich «renommierte Expertinnen und Experten bedeutende Fortschritte für die Zukunft der Medizin versprechen», wie es auf der Website des Spitals heisst. Das Zentrum für Geschlechtervarianz vereint zehn Fächer, Ärzt:innen aus Fachrichtungen von Endokrinologie über Gynäkologie und Urologie bis hin zur plastischen Chirurgie sind vertreten.
Mit stoischer Sachlichkeit
In Fachkreisen hat das Zentrum einen guten Ruf – und Garcia Nuñez gilt als überaus engagiert. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Sexualtherapeut und Lehrbeauftragter an den Unis Basel und Zürich. Derzeit kandidiert er zudem für Zürichs Alternative Liste (AL) für einen Nationalratssitz.
In jeder seiner Funktionen rüttelt er mit stoischer Sachlichkeit an einer gesellschaftlich sakrosankten Binarität: Mann und Frau. Er folge drei Grundprinzipien, sagt Garcia Nuñez: Erstens gehören nicht alle Menschen jenem Geschlecht an, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Zweitens reichen zwei Kategorien nicht immer aus, um zu bestimmen, welchem Geschlecht ein Mensch angehört. Und drittens sind Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung unterschiedliche Konzepte: Trans zu sein, hat nichts damit zu tun, wen man begehrt. Der Begriff «transsexuell» ist somit veraltet.
Die Prinzipien sind schnell erklärt – aber breit akzeptiert sind sie nicht. Davon zeugen Begriffe wie «Genderwahn», die durch die schweizerische Medienlandschaft gejagt werden. Chefredaktoren und rechtsbürgerliche Politikerinnen argumentieren mit einer angeblichen Angst um Kinder, denen falsche Ideen in den Kopf gesetzt würden. Und selbsternannt «genderkritische» Intellektuelle, darunter namhafte Altfeministinnen wie Alice Schwarzer, halten trans Frauen und trans feminine Personen für eine Bedrohung für den Feminismus.
Fragt man nach der Häufigkeit von Anfeindungen, sagt Garcia Nuñez abgeklärt: «Täglich.» Sie kämen in Form von E-Mails, auf Social Media – oder auch draussen in der Öffentlichkeit.
Raus aus dem Tunnel
David Garcia Nuñez kam 1975 im südspanischen La Línea zur Welt. Seine Eltern waren in der PSOE, der Sozialistischen Arbeiterpartei; oft verbrachte er mit ihnen und dem kleinen Bruder die Wochenenden in der Parteizentrale. Oder an unzähligen Demos – Tränengas, wegrennen. «Uns wurde in die Wiege gelegt, dass man sich für Gerechtigkeit einsetzen muss», sagt er.
1986 beschlossen seine Eltern, in die Schweiz zu ziehen, wo sie Stellen als Lehrpersonen in Aussicht hatten. Die Familie landete im Glarnerland, in der Gemeinde Ennenda. Garcia Nuñez war ehrgeizig, in der Schule wehrte er sich gegen jede schlechte Note, fing mit den Lehrpersonen schon wegen einer 5,5 Diskussionen an. Früh stellte er seine Bisexualität fest. Aber er fand keine Worte dafür: Wie sollte er etwas benennen, für das es im Glarus der späten Achtziger kaum ein Vokabular gab?
Dasselbe galt für die Frage, was «Geschlecht» eigentlich sein soll. «Ich habe gemerkt, dass es für mich als Mann Grenzen gibt, die ich nicht überschreiten darf, einfach so, aus Prinzip», sagt er. Hinzu kam die Vermischung zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung: «Du stehst auf Kylie Minogue, bist also ein Mädchen, also musst du schwul sein», erinnert er sich.
Als Garcia Nuñez achtzehn war, beschlossen seine Eltern, nach Spanien zurückzukehren. Er weigerte sich, nahm einen grossen Familienstreit in Kauf. Die Eltern gingen, Garcia Nuñez blieb; die Kantonsschule schloss er dank der Hilfe einer Gastfamilie ab. Danach zog er nach Zürich. Er habe Weite gebraucht, Offenheit.
Um die Eltern zu beschwichtigen, begann er ein Medizinstudium. Ein ordentlicher Beruf für eine ordentliche Zukunft. Aber es fiel ihm schwer, sich zu motivieren: Die Strukturen im Spital und das Selbstverständnis der Ärzt:innen hätten ihn enttäuscht, sagt Garcia Nuñez. «Du bist nicht angehalten, deinen Standpunkt zu reflektieren oder gar zu hinterfragen», sagt er. So habe er angefangen, sich mit seinen Professor:innen anzulegen, besonders wenn es um Geschlecht ging: Wieso kann jedes Mass, jede Krankheit mehrdimensional eingeteilt werden, aber das Geschlecht nicht? Die Antworten befriedigten ihn nicht: So funktioniere eben Biologie, ist halt so, am Geschlecht lasse sich nicht rütteln.
Nach dem dritten Jahr wählte Garcia Nuñez einen gangbaren Ausweg: Er engagierte sich im Verband der Studierenden der Uni Zürich. Das Politische war in sein Leben zurückgekehrt.
Heimatlosigkeit als Privileg
Es sind zwei konträre Sphären, die David Garcia Nuñez in sich vereint: perfektionistischer Arzt und queerer Politiker. Er nennt es eine «Grenzposition», eine Position der Heimatlosigkeit, die er heute, nach langem Ringen, als Privileg erlebt. «Meine Heimat sind nur die zwei Quadratmeter um mich herum», sagt Garcia Nuñez.
Eine Position, die ihn wohl entscheidend für marginalisierten Gruppen sensibilisierte: 2008 landete er als Assistenzarzt bei der damals noch so genannten «Transsexualismus»-Sprechstunde, einer Endokrinologieabteilung. Sie galt als Orchideenfach: aufwendig, nischig, aber auf eine exotisierende Weise unabdingbar. Es waren die Zeiten des «Alltagstests», bei dem Menschen mit «Vermutung auf Transsexualität» bei zwölf Terminen beweisen mussten, dass sie trans sind. Erst dann durften Hormone verschrieben werden. Hinzu kamen die «Tribunale», wie sie von der Community genannt werden: Ärzt:innen aus verschiedenen Fachgebieten sassen mit der betroffenen Person in einem Raum und stellten persönliche Fragen.
Für Menschen, die Namen und Geschlecht in ihren Papieren ändern wollten, bestand zudem eine Pflicht zur kompletten Geschlechtsangleichung – und damit zur Sterilisation. Manche wollten das nicht, wurden informell aber dazu gezwungen. «Was wir diesen Menschen damals angetan haben, war staatlich legitimierte Gewalt», sagt Garcia Nuñez.
Aus anfänglich zwanzig Patient:innen pro Jahr seien unter seiner Leitung fünfzig geworden, dann über hundert, erzählt er. Er hätte mehr Ressourcen gebraucht, die ihm die Spitalleitung aber verwehrte. 2015 wandte er sich deshalb ans Unispital Basel mit dem Vorschlag, dort eine Koordinationsstelle für trans Menschen zu schaffen. Seine einzige Bedingung: Er wollte nicht der Psychiatrie unterstellt sein. Eine bahnbrechende Forderung zu einer Zeit, als «Transsexualität» noch als psychische Störung galt, die einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Begleitung bedurfte.
Er habe null Hoffnung gehabt, dass das gelinge, sagt Garcia Nuñez. Aber er wurde überrascht. «Ich ziehe jetzt in den Wilden Westen», habe er den Kolleg:innen in Zürich gesagt. Gefühlt traf dies auf Basel zu: Die Behandlungsmethoden stammten aus den Neunzigern, Ansätze wie das «Tribunal» führten zu Skepsis und Missgunst seitens der Community, die sich mittlerweile verstärkt organisiert hatte. «Man hat jahrelang gepennt», sagt Garcia Nuñez. Und er wollte alle wachrütteln.
Gegen Goliath
Anfangs habe es sich allerdings eher umgekehrt verhalten: Immer wieder sei er auf Kolleg:innen getroffen, die ihm die Leviten gelesen hätten. Aber seine Arbeit fand Anklang, 2021 konnte er mit dem Aufbau eines neuen Zentrums anfangen. Garcia Nuñez, der dreizehn Jahre zuvor in Basel noch nicht einmal eine Sekretariatsstelle hatte beantragen können, wurde plötzlich zum Aushängeschild des Spitals.
In der Community gilt er als fair und klar, bei Fachstellen mit queeren Anliegen als unabdingbar. Auf Social Media ist sein Ton lauter, direkter, sarkastischer. Kurz gesagt: Er teilt gerne aus.
Dabei wolle er, «und das ist ein bisschen provokant», die Identitätspolitik eigentlich verlassen, sagt er. Was Garcia Nuñez damit meint: Trans Menschen sollen endlich als Menschen behandelt werden – und nicht länger als Subjekte mit gestörter Geschlechtsidentität. Ganz im Sinn der Weltgesundheitsorganisation WHO, die trans Geschlechtlichkeit seit Anfang Jahr nicht mehr als psychische Erkrankung klassifiziert.
Das Transgender Network Switzerland geht von 0,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung aus, also rund 40 000 bis 240 000 Menschen in der Schweiz, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Ihre gesellschaftliche Realität hat derzeit düstere Seiten: Auch hierzulande häufen sich Gewalttaten gegen trans Menschen. Krankenkassen verweigern die Kostenübernahme bei Geschlechtsanpassungen, meinungsprägende Medien berichten von einem «Hype» und «sozialer Ansteckung». Bürgerliche Politiker:innen übernehmen die Rhetorik der extremen Rechten in den USA und reden von einer «gefährlichen linken Ideologie». Hätte er sich mit seinen Kolleg:innen im heutigen Klima für den Focus am Unispital Basel beworben, sagt Garcia Nuñez, hätte er wohl nie und nimmer die Zusage bekommen.
Immer wieder erhalte er aufgrund seiner Arbeit Todesdrohungen, werde beschimpft und abgewertet. Ein queerer David gegen den Goliath Mehrheitsgesellschaft. Und trotzdem macht er weiter. «Ich habe diese Position gewählt», sagt er. «Und ich bin nicht bereit, sie aufzugeben.»