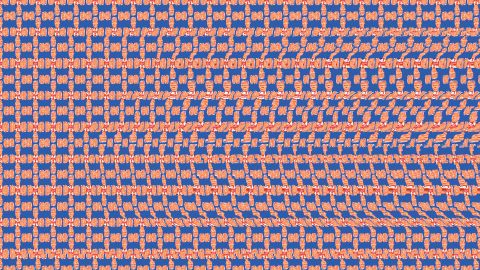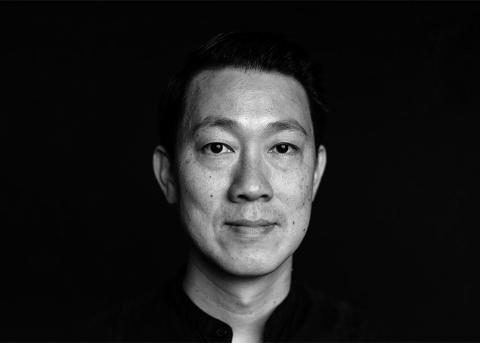Denkansätze: Wie den Kampf um die Wirklichkeit gewinnen?
Theoretisch gibt es durchaus Hoffnung für unsere trostarme Gegenwart. Ein Parcours mit drei Denkerinnen, die helfen, Strategien von Verdrängung, Verleugnung und Verkehrung zu durchschauen.

Verbrennungslust. Foto: Getty
Der US-Bundesstaat Texas ist seit Jahrzehnten ein Pionier bei der Energiegewinnung durch Windkraft. Ausgerechnet Texas, nicht erst seit der TV-Saga «Dallas» und der Präsidentschaft von Vater und Sohn Bush in allen Köpfen verewigt als reicher Ölstaat, wo barrelweise «schwarzes Gold» gefördert wird, garniert mit ein paar Cowboys, die neben den Ölfeldern CO₂-intensive Rinder züchten. Eine erfreuliche Entwicklung, möchte man meinen, wenn unsere Vorstellungen (komplett auf fossile Energie fixiert) und die Realität (ein Viertel des Stroms in Texas stammt heute aus Windkraftwerken) für einmal in einem ganz hoffnungsfrohen Sinn nicht übereinstimmen.
«Leider nicht so einfach», würde wohl die US-Politikwissenschaftlerin Cara New Daggett dazu sagen. Denn alte Bilder im Kopf hätten die Tendenz, neue Realitäten zu überwältigen. Und die jüngste Entwicklung gibt ihr leider recht: Windenergie wird heute in Texas zurückgedrängt, republikanische Politiker setzen wieder verstärkt auf fossile Energieträger, weil die nachhaltige Energie aus Sonne und Wind «nicht krisensicher» sei. In Daggetts schmalem Bändchen mit dem griffigen Titel «Petromaskulinität» wird der Fall Texas nur kurz gestreift. Eigentlich geht es Daggett um eine grössere Frage: Was ist der Zusammenhang zwischen autoritären Regierungen, ihrer Feier einer vorgestrigen Männlichkeit und ihrer Weigerung, die Klimakatastrophe ernst zu nehmen?
Daggetts Befund ist klar: «Klimafaschismus» und reaktionäre Männlichkeitsideale stehen Schulter an Schulter, befeuern sich gegenseitig – und sind weltweit auf dem Vormarsch, auch wenn einige ihrer Hauptakteure wie Donald Trump und Jair Bolsonaro (vorläufig) abgewählt sind. Petromaskulinität als Ausdruck rechter antifeministischer, umweltzerstörender Politik ist eine Strategie der doppelten Realitätsverweigerung: Sie verspricht ihren Anhänger:innen, dass sie sich nicht länger mit den lästigen Forderungen von Frauen wie auch von Klimaschützer:innen herumschlagen müssen. Virile Verbrennungslust flüchtet sich in fette Autos und Dieselschwaden – aber auch in autoritäre Strukturen; begleitet von Frauenhass als tyrannischer Kontrollpraxis. Oder auf die jüngste Schweizer Geschichte gemünzt: Der Kampf gegen CO₂-Gesetz und Dragqueenlesungen hat denselben Antrieb; man will sich absichern gegen Ohnmachtsgefühle und einen als existenziell empfundenen Kontrollverlust.
Subversion von oben
Die Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse der Klimaforschung ist für Daggett kein Verständnis- oder Vermittlungsproblem. Sie ist die Folge eines zerstörerischen Begehrens, einer reaktionären Lust, sich möglichst rücksichts- und gedankenlos weiter zu amüsieren. Es geht um Affekte, nicht um Verstand. Auch deshalb scheinen «Petronostalgie», die sich nach den fünfziger Jahren zurücksehnt, und die fossilen Fantasien der Gegenwart wirkmächtiger zu sein als die überall bereits spürbaren Klimaveränderungen.
Die Zürcher Kulturwissenschaftlerin Sylvia Sasse würde womöglich ergänzen: Petromaskuline Tendenzen sind auch deshalb so stark, weil Demagog:innen es schaffen, die Realität der Klimakatastrophe rhetorisch einfach auf den Kopf zu stellen. Wenn die Wissenschaft auf die Fakten der Erderwärmung hinweist und auf ihre absehbaren fatalen Folgen, dann sagt die rechte Propaganda: Ist doch schön, wenn es bei uns ein bisschen wärmer wird. Die Linken und die Grünen wollen dir bloss dein Auto wegnehmen – oder dich zwingen, eine teure neue Heizung einzubauen.
Dass Propaganda lügt, ist nichts Neues. Mit «Verkehrungen ins Gegenteil» hat Sasse ein scharfsinniges Buch über eine spezielle Form von propagandistischen Lügen geschrieben: Die Subversion von oben gaukelt denen «da unten» nicht bloss etwas vor, sondern gibt ihnen zugleich implizit zu verstehen, dass auch sie selber die Wahrheit nach Belieben verdrehen dürfen; dass man gemeinsam «die Wahrheit als Witz verlachen» kann. Knapper lässt sich eine Trump-Rally kaum beschreiben.
Diese Realitätsshow operiert mit unterschiedlichen Verkehrungen und Projektionen. Die Slawistin Sasse behandelt zahlreiche Beispiele sowjetischer und russischer Propaganda. Etwa Wladimir Putins Behauptung, der Westen verfolge Russland «mit bestialischem Hass»: eine direkte Umkehrung und Projektion der Tatsache, dass vor allem Putins eigene Strategie auf Hass gegen ein von ihm konstruiertes Zerrbild des Westens baut. Er projiziert die eigene Aggression auf den Westen – und tarnt sie zusätzlich mit dem Label «antifaschistisch».
Solche Umwertungen und Aneignungen von Begriffen der politischen Gegenseite sind eine weitere Strategie, die Sasse analysiert. Wenn Faschist:innen sich als Antifaschist:innen ausgeben oder Rechte Feminismus als «Sexismus gegen Männer» beschimpfen, eignen sie sich ein progressives Vokabular an. So wie in der Vergangenheit bereits kritische Begriffe aus einem innerlinken Diskurs wie «Gutmensch» und «Political Correctness» zu rechten Kampfbegriffen umgeschmiedet wurden.
Sasse zeigt auch, wie Rassismus und Antisemitismus ihren «Feind» überhaupt erst hervorbringen. Juden und Jüdinnen werden zur Projektionsfläche der eigenen negativen Wünsche, der eigenen verdrängten Verbrechen. Diese «falschen Projektionen», wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno sie nennen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie nach und nach die ganze Umwelt nach dem eigenen (Schreck-)Bild einfärben – gewissermassen ein umgekehrter Chamäleoneffekt.
Die Realität wird durch einen Zerrspiegel verformt, verschwindet hinter der Nebelwand eines Propagandadiskurses. Man könnte sich bemühen, sie weiterhin zu sehen, schaut aber lieber in die andere Richtung, wird zum Wegschauen auch animiert. Das ist der Plot der Filmsatire «Don’t Look Up», auf die Sasse verweist. Ein vernichtender Komet rast gut sichtbar auf die Erde zu, das Einschlagdatum ist genau berechnet worden. Doch die Menschheit lässt sich dazu verführen, einfach nicht mehr in den Himmel zu schauen. Oder gutgläubig auf aberwitzige Rettungsmissionen zu hoffen, die schon deshalb scheitern, weil sie voraussetzen, dass auch der drohende Weltuntergang noch Profit abwerfen muss.
Ideale Kulisse fürs Nichtstun
In dieser schizophrenen Logik sieht die slowenische Philosophin Alenka Zupančič eine Hauptpointe von «Don’t Look Up». Die im Film zu lesende Schlagzeile «Bald wird ein tödlicher Komet einschlagen. Wird der Superbowl dieses Jahr stattfinden können?» vermittelt die absurde Vorstellung, dass wir den Weltuntergang als Zuschauer:innen miterleben könnten – dass wir sogar das Ende des Planeten irgendwie überstehen könnten, zusammen mit dem ebenso untoten Kapitalismus.
Wir leben in einer Zeitenwende, wird gern behauptet. Wie Zupančič maliziös bemerkt, zeichnet sich diese aber vor allem dadurch aus, dass niemand bereit ist, wirklich etwas zu wenden oder zu verändern. Ausgerechnet das drohende Ende der Welt erweist sich als ideale Kulisse fürs Nichtstun. «Die Apokalypse enttäuscht noch immer» nennt Zupančič denn auch ihren kurzen brillanten Text, in Anlehnung an Maurice Blanchots Essay von 1964 zur Bedrohung durch einen Atomkrieg.
Die Apokalypse enttäuscht deshalb, weil sie uns nicht die Augen öffnet. Wir sind zwar spätestens mit der Finanzkrise von 2008 erwacht, wachgerüttelt vom definitiven Ende vom behaupteten Ende der Geschichte. Doch haben wir uns entschieden, weiter zu träumen. Techniken der Wahrheitsüberlistung erlauben uns, die Widersprüche zwischen Traumwelt und Realität auszuhalten oder ganz auszuschalten. Sasse nennt diese Techniken mit Verweis auf George Orwell «Doppeldenk», Zupančič verweist auf die Formel «Je sais bien mais quand même» des Psychoanalytikers Octave Mannoni, deren paradoxe Logik sie heute erweitert am Werk sieht: Gerade weil ich etwas sehr wohl weiss, kann ich es weiterhin ignorieren.
Darin liegt auch ihre Antwort auf die Frage, warum wir der Zerstörung von Gesellschaft und Lebensgrundlagen nicht entschiedener entgegenwirken. Oder in Zupančičs Zuspitzung: Weil wir offenbar lieber sterben, als uns zu Tode zu erschrecken. Daggett antwortet soziologisch-psychologisch: weil lustvolle reaktionäre petromaskuline Verdrängungsmuster sehr wirkmächtig sind. Sasse wiederum zeigt, wie Verkehrungen und Umwertungen von Begriffen unsere Wahrnehmung fundamental verwirren. Letztlich beschreiben alle drei die Zurichtung, Überwältigung, Ersetzung der Realität durch Zerr- und Wunschbilder. Diese verfälschen komplexe Differenzen zu simplen Oppositionen und verstellen so den Blick auf die sozialen und ökologischen Versehrungen der Welt.
Das Verkehrte der Macht
Was tun? Sasse schlägt vor, Rückkoppelungen auf die Sprechenden ins Visier zu nehmen. Propagandistische Botschaften verraten nämlich vor allem etwas über ihre Absender: Die Verkehrungen der Mächtigen verweisen direkt zurück auf das Verkehrte der Macht selber. Das stimmt auch auf einer banalen Ebene: Politiker:innen, die gegen vermeintlich kriminelle Minderheiten hetzen, lenken erstaunlich oft von grassierender Kriminalität in den eigenen Reihen ab.
Zupančič wird noch grundsätzlicher. Wenn wir die Welt retten wollen, müssen wir uns zuerst fragen: Welche Welt? Für sie liegt die einzige zukunftsträchtige Option darin, die Welt wieder radikal als Gemeingut zu erschaffen, damit sich ihre Rettung auch wirklich lohnen würde. Denn: «Was können wir schon verlieren, wenn sowieso alles zum Teufel geht?»
Cara New Daggett: «Petromaskulinität». Verlag Matthes & Seitz. Berlin 2023. 72 Seiten. 20 Franken.
Sylvia Sasse: «Verkehrungen ins Gegenteil». Verlag Matthes & Seitz. Berlin 2023. 187 Seiten. 19 Franken.
Alenka Zupančič: «Die Apokalypse enttäuscht noch immer», im Sammelband «Die Apokalypse enttäuscht», herausgegeben von Alexander García Düttmann und Marcus Quent. Diaphanes Verlag. Zürich 2023. 264 Seiten. 39 Franken.