«Weil es Recht ist»: Pflichtlektüre für die Freunde der Verfassung
Marcel Hänggi prüft in seinem neuen Buch die Grundlage des Schweizer Bundesstaats auf ihre Nachhaltigkeit. Sein Fazit: Die Verfassung dient als guter Ausgangspunkt, bedarf aber dringender Revisionen.
Man würde die 256 Seiten Papier zwischendurch gerne weglegen und ein paar Wochen später, wenn das Gelesene verdaut ist, weitermachen. Doch bei «Weil es Recht ist» verhält es sich wie bei einer guten Netflix-Serie: Das Buch geht durch Mark und Bein, Weglegen fällt schwer. Während der Streamingdienst das Publikum mit fiktionalen Geschichten packt, tut es Marcel Hänggi mit Fakten zum Zustand der Erde und «Vorschlägen für eine ökologische Bundesverfassung».
Als preisgekrönter Wissenschaftsjournalist kennt der ehemalige WOZ-Redaktor nicht nur die Statistiken zu den multiplen Krisen unserer Zeit, sondern auch die Konsequenzen für Gletscher, Wälder und Böden. Und wer wie der 55-Jährige an Klimakonferenzen teilgenommen, sich durch Tausende Seiten lange Berichte des Weltklimarats geackert und die Fakten immer wieder in Büchern dokumentiert hat, dem nimmt man Sätze wie diesen durchaus ab: «Klimakrise und Biodiversitätskrise sind keine Probleme, sondern etwas viel Grösseres.»
Die Flughöhe dieses Buches, sie ist hoch. Und das liegt in der Natur der Sache. Denn Hänggi hat die Schweizer Bundesverfassung auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit durchleuchtet. Er hat sich also jenes Büchlein mit seinen 197 Artikeln zur Brust genommen, das seit 176 Jahren – mit Totalrevisionen 1874 und 1999 – die Rechtsgrundlage dieses Nationalstaats bildet. Nur, taugt diese heute noch?
Das Recht auf Widerstand
Lebendig führt der Autor durch eine eigentlich trockene Materie, inklusive kleinerer und grösserer Änderungsvorschläge für die Bundesverfassung, zum Beispiel: «Es gibt ein Widerstandsrecht gegen Versuche, die Demokratie zu beseitigen, sowie gegen Bestrebungen, die natürlichen Lebensgrundlagen schwer zu schädigen.»
Vielleicht hätten sich die Klimaseniorinnen, wenn ein entsprechender Artikel in der Verfassung stehen würde, auf einen solchen berufen. Stattdessen mussten sie sich bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchkämpfen, ehe sie diesen April als Schutzbedürftige des Klimadesasters Anerkennung fanden. Das anschliessende Posaunen bürgerlicher Politiker:innen, wonach das Urteil aus Strassburg «gerichtlicher Aktivismus» sei, übertönte die lautlose Präambel der Schweizer Bundesverfassung, in der es um «Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen» geht und sich «die Stärke des Volkes […] am Wohl der Schwachen» misst.
«Die Unverschämtheit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte», schreibt Hänggi, «bestand nicht darin, der Schweiz etwas befohlen, sondern darin, sie an die eigenen Werte und Regeln erinnert zu haben, die sie missachtet.» Es gebe keinen Konflikt zwischen Demokratie und Rechtsstaat, sondern zwischen konsensualen Werten und Zielen – und einem Handeln, das diesen widerspricht. «Die Reaktionen auf das Urteil machten eine kognitive Dissonanz sichtbar.»
Erstaunliche Röntgenaufnahmen
Noch schwärmen Herr und Frau Schweizer:in von der «besten Demokratie der Welt» – und damit implizit auch von der Verfassung. Doch spätestens seit der Covid-19-Pandemie sind zwischen jenen Menschen, die dieses Land bewohnen, und jenen, die es repräsentieren, Gräben aufgegangen. Die diversen Krisen beginnen sich zu überschneiden. So gesehen besteht das grösste Verdienst von «Weil es Recht ist» möglicherweise darin, die schriftlich festgehaltenen Prinzipien eines Rechtsstaats aus einer anderen Zeit auf die Probe gestellt zu haben. «Was wir haben», steht im ersten Teil des Buches, «Was wir brauchen» in Teil zwei.
Es geht um Systeme und ihre Kipppunkte, um Resilienz und Grenzen – sowie um die Organisation zur Findung und zur späteren Umsetzung von Entscheidungen. Die Bewohner:innen der Schweiz, also auch jene ohne Schweizer Pass, sollen stärker in die demokratischen Prozesse miteinbezogen werden, findet der Autor, etwa durch kantonale Bürger:innenräte. Überhaupt betont Hänggi immer wieder, dass eine Demokratie nur überlebt, wenn sie dynamisch bleibt und sich neuen Umständen anzupassen versteht.
Der Titel des Buches ist Programm. Und die Röntgenaufnahmen der Bundesverfassung fördern Erstaunliches zutage: Die Wichtigkeit des Vorsorgeprinzips, der Vorrang des Ökologischen vor dem Ökonomischen sowie die Suffizienz, das Nachtschattengewächs politischer Diskussionen, sind Teil der Grundlage des Schweizer Rechtsstaats – und lassen Hänggi zu einem überraschenden Schluss kommen: «Die dringend nötige Transformation der Gesellschaft wäre in der geltenden Bundesverfassung angelegt, setzte man deren Bestimmungen wirklich durch.»
Die Wahrnehmung der Welt
Der Satz könnte ebenso gut von Alberto Acosta stammen. Der Ökonom präsidierte jene Kommission, die dazu verhalf, dass Ecuador 2008 als erstes Land die Rechte der Natur in seiner Verfassung verankerte. Die ecuadorianische Verfassung gilt allenthalben als Meilenstein zum Schutz der Natur. Sie ist zugleich Vorbild und Projektionsfläche für das harmonische Miteinander von Mensch und Natur. Und Hänggi gelingt es, die in ihr schlummernde Essenz in sein Buch einzuweben. Dabei geht es um nichts weniger als unsere Sicht auf die Welt – eine Wahrnehmung, in der Natur und Mensch «nicht als Gegensätze zu sehen» sind, «sondern menschliches Handeln als integraler Bestandteil der ökosozialen Lebensgrundlage zu verstehen» ist.
Für Gemeinschaften, die nach wie vor in Kontakt mit der Erde stehen, ist dies freilich eine müssige Diskussion. Bei den Indigenen Ecuadors etwa, die beim Aushandeln der Verfassung mit am Tisch sassen, ist Naturschutz keine Frage des Rechts, sondern zentraler Bestandteil ihrer Lebensweise. Da sie jedoch wissen, dass der Naturschutz im Globalen Norden nur via Gesetze stattfinden kann, willigten sie schliesslich ein, der Natur explizite Rechte einzuräumen.
Heute bewegt sich Ecuador, abgesehen von Ausnahmen, weit weg von verfassungsrechtlichen Theorien. Neben den Drogenbanden, die den Rechtsstaat seit Jahren unterwandern, gefährden riesige Projekte zur Rohstoffausbeutung Flora, Fauna und Menschen. Sie illustrieren eindrücklich, wie wenig eine Verfassung wert ist, wenn sich Entscheidungsträger:innen in der Politik den Zwängen des Kapitals unterwerfen und sich die Mehrheit eines Landes zuerst dem Kampf ums tägliche Brot widmen muss, bevor sie sich um ihre Rechte kümmern kann.
«Weil es Recht ist» verliert sich selten in Details, sorgt für Aha-Momente und Herzrasen – und schafft durch den Anhang von über fünfzig Seiten ein Nachschlagewerk, das nicht nur Studenten und Wissenschaftlerinnen, sondern auch Politikerinnen, NGOs und Journalisten interessieren dürfte.
Im Gegensatz zu Netflix-Serien gibt es übrigens kein Happy End. Marcel Hänggi benennt zuletzt die Feinde des sozioökologischen Umbaus, die sowohl die Verfassung als auch unsere Lebensgrundlage gefährden. «Ohne Kämpfe», schliesst der Wissenschaftler und Aktivist deshalb, «wird es nicht gehen.»
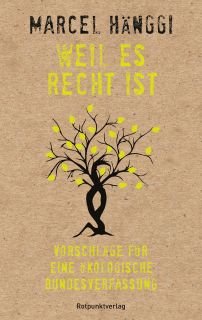
Das Buch ist im WOZ-Shop erhältlich.

