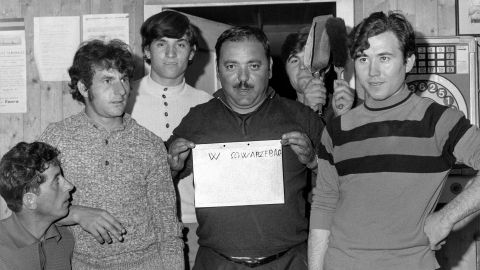Migrationsjahr 2025: Seid nicht hasenfüssig!
Es waren die ersten zwei Radionachrichten in der Silvesternacht, um drei Uhr nach einem kleinen Fest beim Aufräumen gehört: Rumänien und Bulgarien werden mit dem neuen Jahr Vollmitglieder des Schengenraums, die Kontrollen an den EU-Binnengrenzen fallen weg. Und vor der Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein Flüchtlingsboot gesunken, zwanzig Personen werden vermisst, sie haben mutmasslich bei der Überfahrt von Libyen nach Italien ihr Leben verloren.
Auch im Jahr 2025, das machen die Nachrichten klar, werden Migration und Flucht nicht nur ein Thema in der politischen Debatte bleiben. Sie werden sich auch in der Realität weiter ihren Weg bahnen, Biografien und Familien verändern, Ortschaften und ganze Gesellschaften. Die Bewegung von Menschen, zu denen übrigens auch der Tourismus zählt, ist eine der prägendsten Kräfte der Gegenwart. Und das ist begrüssenswert.
Denn es ist ja nicht so, dass sich diese Bewegungen einfach in Luft auflösen lassen, bloss weil die FDP neuerdings Asylsuchende in Ruanda versorgen will oder weil die SVP meint, mit einer Initiative die Einwohner:innenzahl der Schweiz auf zehn Millionen beschränken zu können. Die Menschen werden kommen, solange es hier Arbeit, Wohlstand und Sicherheit gibt. Sie werden durch eine restriktive, rassistisch geprägte Politik – und das ist der entscheidende Punkt – einfach schlechter gestellt sein in ihren individuellen Rechten.
Der Soziologe Steffen Mau definiert moderne Grenzen als Sortiermaschinen, die Personen als Risiko abweisen oder als ökonomisch nützlich passieren lassen. Die Passierenden werden dabei mit mehr oder weniger Rechten ausgestattet: Während die Google-Mitarbeiterin aus Kanada bis aufs Abstimmen und Wählen in der Schweiz wohl nur wenig Ausschluss erleben wird, versetzen die Behörden den vorläufig aufgenommenen Studierenden aus Syrien in einen Zustand gewollter Ohnmacht – ohne Recht auf Reisefreiheit und mit stark eingeschränktem Familienleben.
Auch eine «Schutzklausel», wie sie nun im Vertragsentwurf der «Bilateralen III» mit der EU vorgesehen ist, dürfte diesen Effekt zeitigen. Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbunds, beschrieb in seinem Blog kürzlich, wie die Schweiz in den ersten Jahren der Personenfreizügigkeit schon einmal mit einem ähnlichen Mechanismus ihre Daueraufenthaltsbewilligungen beschränkt hat. Mit dem Ergebnis, dass den Unternehmen einfach mehr Kurzarbeitsbewilligungen erteilt wurden. Die unsicheren Verträge wiederum liessen die Beschäftigten tiefere Löhne akzeptieren. «Schutzklauseln beschränken die Migration nicht, können aber zu mehr Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen führen», so Lamparts Fazit.
Kurzum: All die rechten Migrationsfantasien, die sich um Köpfe und Zahlen, angebliche Wachstumsschmerzen und konsequente Rückschaffungen drehen, schwächen bloss die Rechte der Ankommenden, zum Teil noch über Generationen hinweg. Eine realistische Antwort, die davon ausgeht, dass die Migration nun einmal stattfindet, muss dagegen auf eine Stärkung der Rechte pochen. Dazu gehören ein solider Lohnschutz bei der Personenfreizügigkeit, ein Ende der mutwilligen Prekarisierung im Asylwesen und eine erleichterte Einbürgerung für Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz haben, wie das die Demokratieinitiative der Aktion Vierviertel fordert.
Über Rechte statt über die Zahl der Köpfe reden: Auf diesen einfachen, emanzipativen Grundsatz sollten sich progressive Kräfte besinnen, wenn sie die kommenden Auseinandersetzungen um die SVP-Initiative und ein gestärktes Verhältnis mit der EU gewinnen wollen. Dazu ist Entschiedenheit gegen rechts statt Hasenfüssigkeit gefragt. Und auch etwas Originalität. Es braucht durchaus kreative Vorschläge, wie es denn gestaltet werden könnte, das Zusammenleben in diesem vielfältigen Land mit zehn oder noch mehr Millionen Einwohner:innen: im Verkehr, in der Bildung, beim Wohnen. Denn ohne die Radionachrichten der Zukunft vorwegnehmen zu wollen: Diese Schweiz dürfte stattfinden.