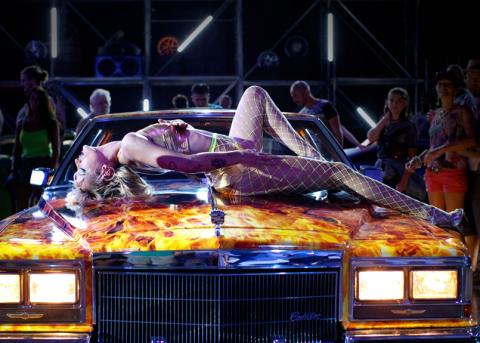Film: Warum man Perlhühner nicht schlachten sollte
Über die Toten nur Gutes? Im neuen Film von Rungano Nyoni führt das zu absurden Verrenkungen in der Familie. Eine Satire, die mit jeder surrealistischen Wendung nur realistischer wirkt.

«On Becoming a Guinea Fowl». Still: Trigon-Film
Eine junge Frau fährt nachts über eine Landstrasse, das Autoradio spielt alten afrikanischen Pop. Die Frau heisst Shula (Susan Chardy), sie trägt Sonnenbrille, einen glitzernd-futuristischen Helm und, wie man sieht, als sie aussteigt und zum Körper ihres Onkels läuft, der scheinbar friedlich auf der Strasse liegt, den gleichen aufblasbaren Anzug wie Missy Elliott 1997 in ihrem Musikvideo zu «The Rain». Ohne wahrnehmbare Gefühlsregung blickt Shula einen Moment lang in Onkel Freds lebloses Gesicht. Dann setzt sie sich wieder ins Auto und ruft ihren Vater an, der ihr erst nicht glaubt, als sie von Freds Tod berichtet, um sie dann nach Geld fürs Taxi zu fragen.
Signale, die nicht zueinanderpassen, die sich überkreuzen oder sich – wie bei Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung – gegenseitig aufheben. Die Folge ist eine Art unsichtbare Blockade, ein Gefühl, das sich nicht äussern oder ausdrücken lässt, ein stummer Schrei, der Lachen und Schmerz vereint. Darauf spielt der neue Film von Rungano Nyoni im Titel an: «On Becoming a Guinea Fowl». Der Schrei des Perlhuhns klingt alles andere als angenehm, wenn es seinesgleichen vor drohender Gefahr warnt, weshalb der Vogel nicht gerade beliebt ist. Trotzdem sei es manchmal unabdingbar, sagt der Film, zum Perlhuhn zu werden.
Alles okay, das Arschloch ist tot
Zu den kulturellen Überzeugungen der Bemba, der grössten Volksgruppe in der afrikanischen Republik Sambia, gehört es, dass jeder Mensch gut zur Welt kommt. Und dass nach dem unvermeidlichen Ableben nur das Gute in Erinnerung behalten werden sollte, während über allfällige moralische Verirrungen zu Lebzeiten gepflegtes Stillschweigen zu bewahren ist. In der Theorie klingt das nett, und es deckt sich auch so weit mit hiesigen Gepflogenheiten: Man sollte also den Gedanken, Nyonis beissende Gesellschaftssatire habe nichts mit der eigenen Kultur zu tun, schleunigst wieder verscheuchen. Über die Toten nur Gutes: Im Fall von Onkel Fred führt das im Verlauf des Films zu solch schmerzhaften Verrenkungen im Körper der Grossfamilie, dass man sich beim Zuschauen bald an Shulas stoischer Fassungslosigkeit zu orientieren beginnt.
Man ahnt, was die Familie und insbesondere deren weibliche Mitglieder seit Jahrzehnten gewusst haben: Onkel Fred war ein Arschloch, und zwar eines der schlimmeren Sorte. Davon zeugen die ausdruckslosen Gesichter jener Frauen, die sich jetzt anhören müssen, welch wunderbarer Mensch Fred gewesen sei; davon zeugen die psychischen Verfassungen Shulas und ihrer dauerbetrunkenen Cousine Nsansa (Elizabeth Chisela); davon zeugt das Video auf dem Handy der jungen Bupe (Esther Singini), in dem diese ihren (gescheiterten) Selbstmord ankündigt. Alles ist okay, sie lächelt vom Krankenbett aus, jetzt ist er ja tot. Und davon zeugen auch die Tanten, so viele Tanten, die den jungen Frauen einbläuen, nichts von all dem zu erwähnen: nicht die jahrelangen Missbräuche, auch nicht, dass sich da, wo Freds Leiche lag, das örtliche Bordell befindet, und nicht, dass eigentlich gar niemand traurig über Freds Ableben ist.
Ob Shula nicht ein wenig trauriger wirken könne und was sie sich eigentlich anmasse, am Tag der Beerdigung ihres Onkels ein Bad zu nehmen. Freds Witwe wiederum muss sich anhören, dass sie am Alkoholismus ihres Mannes die Schuld trage, an seinen Ausschweifungen und nicht zuletzt auch an seinem Tod. Sie habe ihn, heisst es, bevor sie enterbt wird, «nicht glücklich gemacht».
Je fantastischer, desto wirklicher
In ihrem ersten Spielfilm, «I Am Not a Witch» (2017), erzählte Rungano Nyoni von der Verbannung eines jungen Mädchens in ein «Hexencamp». Mit dem Erstling teilt nun «On Becoming a Guinea Fowl» die Eigenschaft, dass auch dieser Film mit jeder surrealen Wendung, mit jeder Annäherung ans Fantastische realistischer wirkt – was wiederum für diese Realität nicht unbedingt als Kompliment durchgeht. Und auch wenn diese Wirklichkeit einerseits – Kostüme, Sprache, Bräuche – extrem spezifisch erscheint, so ist sie zugleich sehr universell: Da sind die Männer, die patriarchalen Strukturen und die von diesen geförderten Missbräuche sowie die Familie als zentrale Institution, die diese Strukturen wider besseres Wissen aufrechterhält.
Nyoni, die als Neunjährige mit ihrer Familie nach Wales ausgewandert ist, widersteht jeder Versuchung, das Geschehen zu exotisieren, und gibt einem westlichen Publikum so auch keine Gelegenheit, sich alles auf Distanz zu halten. Die gedämpften Farben entsprechen dem traurigen Anlass, ebenso die lakonisch-starren Bildkompositionen des kolumbianischen Kameramanns David Gallego. Auch die Kamera scheint den Figuren mit ihren inneren Gefängnissen nicht so recht zu trauen.
Die Regisseurin spricht in Interviews relativ offen darüber, dass sich die absurde Komödie, die sie ursprünglich geplant hatte, nach und nach zum Düsteren hin verschoben habe. Das zeigt sich vielleicht auch darin, dass ihr Film oft irritierende Haken schlägt und in seiner Tonalität nicht besonders einheitlich wirkt. Aber wenn man als Zuschauer:in bis zuletzt nie weiss, ob man jetzt lachen, weinen, einen krächzenden Warnschrei ausstossen oder das Patriarchat niederbrennen soll, dann deshalb, weil sich die Signale in diesem Film nur allzu gut mit der Wirklichkeit decken.
«On Becoming a Guinea Fowl». Regie und Drehbuch: Rungano Nyoni. Sambia / UK / USA / Irland 2024. Jetzt im Kino.