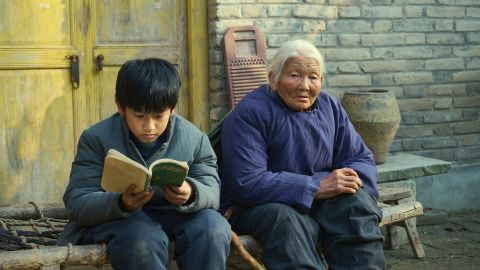Berlinale: Der Beruf ist gut, die Verhältnisse sinds nicht
Nur ins Kino zu gehen, nützt nichts: Die «Woche der Kritik», eine aktivistische Alternative zu den Filmfestspielen in Berlin, stellt sich dieses Jahr der Klassenfrage – wie auch mehrere Filme im Hauptprogramm.

«Los, film sie, film sie!» Wie Schmeissfliegen umschwirrt das Filmteam Obdachlose, Bettler:innen und Strassenkinder auf der Suche nach Bildern von Armut und Elend, um die «Unterentwicklung» Kolumbiens zu dokumentieren. «The Vampires of Poverty», das legendäre Mockumentary von Carlos Mayolo und Luis Ospina (1977), war der historische Beitrag im Filmprogramm «Back to the Class Issue», das die Debatte zum diesjährigen Themenschwerpunkt der «Woche der Kritik» (WdK) eröffnete. Der Film kam gut an, löste aber auch Verwunderung aus: Wenn das Bewusstsein für die mediale Ausbeutung von Armut schon so alt sei, merkte ein junger Zuschauer sinngemäss an, wieso stünden wir dann heute immer noch vor derselben Frage?
Die WdK, gegründet vor elf Jahren als Reaktion auf die als konservativ empfundene Programmpolitik des damaligen Berlinale-Direktors Dieter Kosslick, lud dieses Jahr zur Auseinandersetzung mit Fragen sozialer Ungleichheit in Filmen, Filmkritik und -öffentlichkeit. Auch die eigene Veranstaltung wurde kritisch geprüft: «Wer von Ihnen hat studiert?», fragte Klassismusexpert:in Francis Seeck das Publikum der Eröffnungskonferenz – und fast alle Arme gingen hoch.
Niemand entkommt den Klassenverhältnissen. Egal wie viele Veranstaltungen man zum Thema abhalte und welche Preisnachlässe man auch gewähre: «Kunst und Kultur» blieben «Teil des Problems», ermahnte auf einem anderen Podium Sinthujan Varatharajah, Mitautor:in des kürzlich erschienenen Gesprächsbands «Hierarchien der Solidarität», mit Seitenhieb auf die Gastgeber:innen. Engagierte Filmschaffende, Kritikerinnen und Kuratoren: Alles Blutsauger:innen also? Auf diese lähmende Selbstkritik wollte man sich dann doch nicht einigen.
Visionär verblödet
Als habe sich die neue Berlinale-Leiterin Tricia Tuttle mit der WdK abgesprochen, sind auch in ihrem ersten Programm auffallend viele Filme über soziale Ungleichheit zu entdecken. Besonders prominent und umstritten: Tom Tykwers leicht verrückter Eröffnungsfilm «Das Licht». Darin heuert eine geflüchtete syrische Psychologin (Tala Al-Deen), die eine neuartige, hormonbasierte Lichttherapie entwickelt hat, als Haushälterin bei einer wohlstandsverwahrlosten, hippen deutschen Familie mit linkem Weltverbesserungsanspruch (die Eltern: Lars Eidinger und Nicolette Krebitz) als Haushälterin an, um ihre eigene Familie zu erlösen. Das ist alles extra dick aufgetragen und bewusst klischiert, gerade in dieser grellen Melange aber als Versuch zu verstehen, uns die Augen für den weitreichenden, auch medial bedingten Realitätsverlust zu öffnen, der der von Varatharajah beschriebenen Scheinsolidarität vorausgeht.
Ziemlich verrückt ist auch «Mickey 17», die neuste Class-Revenge-Fantasie des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho. In seinem ersten Film seit dem Oscar-Triumph mit «Parasite» vor fünf Jahren erzählt er die Geschichte eines hochverschuldeten armen Schluckers (Robert Pattinson), der auf der Flucht vor seinem Gläubiger als sogenannter Dispensable beim gigantofaschistischen Weltraumkolonisierungsprojekt Niflheim anheuert, um dort von einem visionär verblödeten Unternehmer (Mark Ruffalo als eine Art Kreuzung von Elon Musk und Donald Trump) maximal ausgebeutet zu werden. Sein Job: jeden Tag einen brutalen Tod zu sterben, worauf der 3-D-Drucker immer wieder eine neue Version von ihm ausspuckt.
Das mündet wie fast immer beim Regisseur von «Snowpiercer» in der Rebellion der Ausgebeuteten gegen die Ausbeutenden. Doch anders als zuletzt bei «Parasite» fühlt sich der Weg dahin diesmal sehr lang an. Der Aufstand ist vorhersehbar, die Allegorie wirkt abgeschmackt. Hängen bleiben nur die liebenswerten zotteligen Eingeborenen des zu erobernden Planeten und Robert Pattinsons jeden Tag aufs Neue frisch ausgedruckter nackter Körper, der – weil wieder mal jemand vergessen hat, die Bahre hinzustellen – einfach so aus dem Drucker plumpst.
Eine Nacht lang Pflegenotstand
Überraschend kurzweilig ist dafür «Heldin», Petra Volpes eindringlicher Beitrag zum Kampf gegen den Pflegenotstand. In der Hauptrolle: eine überragende Leonie Benesch («Das Lehrerzimmer») als Pflegerin Floria. Eine Nacht lang begleitet der Film diese auf ihrer Schicht durch die vollbelegte, aber unterbesetzte chirurgische Abteilung eines Schweizer Spitals, quasidokumentarisch gefilmt von Judith Kaufmann. Ampullen werden geöffnet, Spritzen aufgezogen, Vitalwerte gemessen, Angehörige getröstet, Betten herumgeschoben – und ständig kommt etwas dazwischen: Ein Diabetiker ist unterzuckert, eine entlassene Patientin verlangt ihre vergessene Brille zurück, die Auszubildende ist überfordert, und die Frau mit der Sauerstoffflasche zündet sich eine Zigarette an. Jeder Handgriff sitzt, das Mitgefühl ist aufrichtig, der Umgang mit dem minutenweise wachsenden Druck trotz mangelnder Pausen professionell. Doch dann verschwindet die lang erwartete Ärztin einfach in den Feierabend, und die rote Lampe am Zimmer des Privatversicherten leuchtet einmal zu viel.
Der Beruf ist gut, die Verhältnisse sinds nicht: Die Botschaft von «Heldin» ist unmissverständlich. Nur, wird sie auch was nützen? Bei aller Begeisterung über den Film: Nach den Debatten der WdK ist man da skeptisch.
«Heldin» ist verschiedentlich bereits als Vorpremiere zu sehen, ab 27. Februar 2025 regulär im Kino. «Mickey 17» folgt am 6. März 2025, «Das Licht» am 27. März 2025.