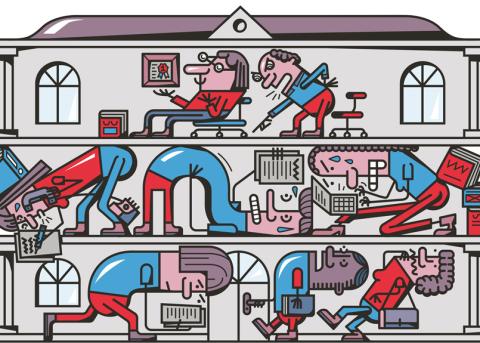Proteste an der Hochschule: Die ETH, Gaza und die Redefreiheit
Die ETH Zürich will die Politisierung des Campus unbedingt verhindern. Und erreicht damit gerade das Gegenteil.

Manchmal stellt in der lang gezogenen Haupthalle der ETH Zürich ein Departement Trouvaillen aus, und an der jährlich stattfindenden Berufsmesse im April drücken einem hier Vertreter:innen der Consultingfirma Deloitte so aggressiv Werbeschlüsselbänder in die Hand, dass ein unbehelligtes Durchkommen schwierig ist. Friedlich sitzende Studierende mit einem politischen Anliegen sind hingegen nicht willkommen. Das zeigte sich auch im Mai 2024, als sich etwa hundert Student:innen versammelt hatten, um gegen die Verbrechen Israels in Gaza und problematische Kooperationen der ETH zu protestieren.
Während die Uni Zürich einen ähnlichen Protest zuliess, holte die ETH damals die Polizei, liess die Halle räumen und zeigte die jungen Menschen wegen Hausfriedensbruch an. Die ETH Zürich «bietet politischem Aktivismus keine Plattform, die politische Neutralität ist uns wichtig», begründete ein Mitglied der Schulleitung in einem Interview auf der ETH-Website die Härte. Mindestens 36 Student:innen haben laut deren Anwalt Philip Stolkin einen Strafbefehl erhalten. Über ein Dutzend haben diesen angefochten. Erste Urteile soll es im Oktober geben.
Doch ihr Ziel, die Politisierung der Hochschule zu unterbinden, erreichte die Leitung mit der Repression nicht. Ganz im Gegenteil: Seit den Anzeigen haben sich auch ETH-Wissenschaftler:innen in mehreren Protestgruppen zusammengeschlossen.
Unsolidarische Vertretungen
An einem Mittwochabend in einer Wohnung in Zürich Oerlikon ist nicht ganz klar, welche Gruppe genau tagt. Eigentlich hätte es «Science for the People Zürich» sein sollen, aber faktisch sind nur Leute gekommen, die auch zu «Axolotl» gehören. Sie sind Doktorierende, Postdocs, wissenschaftliche Mitarbeitende, Gruppenleiter. Manche sind auch bei «Students for Palestine» dabei, die Hälfte ist zudem bei «Science is political» organisiert. Die Gruppen haben nicht nur teils verwirrend ähnliche Namen, sondern auch personelle Überschneidungen.
Der Physiker Marco Baity Jesi forscht für die ETH am Wasserforschungsinstitut Eawag und ist der Einzige in der Wohnung in Oerlikon, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat. Davor hat er an Universitäten in Rom, Madrid, New York und Paris gelehrt und geforscht. Er sagt: «Die Redefreiheit in der Wissenschaft ist in Zürich beschränkter als anderswo. Unser Ziel ist, dass sich das ändert.»
In den anderen neu formierten Grüppchen sind die Motive ähnlich. Der Philosophie-Doktorand Damian Moosbrugger hat eine Petition mitinitiiert, um die Schulleitung zum Rückzug der Anzeigen zu bewegen. Auch aus Frust darüber, so Moosbrugger, «wie unsolidarisch die etablierten Studierenden- und Mittelbauvertretungen reagierten». So befürwortete der Verband der Studierenden die Räumung, und der Verband des ETH-Mittelbaus blieb stumm. Die Unterschriften für die Petition waren dennoch schnell gesammelt.
Moosbrugger schreibt eine Doktorarbeit über die Frage, wie Entwicklungen in der Mathematik von den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen ihrer Zeit geprägt wurden: «Wir wollen bei den Studierenden und Forschenden Verständnis dafür schaffen, dass die Naturwissenschaften nicht losgelöst über der Gesellschaft schweben.»
Für ihre Ziele üben die Grüppchen nun das aktivistische Einmaleins. Auf dem Wohnzimmerboden in Oerlikon steht eine halb leere Plastikschale Hummus, jemand will Solipullis drucken, irgendwann entgleist die Diskussion in Überlegungen dazu, ob eine hohe Hierarchiestufe immer mit Charakterschwäche korreliert. Die PhD-Studentin Muhil Nesi sorgt dafür, dass man wieder zum eigentlichen Thema zurückkommt: eine weitere Petition. Für Nesi ist es die erste politische Erfahrung. Sie sagt, die Gruppe wisse, dass man mit einer Petitionenflut kaum die Schulleitung umstimmen werde. Aber die Wut über die Anzeigen habe ihnen einen «point of action» gegeben, auf den man sich einigen konnte. Das hier sei auch eine «learning experience» und der Versuch, ein Netzwerk aufzubauen.
Raus aus dem Wohnzimmer
Die Gruppen haben auch die «Tech ETHics Talks» ins Leben gerufen – gegen den Willen der ETH. Einer Veranstaltung zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen – mit einem Harvard-Forscher und einer Amnesty-International-Vertreterin – hatte die Leitung kurzfristig die Bewilligung entzogen. Kürzlich fand die abgesagte Veranstaltung doch noch statt, unter anderem Namen und unter der Schirmherrschaft von Roy Wagner, Professor für Mathematikgeschichte.
Die Schulleitung liess derweil einen Leitfaden zum Umgang mit geopolitischen Konflikten ausarbeiten und hat basierend darauf jegliche Solidaritätsbekundungen von den ETH-Websites genommen, egal ob zu den Opfern der Kriege in der Ukraine oder in Gaza oder jenen des Regimes im Iran.
Aber die Netze, die sich die Forschenden bauen, beginnen zaghaft Wirkung zu entfalten. Die Personen in den Grüppchen laden sich gegenseitig für Vorträge an ihre Institute und Departemente ein. Um dort anstatt in Wohnzimmern über die politische Dimension ihrer Arbeit zu sprechen. 2026 wird an der ETH zum ersten Mal ein Kurs zu «Academic Freedom, Activism and Sanctions» unterrichtet. Und die Petitionen haben die Schulleitung zwar nicht umgestimmt, aber weitere Unterstützung gewonnen: Mittlerweile haben sich mehrere Professor:innen dahinter gestellt. Etwa Janet Hering, emeritierte Professorin des ETH-Wasserforschungsinstituts Eawag, die kürzlich auf Linkedin darauf hinwies, dass die ETH die «Magna Charta Universitatum» unterzeichnet und sich damit zum Recht auf freie Meinungsäusserung bekannt hat.