Antifaschismus: Militant, vernetzt und erfolgreich
Die Antifa von Portland macht nicht erst seit Donald Trumps jüngstem Angriff auf die linke Stadt immer wieder Schlagzeilen. Begegnung mit einer Bewegung.

Sie ist die Anführerin der Antifa in Portland, die Chefin quasi, wird finanziert aus Syrien, teils vom sogenannten Islamischen Staat, und sie hat all die Proteste vor den Büros der Migrationsbehörde ICE in Portland im Bundesstaat Oregon organisiert.
Und dann kommt die 32-Jährige auch noch zu spät zum vereinbarten Treffen. «Anarchist Standard Time», schreibt sie per Messenger und entschuldigt sich. Denn angesichts ihres bemerkenswerten Engagements für das Böse an sich ist Zeina erstaunlich freundlich. Natürlich ist sie weder vom IS gesponsert noch Anführerin der Antifa. Aber all diese Dinge wurden schon über sie behauptet. Zum Beispiel vom «Journalisten» Andy Ngo. Der rechtsextreme Influencer setzt regelmässig Posts über Zeina ab, verleumdet sie, wartet mit vermeintlichen Hintergrundinformationen über sie auf.
Zeina, die so wie die anderen Gesprächspartner:innen der WOZ nicht unter ihrem richtigen Namen in der Zeitung erscheinen will, ist in den letzten fünf Jahren neunmal umgezogen: «Ich wurde schon auf der Strasse von einer Horde Rechtsextremer verfolgt, Leute sind in mein Haus eingebrochen», sagt sie. «Ich habe Angst.» Sie hat sich schon mehrmals öffentlich geäussert, betreibt die Website wewillfreeus.org mit Artikeln und Recherchen zur Entwicklung der extremen Rechten in Oregon. Und: «Ich bin eine Antifaschistin, und ich bin Araberin – ich bin ein leichtes Ziel.»
«Hupt, wenn ihr ICE hasst!»
Ende September hat US-Präsident Donald Trump die Antifa zur Terrororganisation erklärt. Man wolle sie zerstören, so wie auch Drogenkartelle zerstört würden, kündigte Justizministerin Pam Bondi an. Wer damit wirklich gemeint ist, ist fraglich. Eine nationale Organisation Antifa mit Anführer:in und Jahresabrechnung gibt es nicht.
Dass der Begriff diffus ist, macht die Drohungen der Regierung besonders unheimlich. Einerseits steht «Antifa» bloss für Antifaschismus, zu diesem dürften sich viele US-Amerikaner:innen bekennen. Andererseits ist «Antifa» die Bezeichnung für eine lose, vielfältige und dezentrale Bewegung, deren Fokus auf der direkten und teils militanten Bekämpfung von rechtsextremen Personen und Organisationen liegt. Bezug nimmt die Bewegung auf die 1920er Jahre in Italien und auf die Antifaschistische Aktion in der Weimarer Republik.
Diese Bewegung ist im Folgenden mit «Antifa» gemeint. Die WOZ hat in Portland mehrere ihrer Aktivist:innen getroffen und mit ihnen über ihre politische Praxis, ihre veränderte Situation unter Trump und über die Geschichte ihrer Bewegung in Portland geredet.
Portland werde «von der Antifa und anderen inländischen Terroristen» belagert, behauptete Trump Ende September. Rund 600 000 Menschen wohnen hier in der grössten Stadt im ländlichen Bundesstaat Oregon. In weiten Teilen fühlt sich Portland aber nicht wie eine Stadt an, eher wie ein Dorf, das nie aufhört (Basel-Stadt zählt fünfmal so viele Einwohner:innen pro Quadratkilometer).
Der Fokus der Regierung auf Portland ist nicht zufällig: Seit 1988 hat sich die Stadt zu einem Zentrum der antifaschistischen Bewegung in den USA entwickelt. Sie hat zur Etablierung einer Art linker Hegemonie in der Stadt beigetragen: 40 000 Personen haben hier an den jüngsten No-Kings-Protesten teilgenommen; Portland gilt heute als einer der sichersten Orte für LGBTIQ-Personen; die zwölf Sitze der kommunalen Legislative, des City Council, besetzen ausschliesslich Vertreter:innen der Demokratischen Partei. Vier von ihnen gehören den Democratic Socialists of America (DSA) an, dem linken Parteiflügel.
An einem sonnigen Nachmittag im Oktober haben sich, so wie jeden Tag seit mehr als drei Monaten, rund zwanzig Personen vor dem ICE-Gebäude in einer abgelegenen Ecke der Stadt versammelt. Einige wenige der Demonstrant:innen sind schwarz vermummt, andere sind wohl über siebzig Jahre alt, der Stimmung nach ist das eher eine bunt durchmischte Nachmittagsparty als ein schwarzer Block. Es läuft Musik, an eine Strassenlaterne ist ein Foto von Donald Trump mit Jeffrey Epstein geklebt. Regelmässig hupen vorbeifahrende Autofahrer:innen, die das Schild «Hupt, wenn ihr ICE hasst!» sehen.
Eine etwa vierzigjährige Frau, die sich Dima nennt, sagt, sie sei Teil von Portland Contra Las Deportaciones (Portland gegen die Deportationen). Sie würden vor allem Migrant:innen über ihre Rechte aufklären, gegen die ICE verstösst. «Wenn die Zeiten sich wieder ändern, steht ihnen vielleicht eine Genugtuung zu», sagt Dima. Hinzu komme direkte Hilfe, Unterstützung in der Nachbarschaft – und eben Protest: «Wir fordern bloss, dass sich der Staat an die Gesetze hält», sagt sie. Mehr Leute würde sie sich wünschen, mehr Durchschlagskraft.
«Im Moment sind wir einfach eine Ansammlung von Einzelpersonen», sagt Dima. Eine Ansammlung, die fast jeden Abend von Beamt:innen angegriffen wird. Wer die Fernsehbilder von Tränengas und Verhaftungen auf der Strasse gesehen hat, wundert sich über die friedliche Stimmung hier: Rechte Journalist:innen und Influencer sind fast durchgehend vor Ort und filmen das Geschehen. Immer wenn die ICE-Beamt:innen Tränengas einsetzen, flimmern danach dystopisch anmutende Videoaufnahmen durch die Sendungen der rechten TV-Station Fox News.
Zeina sagt dazu: «Die Rechte versucht, den vergleichsweise kleinen Protest vor dem ICE-Gebäude in den Medien möglichst martialisch zu inszenieren.» Die Demonstrant:innen versuchen mittlerweile, dem entgegenzuwirken, etwa indem sie Tierkostüme tragen, um harmlos zu wirken und die Bedrohungsbeschwörung der Regierung lächerlich zu machen.
Tatsächlich seien die Demonstrationen vor dem ICE-Gebäude innerhalb der Linken umstritten, sagt Time. Time sitzt vor der genossenschaftlich organisierten Bar Worker’s Tap, volltätowierte Unterarme und Hände, kennt praktisch alle anderen Barbesucher:innen und grüsst herzlich. «Viele Leute fragen sich, ob es sinnvoll ist, unsere Ressourcen auf diesen Ort zu fokussieren», sagt Time. Anders als Trump behauptet, sind die meisten Demonstrant:innen vor dem ICE-Gebäude, so wie Dima, zwar sicherlich Antifaschist:innen, aber nicht eigentliche Antifa-Aktivist:innen.
Time tritt aus Erfahrung auf die Bremse. Mehr als fünf Jahre ist es nun her, dass nach der Ermordung von George Floyd auch hier Tausende unter dem Motto «Black Lives Matter» auf die Strassen strömten. Anders als in anderen Städten dauerten die Unruhen hier aber nicht nur einige Wochen, sondern Monate an. Jeden Abend stellen sich Demonstrant:innen der Polizei entgegen, einmal zündeten sie eine Wache an, befreiten Gefangene. «Wir hatten zwar viel Kraft und Energie, aber überhaupt keinen Plan», sagt Time. «Es gab diese unzähligen Jugendlichen, die innert Wochen radikalisiert wurden und sich an unserer Seite an Strassenkämpfen beteiligten.» Eine ganze Generation von Aktivist:innen sei traumatisiert, glaubt Time – jetzt bloss nicht wieder ausbrennen.
In Portland selbst betreibe ICE ausserdem nur einige Arrestzellen, das Ausschaffungsgefängnis liegt in Tacoma bei Seattle, einige Fahrstunden entfernt. Und anders als etwa in Chicago stürmen die Beamt:innen hier nicht ganze Strassenzüge. Eher würden sie Einzelpersonen entführen, gezielt und klandestin. «Oder sie greifen Bauernhöfe auf dem Land an, wo Leute ohne Aufenthaltsbewilligung arbeiten – bis wir davon hören, ist es schon zu spät, um noch zu intervenieren.» Time stellt deshalb infrage, dass es sinnvoll ist, so viel Zeit vor dem Gebäude in Portland zu verbringen, ohne die Arbeit der Behörde wirksam stören oder sogar unterbinden zu können.
Dass die Behörde in Portland keine migrantisch bewohnten Strassenzüge stürmt, liegt daran, dass es hier kaum welche gibt. Portland ist eine der weissesten Städte des Landes, es leben hier vergleichsweise wenige Migrant:innen, was viel mit der besonders rassistischen Geschichte des Bundesstaats Oregon zu tun hat.
Die Verteidigung der Stadt
Paul ist zwar schon 61-jährig, aber einen Faustkampf mit ihm würde man immer noch um jeden Preis vermeiden wollen. Er hat lange Haare, eine tiefe Stimme, er plaudert nicht gern, was schade ist, denn Paul ist so etwas wie eine lebende Legende des Antifaschismus.
Geboren ist Paul in Chicago, wo, so wie im ganzen Land, in den achtziger Jahren Massenproteste für die atomare Abrüstung und in Solidarität mit Mittelamerika stattfanden. Sie hätten ihn politisiert, erzählt Paul. Später schloss er sich der Love and Rage Revolutionary Anarchist Federation an, er beteiligte sich an der Kampagne zur Freilassung von Mumia Abu-Jamal, der im Umfeld der Black Panthers agierte, anschliessend schloss er sich der Anti-Racist Action an.

2000 siedelte Paul schliesslich nach Portland über. «Die Stadt wurde damals zu einem Zentrum der linken sozialen Bewegungen», sagt er. «Die Stimmung war enorm angespannt.» Linke reisten zu dieser Zeit nicht nur nach Portland, weil es da gute Konzerte gab, sondern auch, um sich an der Verteidigung der Stadt zu beteiligen.
Oregon gilt zwar historisch als «free state». Allerdings war es Schwarzen Personen gemäss Verfassung jahrzehntelang verboten, sich dort überhaupt niederzulassen. Mit dem Zusatzartikel 14 zur US-Verfassung wurden die «black exclusion laws» 1868 zwar übersteuert, formell in Kraft blieben sie aber bis 1929. Ab den zwanziger Jahren wurde der rechtsextreme Ku-Klux-Klan zu einer prägenden Macht im Bundesstaat.
Auch vor diesem Hintergrund wurde Oregon zur Projektionsfläche rassistischer Ideologen. Ab den siebziger Jahren etablierte sich der Northwest Territorial Imperative: Der Nordwesten der USA soll zu einer unabhängigen Republik werden; möglichst viele Neonazis und Rassist:innen sollen dahin übersiedeln. Spätestens in den achtziger Jahren wurde Portland zur «skin city», einem Zentrum von Neonazi-Skinheads, wie das 2024 erschienene Buch «It Did Happen Here. An Antifascist People’s History» nachzeichnet. Die Behörden unternahmen wenig, die Situation geriet ausser Kontrolle, fast täglich gab es Angriffe auf migrantische Personen, Punks und queere Leute.
1988 veränderte alles. Eine Gruppe von rechtsextremen Skinheads ermordete willkürlich den Somali Mulugeta Seraw. Offiziell galten die Konflikte auf der Strasse als Ganggewalt. Aber Mulugeta Seraw war nicht Teil einer Gang, er war bloss nicht weiss. In der Folge etablierten sich antifaschistische Strukturen: Die Anti-Racist Action gründete einen lokalen Ableger, die migrantischen Communitys vernetzten sich mit linken Aktivist:innen, auch antirassistische Skinheadgangs wurden aktiv. Unter der Bezeichnung «Antifa» agierte damals in den USA aber noch niemand, das war ein europäischer Begriff, den Leute wie Paul bewusst in die USA importierten. «Schon in den neunziger Jahren haben wir bei Love and Rage Antifas aus Deutschland eingeladen, damit sie uns von ihrer Arbeit erzählen», sagt er.
Erst 2007 formierte sich in Portland die Rose City Antifa. Sie entwickelte sich in Teilen aus der Anti-Racist Action heraus und war die erste grössere linke Organisation, die Antifa im Namen trug. Die Rose City Antifa operierte vor allem über Recherche und Doxing – also das Veröffentlichen personenbezogener Daten von organisierten Neonazis und Rechtsextremen. «Sie verband Erfahrungen der Anti-Racist Action mit Taktiken des schwarzen Blocks in Europa», sagt Paul. Auch wegen der Antifa habe sich die «Volksfront», eine der letzten Neonazigruppierungen, schliesslich 2012 aufgelöst. Manche der Mitglieder traten später der rechtsextremen Miliz Proud Boys bei. «Und nach Trumps erster Wahl verbreiteten sich das Konzept und die Bezeichnung ‹Antifa› in weiteren Teilen der USA», so Paul. Heute ist die Rose City Antifa kaum mehr aktiv.
Antifa-T-Shirt aus Deutschland
Die transatlantische Vernetzung unter dem Antifa-Begriff birgt auch Tücken. Während er wild mit seiner rechten Hand herumfuchtelt, sagt Switch: «Ich glaube eigentlich nicht, dass sich Trump am historischen europäischen Faschismus orientiert, sondern dass er eher die Ära Nixon zum Vorbild hat.» Wobei das wiederum herausfordernd sei für den europäischen Antifaschismus, «weil sich die Rechte dort vermehrt am US-amerikanischen Modell zu orientieren scheint».
Switch beschreibt genau, in welcher Ecke der Bar er wartet, aber das wäre nicht nötig gewesen: Auf der einen Seite seines Halses prangt ein ACAB-Tattoo («All Cops Are Bastards»), auf der anderen ein Porträt von Karl Marx. Switch, er fällt auf. Natürlich seien aber auch waschechte Faschist:innen Teil von Trumps Netzwerk, sagt er. «Der Trumpismus hat Rassist:innen und Rechtsextreme so stark mobilisiert, wie es vermutlich seit den fünfziger Jahren nicht mehr vorgekommen ist.»
Der 39-jährige Switch ist Teil einer derjenigen antirassistischen Skinheadgangs, die Portland seit den neunziger Jahren mitprägen. «Wir leben diese Kultur, wir sind nicht im eigentlichen Sinn politisch», sagt er. Er erinnert sich daran, wie er schon als Teenager ein Antifa-T-Shirt aus Deutschland bestellt hat. Aufgewachsen ist er in Maryland an der Ostküste, auf dem Land. Politisiert habe ihn der Irakkrieg ab 2003, sagt er. Nachdem er aus der Schule geflogen war, ging er aber selbst zum Militär: «Ich habe Geld gebraucht und hatte kein Interesse daran, meinen Alltag zu moralisieren.»
Nach Portland gezogen ist er kurz nach Beginn von Trumps erster Amtszeit, weil er sich online mit dem lokalen Linken Sean angefreundet hatte. Switch zog zu ihm in die Wohnung, vernetzte sich in der Szene. Sean wurde bald darauf ermordet. Nach einem Streit vor einer Bar stiegen die drei Täter in ihr Auto und überfuhren ihn. Der Fall machte später nationale Schlagzeilen, weil die Polizei von Portland drei Jahre lang auf eine Verhaftung verzichtete, obwohl die Täter auf Überwachungsvideos erkennbar waren. Erst nachdem Medien zu berichten begannen, handelten die Behörden. Switch, der beim Mord anwesend war, machte keine Zeugenaussage. In seinem bislang einzigen Medienauftritt sagte er gegenüber einem Radiosender: «Ich glaube nicht an Strafverfolgung und Gefängnisse, auch nicht, wenn es um die Mörder meines besten Freundes geht.»
Switch blieb in Portland. Bis heute würden Skinheadgangs linke, queere und migrantische Anlässe gegen Angriffe schützen, sagt er. Bis heute würden sie jeweils kontaktiert, wenn Rechtsextreme in der Stadt beobachtet werden. «Ich bin froh, dass es Leute gibt, die Recherchearbeit machen, die versuchen, Massen auf die Strasse zu bringen», sagt Switch. «Mir selbst liegt das nicht: Ich kann nirgends klingeln und die Leute davon überzeugen, dass wir die Guten sind.»
Aber heute würden die organisierten Rechten wissen: «Wenn sie die Stadt betreten, dann wird es zu Strassenschlachten kommen», sagt er. «Das trauen sie sich kaum mehr.» Die Verhaftungen vieler Führungsfiguren der Proud Boys in Oregon nach dem Sturm auf das Kapitol, das Parlamentsgebäude in Washington D. C., am 6. Januar 2021 taten ihr Übriges.
Die Proud Boys waren bereits während Trumps erster Amtszeit die wichtigsten Gegner der Antifa. Eine Miliz, die gegen den angeblichen «Genozid an den Weissen» kämpft und massgeblich am Sturm aufs Kapitol beteiligt war, was für Antifaschist:innen wie Time, die die Gruppe schon lange gekannt und vor ihr gewarnt hatten, deutlich weniger überraschend war als für viele bürgerliche Beobachter:innen. Nur zugehört hatte den Aktivist:innen kaum jemand.
Die Proud Boys und andere rechtsextreme Gruppierungen organisierten nach 2016 regelmässig Demonstrationsumzüge in der linken Stadt. Sie griffen immer wieder queere und linke Orte und Personen an, tun das teils auch heute noch. Zeina spricht von «trophy hunting»: «Sie fahren durch die Strassen, halten Ausschau nach Opfern – und verprügeln sie», sagt sie. Weit kamen die grossen Umzüge zu dieser Zeit aber nie: «Jedes Mal, wenn sie mobilisiert haben, stellten wir uns ihnen entgegen», erzählt Time. Alle paar Monate lieferten sich Hunderte Antifaschist:innen Strassenkämpfe mit den rechten Demonstrant:innen, irgendwann gaben diese auf.
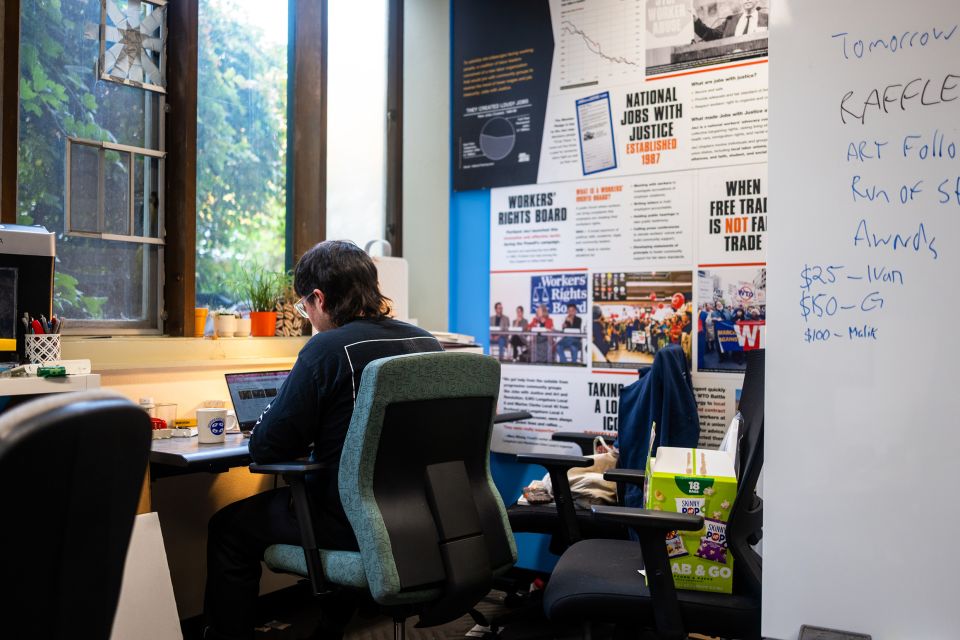
So wie überall, besteht auch in Portland die antifaschistische Arbeit aber nur zu einem Teil aus «Selbstverteidigung», wie Zeina es nennt. Mindestens so wichtig ist die Recherche. Schon mehrmals deckten Aktivist:innen rechtsextreme und rassistische Netzwerke in Polizei und Justiz auf. Auch Führungsfiguren in Neonazigruppierungen haben sie enttarnt. «Die Aktivist:innen folgen dabei stets einem ziemlich fixen Schema», sagt Zeina. «Zuerst rufen sie beim Arbeitgeber an, informieren ihn darüber, dass ein Nazi für ihn arbeitet.» In einem nächsten Schritt werde vielleicht die Nachbarschaft informiert. Wenn das alles nichts bringt, folgt irgendwann die öffentliche Bekanntmachung.
Raus aus der Subkultur
Inzwischen hat Donald Trump die nach dem Sturm aufs Kapitol verurteilten Proud Boys begnadigt. In einer Fernsehdebatte sagte er 2020: «Proud Boys, haltet euch zurück, haltet euch bereit.» Zu Beginn des Gesprächs mit Paul, als es noch um Formalitäten geht, um die Frage der Anonymität, sagt er: «Es spielt eigentlich keine Rolle mehr: Sie haben jetzt Zugang zum Staat, sie haben den grössten Sicherheitsapparat der Welt auf ihrer Seite.»
Was bedeutet es für Antifaschist:innen, wie verändert sich ihr Kampf, wenn sich die Regierung mit ihren Gegner:innen verbündet? «Das ist jetzt die entscheidende Frage, jetzt, da das kein subkultureller Kampf mehr ist», sagt Paul. In der Anti-Racist Action hätten sie jahrelang dafür gearbeitet, genau diese Situation zu verhindern.

Derzeit sei er daran beteiligt, Strategietreffen und Nachbarschaftsversammlungen zu organisieren. Auf der Strasse komme man gegen Hundertschaften des Staates schwerlich an. Und auch das Doxing habe seine Wirksamkeit verloren, sagt Zeina. «Jetzt, da diese Ideologie in den Mainstream vorgerückt ist, hat das nicht mehr den gleichen Effekt.» Trotzdem gebe es Versuche, die Strategie nun auf Beamt:innen von ICE anzuwenden: Von einigen wenigen Agent:innen haben anonyme Aktivist:innen schon Namen und Fotos auf einem Internetportal veröffentlicht.
Letztlich sind das eher Plänkeleien. Die Antifa hält sich in Portland, obwohl auf der grossen politischen Bühne das Gegenteil behauptet wird, derzeit noch auffallend zurück. «Wir sehen uns mit einer Situation konfrontiert, die es so vielleicht noch nie gegeben hat», sagt Zeina. «Nicht mit diesem Ausmass an Überwachungstechnologie, die gegen uns eingesetzt werden kann.»
Und auf die Frage, was jetzt zu tun sei, antwortet – ähnlich wie Time, wie Switch und Paul – auch Zeina: «Ich weiss es nicht, ich kann diese Frage einfach nicht beantworten.»
Diese Reportage wurde ermöglicht durch das Daniel-Haufler-Stipendium der taz Panter Stiftung.


