Auf allen Kanälen: In der Abwärtsspirale
In Österreichs Medienbranche gingen allein dieses Jahr 300 Jobs verloren. Dabei spielen auch die stark gekürzten Regierungsinserate eine Rolle.
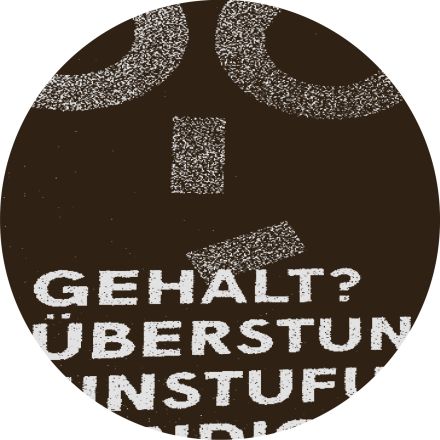
«Wir sind am Untergang, wir funken SOS.» Mit drastischen Worten beschrieb Ute Gross, Redaktorin der «Kleinen Zeitung», die Lage im österreichischen Journalismus. «Die Situation verschärft sich nahezu täglich», sagte sie bei einer Pressekonferenz der Gewerkschaft GPA in Wien. Laut GPA-Hochrechnung sind allein seit Anfang Jahr rund 300 Arbeitsplätze verloren gegangen. Betroffen sind nicht nur Redaktor:innen, sondern auch technisches Personal, Korrektorinnen und Lektoren.
Die Liste der betroffenen Medienhäuser umfasst einen grossen Teil der Presselandschaft: «Der Standard», «Presse», «Kurier», «Kronen Zeitung», Regionalmedien Austria, «Kleine Zeitung», Red Bull Media House und Puls 24. Über die genaue Anzahl schweigen die Medienhäuser. «Es ist unklar, von wie vielen Personen wir uns tatsächlich trennen müssen», sagt «Der Standard»-Geschäftsführer Alexander Mitteräcker. Als Grund für die Krise nennt er die schwierige Konjunktur, aufgrund derer Unternehmen ihre Werbebuchungen reduzierten. Doch auch die stark gekürzten Regierungsinserate fallen ihm zufolge ins Gewicht.
Angespannte Budgetlage
Tatsächlich ist der Einbruch eklatant: Im ersten Halbjahr 2025 haben Bundesregierung, Bundesländer und Kammern nur mehr 3,2 Millionen statt 18,7 Millionen Euro für Inserate ausgegeben – eine Reduktion von achtzig Prozent. Zum Teil ist diese Kürzung wohl auf den Regierungswechsel zurückzuführen, die Koalition aus Konservativen, Sozialdemokrat:innen und Liberalen nahm erst im März ihre Arbeit auf. Wortmeldungen von Medienminister Andreas Babler (SPÖ) lassen aber auf Absicht schliessen. Er bezeichnete das frühere «ungeordnete Rausschiessen von Inseraten» als «kein sehr erstrebenswertes Ziel». Sein Ministerium verweist auf die angespannte Budgetlage und kündigt stattdessen zusätzliche Förderungen an.
Die Abhängigkeit von Regierungsinseraten prägt die österreichische Presse seit Jahren. Auf die Spitze getrieben wurde sie von den früheren Kanzlern Werner Faymann (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP). Gegen Letzteren wird noch ermittelt, weil er im Verdacht steht, sich wohlwollende Berichterstattung und gefälschte Meinungsumfragen erkauft zu haben.
«Die Vergabe von Regierungsinseraten ist keine transparente und nachhaltige Unterstützung», sagt Medienwissenschaftler Jakob-Moritz Eberl von der Universität Wien. Er kritisiert jedoch, wie radikal – «ohne Plan B» – sie nun zurückgefahren wurde. Dazu kommt: Die österreichischen Medien sind noch immer stark auf Printprodukte ausgerichtet und wenig innovativ. Wegen der üppigen Regierungsinserate habe es wenig Notwendigkeit gegeben, Neues auszuprobieren. Das rächt sich nun.
Für Andy Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien sind andere Ursachen noch entscheidender. Neben eigenen Versäumnissen und dem Abwandern von Anzeigenkund:innen zu Digitalplattformen sei auch die Medienpolitik mitverantwortlich für die Krise. «Das gesetzliche Fördersystem hat eindeutig versagt – obwohl immer mehr Geld investiert wurde», sagt Kaltenbrunner. Denn in den vergangenen zwanzig Jahren sei ein Drittel der journalistischen Arbeitsplätze verloren gegangen.
Enorme Arbeitsverdichtung
Die Folgen bekommen auch die Redaktionen zu spüren. Die verbleibenden Kolleg:innen litten unter enormer Arbeitsverdichtung, was sich negativ auf die Qualität auswirke, sagt Gewerkschafterin Gross. Kaltenbrunner warnt vor einer Abwärtsspirale: «Je mehr Journalisten verschwinden, desto eingedickter werden die Produkte, desto geringer entwickelt sich die Zahlungsbereitschaft des Publikums.»
Wenn jetzt nichts passiere, werde es 2026 zu Konkursanmeldungen kommen, warnt Gross. Sie fordert ein Vertriebsförderungsgesetz sowie die steuerliche Absetzbarkeit von Abos. Die Gewerkschaft verlangt zudem Verwertungsgesellschaften gegen die Konkurrenz von Onlineplattformen, die seit Jahren Werbegelder absorbieren. Mitteräcker sieht den grössten Hebel in der Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Aboprodukte. Davon ist angesichts der klammen Budgetsituation aber keine Rede.
Ohnehin ist fraglich, ob die Massnahmen nicht zu spät kämen. «Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels», sagt Kaltenbrunner. Es gelte, Versäumnisse von zehn bis fünfzehn Jahren nachzuholen. Der Journalismus in Österreich bleibt wohl noch länger in der Krise.
