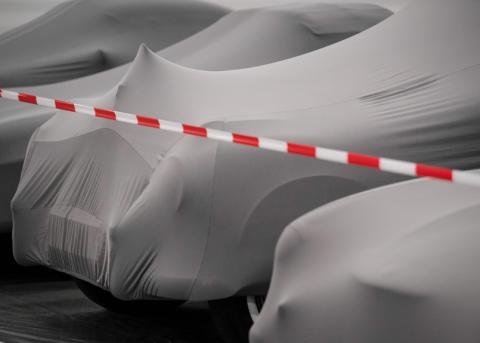Sachbuch: Die Geissel des Krieges
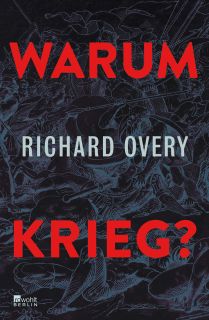
Wie lässt sich die Menschheit von der Geissel des Krieges befreien? Auf diese Frage, die Albert Einstein ihm 1932 gestellt hatte, antwortete Sigmund Freud: Das gehe leider nicht, Kriege werde es immer geben.
Frühe Anthropolog:innen wie Bronisław Malinowski oder Margaret Mead waren demgegenüber der Ansicht, der Krieg sei eine schlechte Angewohnheit, über lange Zeit kulturell erlernt – er könne in Zukunft also auch wieder verlernt werden. Lange herrschte in der Ethnologie die Überzeugung vor, dass der Krieg erst mit der Zivilisation über die Menschheit gekommen sei. Der britische Historiker Richard Overy, bekannt als Spezialist für den Zweiten Weltkrieg, zeigt in seinem neuen Buch «Warum Krieg?» anhand der neueren Forschung und gestützt auf Ergebnisse der Archäologie, dass das ein Mythos ist.
Um sich dieser grossen Frage zu nähern, zieht Overy Ansätze aus diversen Disziplinen heran, von wiederkehrenden Mustern in der Geschichte bis zur Psychologie. Die «Psychoanalyse des Atomkriegs» wurde nach den fünfziger Jahren zwar aufgegeben, doch bis heute untersucht die Evolutionspsychologie die Dispositionen zur Gewaltanwendung. Diese kann gut beschreiben, wie Menschen sich durch Kriege verändern, sie kann aber kaum erklären, warum Kriege überhaupt ausbrechen. Overy untersucht auch, wie Veränderungen der Umwelt und des Klimas zu Konflikten führen, vom Kampf um Jagdgründe bis zu den Bürgerkriegen in Regionen, die etwa von Dürren heimgesucht werden. Doch für sich genommen bleiben solche Erklärungen bruchstückhaft.
Die Kriege der Moderne lassen sich ohne die kapitalistische Wachstumsdynamik nicht erklären, die zu wiederkehrender Verknappung von Ressourcen wie Wasser, Kohle, Öl oder Mineralien führt. Hinzu kommt die Rolle des Glaubens, in dessen Namen «heilige Kriege» geführt werden. Dabei geht es immer auch um Vormachtstellungen, etwa um Grenzen zu sichern und Nachbarn unter Kontrolle zu halten. So bleibt der Schluss, dass sich die Kriege unserer Zeit nicht auf einfache Ursachen zurückführen lassen.