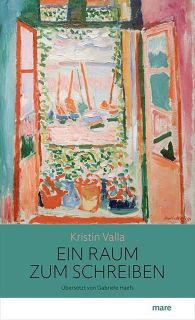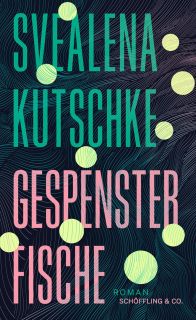Literatur: Frauen und ihre «Denkstelle»
Neue Bücher von Kristin Valla und Svealena Kutschke zeigen, wie produktiv der weibliche Kampf um den eigenen «Raum zum Schreiben» sein kann.

Es hätte der Beginn einer grossen Karriere sein können: Mit 25 Jahren etablierte sich die Norwegerin Kristin Valla als international anerkannte Schriftstellerin. Ihr Debüt «Muskat» aus dem Jahr 2000 war ein Erfolg und wurde in viele Sprachen übersetzt, dann veröffentlichte sie weitere Romane und Erzählungen, zuletzt «Die Schüsse von Tiflis» über die legendenumwobene Künstlerin Dagny Juel im Berlin der Jahrhundertwende. Das war 2006.
Knapp zwanzig Jahre nach ihrem Erstling schaut sie sich in der Wohnung um, in der sie mittlerweile mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen lebt, und realisiert, dass sie nicht nur längst aufgehört hat, eine Schriftstellerin zu sein, sondern dass sie nicht einmal ein eigenes Zimmer hat, wo sie ungestört schreiben könnte. «Zehn Jahre hatten wir gebraucht, um diese Wohnung zu renovieren», heisst es rückblickend in ihrem neuen Buch. «Nicht ein einziges Mal hatte ich bei diesem Prozess gedacht, dass ich vielleicht ein Zimmer für mich alleine brauchte. Meine Kinder hatten jedes ein eigenes Zimmer, ich nicht.»
Katalysator einer Wiedergeburt
Die Suche nach dem verlorenen Raum zum Schreiben führt sie nach Südfrankreich, in eine Gegend, in der die Immobilienpreise so tief sind, dass sie sich ein kleines Häuschen (auf Kredit) leisten kann. Dieses erweist sich allerdings als äusserst renovations- und pflegebedürftig. Das Haus wird selber zum aufreibenden Projekt, ans Schreiben ist erst einmal nicht zu denken. Und doch wird es auf unerwartete Weise zum Katalysator für eine Wiedergeburt der Schriftstellerin: 2019 veröffentlicht sie «Ut av det blå» (auf Deutsch 2024 erschienen unter dem Titel «Das Haus über dem Fjord»), nun folgt «Ein Raum zum Schreiben», der von dieser Wiedergeburt erzählt.
Die überraschenden Wendungen, die diese begleiten, sollen hier nicht verraten werden, denn die Brüche in einem scheinbar vorhersehbaren Plot machen den Reiz dieser Erzählung aus – die allerdings nur als Rahmenerzählung eines sehr viel umfassenderen Projekts fungiert. Valla verwebt den autobiografischen Strang nämlich mit zahlreichen Exkursen in die Literaturgeschichte und zeigt, dass es bei vielen Schriftstellerinnen einen mysteriösen, aber unleugbaren Zusammenhang zwischen Schreiben und dem Suchen, Renovieren, Einrichten und Erobern von Räumlichkeiten oder ganzen Anwesen gibt.
Das Ergebnis dieser historischen Recherche lässt sich so zusammenzufassen: Frauen können vermutlich überall schreiben, aber nicht unter allen Umständen. Den eigenen Raum, den Virginia Woolf in ihrem berühmten Essay so selbstverständlich als Bedingung fürs Schreiben reklamierte, können sich Frauen oft nur mit viel Aufwand und im Kampf gegen innere und äussere Widerstände erobern. Und obwohl dieser Kampf scheinbar vom Schreiben ablenkt, setzt er Energien frei, die der Literatur und den Frauen selbst zugutekommen. Valla liefert damit auch eine Neuinterpretation des von Woolf geforderten «room of one’s own»: Vielleicht geht es dabei weniger um das eigene Zimmer als um das Erschaffen einer «Denkstelle» – ein Begriff, den Valla von ihrem Sohn übernimmt, der damit seinen Lieblingsplatz auf dem Fenstersims bezeichnete, wo er als kleiner Junge einfach sass und in den Garten schaute. «Ich liebe meine Familie», schreibt Valla versöhnlich. «Aber ich liebe auch die Stille, wo die unnützen Gedanken wohnen.»
In der Psychiatrie
Um den Raum zum Schreiben geht es auch in «Gespensterfische» von Svealena Kutschke. Der Roman erzählt die Geschichte einer Psychiatrischen Klinik in Lübeck über einen Zeitraum von hundert Jahren bis in unsere Gegenwart. Die kurzen Kapitel, die zwischen den Jahrzehnten hin und her springen, werfen Schlaglichter auf verschiedene Figuren. Kurze Episoden im Leben von Patient:innen, Pflegepersonal und Ärzteschaft fügen sich zum Bild einer Epoche zusammen, die von der Psychiatrie geprägt wurde, im Guten wie im Schlechten. Die Klinik ist heilsames Refugium, gleichzeitig aber auch Ort zerstörerischer struktureller Gewalt.
Symbolisch für diese Ambivalenz ist die Figur Olga Rehfeld: Ursprünglich war sie als Gattin des Klinikdirektors in die Anstalt gezogen, dann wurde sie von diesem als Patientin eingewiesen, weil sie sich mehr fürs Schreiben und für Frauen als für Haushalt und Kinder interessierte. Jahrzehntelange Behandlungen – Elektroschocks, Wasserkuren und hochdosierte Medikation – machten aus ihr eine «Ruine». Doch im Alter richtet sie sich ausgerechnet hier ihre «Denkstelle» ein: Gemeinsam mit ihrer Partnerin verbringt sie die Tage lesend, schreibend, inspiriert und inspirierend. Ihre Bücher und Texte zirkulieren unter der Belegschaft und den Patient:innen, sie erweitern den engen Raum der Klinik und legen noch über ihren Tod hinaus Zeugnis von einer mörderischen Konspiration der Psychiatrie mit der Politik ab.
Valla wie Kutschke zeigen auf sehr unterschiedliche Weise, dass «ein Raum zum Schreiben» für Frauen nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist, dass aber gerade die Auseinandersetzung damit literarisch äusserst fruchtbar sein kann.