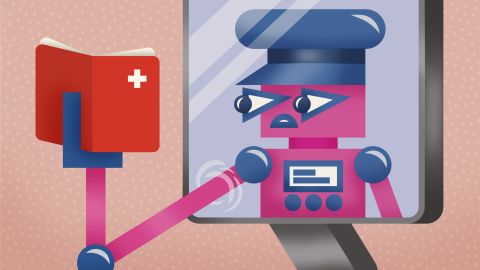Ja zur E-ID: Trial and error
Ein Politkrimi sei das knappe Ja zur E-ID gewesen, heisst es jetzt allerorten. Aber ist die knappe Zustimmung mit nur 50.4 Prozent tatsächlich überraschend? Nicht, wenn man auf die erste Abstimmung zum Thema zurückblickt. Vor vier Jahren wurde ein Gesetz über eine elektronische Identität noch deutlich mit 64.4 Prozent abgelehnt. Die neue Vorlage musste also einen Meinungsumschwung bewirken. Dass sie nun einen ausreichenden Teil der Stimmbevölkerung vom Nutzen einer E-ID überzeugen konnte, kam nicht von ungefähr.
Nach der damaligen Ablehnung hatten sich die Kritiker:innen für eine Neuauflage im Parlament eingesetzt. Sie stammten aus dem Umfeld der Digitalen Gesellschaft, einem Verein zur Wahrung der Grundrechte in einer vernetzten Welt. Diese prägten darauf auch die Konzeption einer E-ID mit, wie sie nun angenommen wurde: vom Staat statt von Konzernen herausgegeben, dezentral bei den User:innen gespeichert und damit datensparsam in der Anwendung. Das Vorgehen zeigt: «Trial and error », Versuch und Irrtum – die alte Programmierformel passt auch zur Digitalisierung von Politik und Verwaltung.
Auf diesem Weg soll es nun weitergehen, versprach der zuständige Justizminister Beat Jans am Abstimmungssonntag. Die Kritik an der aktuellen Vorlage soll bei der Verordnung über die E-ID berücksichtig werden. Dazu gehören insbesondere die Freiwilligkeit ihrer Anwendung, die Einschränkung von kommerziellen Nutzungen und der Überidentifikation bei Anmeldungen. Das knappe Ja mag Warnung genug sein, dass die Punkte berücksichtigt werden, eine kritische Öffentlichkeit bleibt weiterhin nötig. Bloss, was genau heisst «kritisch»?
In dieser Hinsicht bleibt der zurückliegende Abstimmungskampf zwiespältig. Sicher ist der Allerweltssatz zutreffend, dass sich im Ergebnis eine Skepsis der Bevölkerung gegenüber der Digitalisierung zeige. Doch hat der Abstimmungskampf selbst zu dieser Skepsis beigetragen. Zwar waren fast alle Parteien für die Vorlage, glänzten aber bis auf die Grünen und die Grünliberalen durch Abwesenheit. Berechtigte kritische Einwände wurden von den Befürworter:innen bisweilen nonchalant abgekanzelt.
Noch problematischer verhielten sich allerdings die Gegner:innen, eine unheilige Allianz aus Jung-SVP, Corona-Massnahmengegner:innen und fahnenflüchtigen Piratenparteimitgliedern. Sie malten, durchaus auch in einem linken Vokabular, die Gefahr eines Big-Brother-Staates an die Wand, das rechte Publikum wurde auf den Abstimmungsplakaten symbolisch von einer Datenkrake umgarnt. Einige Argumente waren angesichts der Vorlage schlicht überzogen, etwa ein drohendes Social-Scoring-System wie in China.
Die ganze Diskussion hatte bisweilen etwas Bizarres. Es entstand der Eindruck, als ob das Internet erst morgen erfunden würde. Dabei dienen die meisten User:innen mit ihrer Datenspur längst Techkonzernen zu, die in den USA mit einer autoritär agierenden Regierung kooperieren. In diesem Umfeld kann eine demokratisch ausgehandelte E-ID im Gegenteil ein Stück Sicherheit zurückbringen. Wie ihre grösste Chance sowieso in der Stärkung der Demokratie liegt.
Ausgelöst durch kommerzielle Firmen und abnehmendes freiwilliges Engagement steckt das Unterschriftensammeln in einer tiefen Krise. Hier kann die E-ID Abhilfe schaffen, wenn nun wie vom Parlament beschlossen Probebetriebe zum elektronischen Sammeln starten. Trial and error – das Motto passt auch dazu ganz gut.