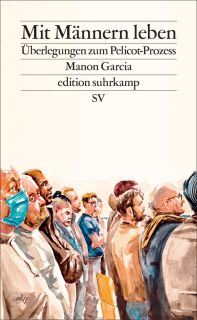«Mit Männern leben»: Auf dem Trümmerfeld männlicher Sexualität
In einem neuen Buch reflektiert die Philosophin Manon Garcia anhand des Prozesses um die vielfach vergewaltigte Gisèle Pelicot die Normalisierung der Gewalt gegen Frauen.
Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht: Im Berufungsprozess vergangene Woche erhielt ein wegen Vergewaltigung an Gisèle Pelicot verurteilter Täter eine höhere Strafe als in erster Instanz – statt neun muss er nun zehn Jahre in Haft. Der 44-jährige H. D. ist einer von 51 verurteilten Tätern, die mit Dominique Pelicot Kontakt über eine Plattform aufgenommen hatten, auf der er seine Frau für Sex angeboten hatte.
Diese zwischen 26 und 74 Jahre alten Männer haben die mit Schlafmitteln betäubte Frau zum Teil mehrmals und oft über Stunden vergewaltigt, während sie dabei von Dominique Pelicot gefilmt wurden. So auch H. D. Und obwohl sich dieser nachweislich an der schlafenden Frau vergangen hat, behauptet er von sich, kein Vergewaltiger zu sein, weil er keine Gewalt angewendet habe. Deswegen hatte er das Urteil weitergezogen.
«Normale» Männer
So mag das verschärfte Urteil ein positives Verdikt sein – dass der verurteilte Täter allerdings die Unverfrorenheit hatte, überhaupt in Berufung zu gehen, hinterlässt einen fassungslos. Seine Argumentation als Verwirrungen eines realitätsfremden Einzelnen abzutun, wäre zu einfach. Denn sie entsprach jener, derer sich die Verteidiger:innen der 51 Täter bereits im ersten Prozess bedient hatten: Immer wieder behaupteten sie, die Täter entsprächen nicht dem Typus des «sexuellen Missbrauchstäters» – ja, sie seien sogar selber Opfer Dominique Pelicots. «Sie haben vielleicht eine Vergewaltigung begangen, aber das macht sie noch nicht zu Vergewaltigern», fasst die Philosophin Manon Garcia dieses Selbstverständnis zusammen.
Die Französin, die in Berlin Professorin ist, hat im vergangenen Jahr den Pelicot-Prozess in Avignon begleitet. Das daraus resultierende Buch «Mit Männern leben» ist eine Mischung aus präzisen Prozessbeobachtungen, schonungsloser Selbstbefragung und philosophischer Reflexion darüber, was dieser Prozess über unsere Gesellschaft offenlegt. Dabei richtet Garcia den Blick nicht auf den Haupttäter, sondern auf die 51 Mitangeklagten – auf jene «normalen» Männer also, als die sie von ihren Verteidiger:innen dargestellt wurden. Diese Konzentration auf das Normale, auf diese angeblich durchschnittlichen Männer und ihre Verteidigungsstrategien, macht das Buch so erschütternd und wichtig.
Eine Kernfrage, die Garcia umtreibt, lautet: «Wie kann man das Böse, um das es in diesem Prozess geht, verstehen, wenn diese Männer meinen, sich nichts vorzuwerfen zu haben, wenn ihre Lebenspartnerinnen an ihrer Seite bleiben, wenn ihre Anwält:innen so überzeugend das Fehlen einer kriminellen Absicht geltend machen?»
In ihrem Buch bezieht sie sich auf Hannah Arendts «Banalität des Bösen» und verwandelt diese «banalité du mal» kurzerhand in eine «banalité du male» (Banalität des Männlichen). Allerdings kreisen Garcias Überlegungen weniger um die Banalität als die Normalität oder, präziser gesagt, die Normalisierung dieser Verbrechen. Die Täter wurden alle psychologisch abgeklärt, sie sind im Vollbesitz ihrer psychischen Fähigkeiten. Garcia stellt sich nun die Frage, ob das im Umkehrschluss bedeute, dass diese Männer normal seien. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, was bedeutet das dann für die Frauen, für unsere Gesellschaft, für das Zusammenleben sowie für die Liebe und die Sexualität zwischen Mann und Frau? «Wie kann man auf dem Trümmerfeld, das die männliche Sexualität darstellt, noch etwas aufbauen?», schreibt sie.
Mangelndes Schuldeingeständnis
Tatsächlich liefert Garcia kaum Antworten, viele ihrer Analysen sind auch nicht neu. Doch sie zeigt anschaulich, wie diese Normalisierung sexueller Gewalt vor Gericht wie durch ein Brennglas sichtbar wird – und wie hinter den Verteidigungsstrategien, der fehlenden Selbstreflexion und dem mangelnden Schuldeingeständnis der Männer eine misogyne und patriarchale Gesellschaft aufscheint.
Garcia spricht hierbei vom «kulturellen Gerüst der Vergewaltigung» und greift damit auf einen Begriff der neuseeländischen Psychologin Nicola Gavey zurück: «Alle, insbesondere Männer, nehmen an Ritualen teil, bejahen Werte und schätzen Verhaltensweisen, die dazu beitragen, dass es möglich ist, dass normale Männer losziehen und eine Frau vergewaltigen, die sie nicht kennen und die sich offensichtlich im Koma befindet.»
Der erste Mythos, auf dem dieses kulturelle Gerüst beruht, ist laut Garcia die Erzählung der sexuellen Notlage, auf die während des Pelicot-Prozesses mehrmals zurückgegriffen wurde: Männer hätten ständig Lust auf Sex, was dazu führe, dass ihr Hirn manchmal ausgeschaltet sei. Ein Verteidiger zitierte den 1988 verstorbenen Komiker Pierre Desproges: «Gott hat dem Mann ein Gehirn und ein Geschlechtsorgan gegeben, aber nicht genügend Blut, um beide zu versorgen.» Dadurch wird der Täter als Opfer seiner eigenen Triebe dargestellt, gegen die er angeblich machtlos ist.
Dieser Mythos wiederum stützt sich auf einen weiteren: den Glauben nämlich, dass Männer ein Recht auf Sex hätten. Mehrere Täter im Fall Pelicot rechtfertigten ihre Gewalttaten damit, dass sie keinen Sex mehr mit ihren Frauen hätten – als ob Sex und Vergewaltigung austauschbar wären, wie Garcia kommentiert. Einige der Täter betrachteten sich auch deswegen frei von jeder Schuld, weil der Mann von Gisèle Pelicot mit seiner Frau machen dürfe, was er wolle: «Die Normen der Männlichkeit und Weiblichkeit hindern die Männer daran, Frauen als Subjekte zu sehen, als Mitmenschen, die sie als solche lieben und anerkennen können», schreibt Garcia.
Warum hat keiner der Männer Anzeige erstattet, nachdem er Pelicots Post gesehen hatte oder bei ihm gewesen war? Und warum hat sich Pelicot so sicher gefühlt, dass ihm nichts passieren würde? Garcia spricht hier von «Brüderlichkeit statt Gerechtigkeit»: Männer würden sich mit anderen Männern solidarisieren, nicht mit den Frauen. Er könne sich keine Sekunde in die Lage von Frau Pelicot versetzen, so einer der Täter vor Gericht.
Schliesslich greift Garcia den Begriff der «himpathy» der Philosophin Kate Manne auf, das übermässige oder unangemessene Mitgefühl mit Männern, insbesondere dann, wenn sie Frauen Schaden zugefügt haben. Man finde ständig mildernde Umstände für straftätige Männer, schreibt Garcia, betone, dass sie gute Familienväter seien, gute Freunde – im Fall des Täters L. B. etwa auch, dass er gute Veranden zu konstruieren verstehe. Als ob sie deshalb nicht Vergewaltiger sein könnten.
Auch die Berichterstattung über den Berufungsprozess widerspiegelt diese Haltung. So schreibt ein Journalist der «Berliner Morgenpost» über H. D.: «Der 44-jährige Bauarbeiter hat eine Frau und ein trisomes Kind. Er entspricht nicht so ganz dem Bild eines brutalen Schänders.» Wer, wenn nicht ein Mann, der eine mit Schlafmittel ruhiggestellte Frau vergewaltigt, entspricht dann diesem Bild? Was muss ein Mann noch tun, um diesem Bild zu entsprechen? Und wie sähe dieses Bild denn aus?
Jede Frau ein «Vor-Opfer»
Solche Fragen drängen sich bei der Lektüre des Buches auf, das einen sehr traurig hinterlässt. Garcia führt einem den bodenlosen Hass vor Augen, den Männer gegenüber Frauen fühlen und ausleben. Sie schliesst denn auch mit dem bescheidenen Wunsch: «Ein wenig, nur ein wenig. Dass sie uns ein wenig lieben, damit wir sie weiter lieben können.»
Ausserdem erinnert das Buch daran, dass jede Frau ein «Vor-Opfer» einer Vergewaltigung ist, dass wir mit der Gewissheit aufwachsen, jederzeit vergewaltigbar zu sein – und dass die grösste Gefahr von unseren Nächsten ausgeht. Und wenn es uns tatsächlich passiert, heisst das noch lange nicht, dass wir auch als Opfer betrachtet werden, denn: «Die Schuld liegt auf jeden Fall bei uns.»
Auch die Scham liegt weiterhin auf der Seite der Opfer. Im Berufungsprozess sagte Gisèle Pelicot zu H. D.: «Sie kommen durch die Tür, wann habe ich Ihnen meine Zustimmung gegeben? Sie vergewaltigen mich, zwei Stunden sind eine lange Zeit, ich schäme mich für Sie.» Es wird noch dauern, bis die Scham, wie Gisèle Pelicot im letzten Prozess forderte, endlich die Seite wechselt.