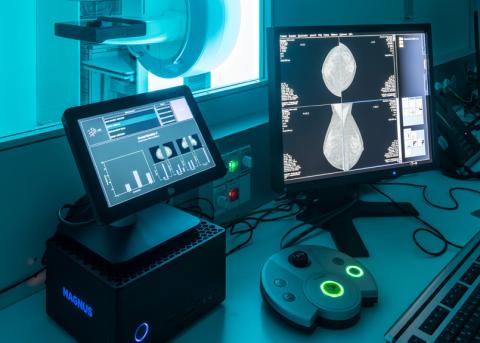Immer und ewig: Arzt mit empathischem Blick: Oliver Sacks (1933–2015)
Die PatientInnen sitzen vor dem Fernseher und lachen sich kaputt. Sie schauen sich eine Rede des US-Präsidenten an. Und verstehen nichts – sie leiden an Aphasie, einer Sprachstörung, die von einer Schädigung der linken Hirnhälfte herrührt. Sie verstehen die Bedeutung der Wörter nicht mehr. Doch das ist nicht der Grund, warum sie lachen: Viele AphasikerInnen entwickeln enorme Fähigkeiten, Sprache aus dem Kontext zu begreifen, aus dem Tonfall, der Mimik und Gestik. Und das alles passt beim Präsidenten einfach nicht zusammen.
Eine Patientin lacht nicht. Ihr «Schaden» ist quasi umgekehrt: Infolge eines Tumors in der rechten Hirnhälfte versteht sie keinerlei Anspielungen, Metaphern oder Ironie. Dafür achtet sie umso genauer auf die Wortwahl. Auch sie ist von der Rede irritiert: «Entweder ist er hirngeschädigt, oder er hat etwas zu verbergen.»
Diese kurze Geschichte, die Oliver Sacks (1933–2015) im Buch «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte» erzählt hat, ist typisch für den englischen Arzt und Schriftsteller, der meist in den USA lebte. In seinen Texten stellte er die Neurologie auf den Kopf: Die Hirngeschädigten, jene mit den «Defiziten», haben den «Gesunden» oft viel voraus. Ihre Strategien faszinierten Sacks ein Leben lang. Ihm ging es um Menschen, nicht um Fälle, und er begegnete ihnen mit grosser Empathie – schreibend wie als Arzt. Mit der gleichen Neugier analysierte er auch seine eigenen Unfälle und Erleuchtungen: Der drogenerfahrene Medizinstudent, der in einer Geschichte mit einem extrem geschärften Geruchssinn aufwacht, war Sacks selbst.
Die letzten Jahre schrieb er seine Autobiografie, schwamm jeden Tag und fand zum ersten Mal einen Lebenspartner, den Journalisten Bill Hayes. Noch im August erschien sein letzter Zeitungsartikel. Das Ideal eines erfüllten Lebens – Oliver Sacks scheint ihm nahegekommen zu sein. Am 30. August ist er in New York mit 82 Jahren an Krebs gestorben.