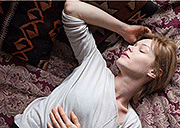Essay: Stützstrümpfe einscannen
Wenn wir zulassen, dass Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Kontrolle die Werte sind, die unser Handeln diktieren, lassen wir unsere wichtigsten und zuverlässigsten Kraftquellen versiegen: die Fähigkeit, empathisch und solidarisch zu sein.

Das Altersheim, in dem ich arbeite, wurde unlängst von einer Immobilienbude übernommen. Aufgekauft. «Wohnen im Alter» ist ein Gebiet mit extremem Wachstumspotenzial. Das verwundert bei den Prognosen zur demografischen Entwicklung nicht. Na gut. Wir haben nun also Big Bosse, die von unserem Kerngeschäft, der Pflege pflegebedürftiger Menschen, null und nichts verstehen, und ich fürchte: sich genauso wenig dafür interessieren. Unsere obersten Vorgesetzten sind keine Heimleiterinnen mit heilpädagogischem, pflegerischem oder gastronomischem Hintergrund, sondern Manager. Wir wurden umstrukturiert. Es gab ein neues Computersystem und viel administrativen Krimskrams und tatsächlich: Ende des Jahres wurden die Zahlen präsentiert. Sie waren schwarz. Gewinn. Ein erfolgreiches Jahr.
Das Pflegeheim hat Gewinn gemacht. Weil da irgendwo Effizienz «hinmaximiert» wurde. (Effizienz!, wie lächerlich sich dieses Wort ausnimmt an einem Ort, wo sich alles – wenn überhaupt – extrem langsam am Rollator oder im Rollstuhl fortbewegt. Und zwar Richtung Stillstand beziehungsweise Tod.) Gewinn also durch mehr Effizienz im Pflegeheim. Das ist krank! Ein Pflegeheim soll keinen Gewinn machen. Dafür ist es doch nicht da! Es sollen da möglichst gut und liebevoll und fachkundig Menschen betreut werden von Pflegerinnen (und hoffentlich immer mehr Pflegern), die für ihre schwere und wichtige Arbeit einen gerechten Lohn ausbezahlt bekommen und genügend Ferien haben, um ihre geschundenen Rücken auszukurieren.
Wer kämpft für die Pflegenden?
Vom Gewinn merken übrigens weder Pflegebedürftige noch Pflegende etwas. Im Gegenteil. Was wegmaximiert wurde, ist die halbe Stunde Zeit, die ich früher hatte, um mit Frau XY ein Lied zu singen oder an einem Sterbebett zu sitzen und mitzuatmen. Also all das, was ein Heim zu einem Ort für Menschen macht. An dieser Stelle kommt jetzt meist: «Ihr müsst euch doch wehren, ihr müsst kämpfen.» Ah ja? Wahrscheinlich müssen wir das. Aber ich finde es nicht richtig, dass wir das müssen. Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind (Ausnahmen schliesse ich hier herzlich in die Regeln mit ein) liebevolle, empathische, unegoistische, geduldige und duldsame Wesen, denen das Wohl anderer vor dem eigenen steht und die die Menschen gern haben. Davon, dass sie so sind, wie sie sind, profitiert die Gesellschaft unglaublich. Es sind friedliche, soziale Menschen. Nicht gierig. Nicht ungeduldig. Sie drängen sich nicht vor und sind den Menschen und ihrer Umwelt gegenüber rücksichtsvoll. Kämpferisch rebellieren, für eigene Belange einstehen und Grenzen setzen gehört nicht so zu den typischen Stärken von Pflegemenschen. Auch ist es nicht unbedingt ihr Ding, clevere Streitschriften zu verfassen und sich öffentlich Gehör zu verschaffen. Darum sollen doch bitte schön andere für sie kämpfen und ihnen bessere Bedingungen aushandeln, andere, die so was besser können. So wie sich die Pflegenden ihrerseits in so vielen Belangen für die Verbesserung der Bedingungen anderer kümmern.
Das können wir besser
Ich habe beim Gemütlichen-Frühstücken-im-Bett-und-dabei-Film-schauen-auf-dem-Laptop mit meiner Tochter die Neuverfilmung von «Annie» geschaut. Der Plot ist simpel. Ein Waisenmädchen begegnet schicksalhaft einem reichen, kaltherzigen Geschäftsmann, stört diesen gewaltig in seinem Karriere- und Geldscheffeltrip, darf ihm dadurch aber gleichzeitig beibringen, dass das Leben mit einem Störenfried viel lustiger ist und man aufs Lässigste über sich hinauswachsen kann, wenn man sich um jemanden kümmert, der Hilfe braucht. Der Geschäftsmann bekommt eine Seele und Annie ein Dach über dem Kopf. Win-win und happy-happy. Jeder zweite Hollywoodfilm erzählt im Kern diese Geschichte. Jedes zweite Kinderbuch.
Wir lieben diese Geschichten. Sie machen uns weinen und trösten uns. Weil etwas wahr ist. Der Mensch ist da am schönsten und am glücklichsten, wo sein Talent, empathisch zu sein, zum Tragen kommt. Das weiss jeder, der schon einmal Mutter war, und jede, die sich schon einmal väterlich um jemanden gekümmert hat. Anderen zu helfen und für sie zu sorgen, ist manchmal hart und ermüdend. Aber es macht auch zufrieden und zuversichtlich. Weil ich, indem ich selber solidarisch bin, die Welt zu einem Ort mache, an dem es Solidarität gibt und wo ich mich folglich nicht so sehr zu fürchten brauche, falls ich mal in Not komme. An diesen Kreislauf glaube ich ganz fest. Und erlebe ihn.
Mir würde es gefallen, wenn landesweit und gesetzlich verordnet Partnerschaften ausgelost würden. Es würden zu allen möglichen Themen Privilegierte mit Unterprivilegierten zusammengelost. Also zum Beispiel bekommt eine Familie mit überdurchschnittlichem Wohnraum eine Obdachlose zugeteilt oder einen Jungen, der keinen Ort zum Flöteüben hat, ein Akademikerinnenpaar einen Analphabeten. Und es würde einfach zur BürgerInnenpflicht gehören, so und so viel Zeit zusammen zu verbringen und Bedürfnisse auszutauschen. Man müsste nicht Freunde werden oder so, es gäbe sicher auch Streitereien, man sollte sich einfach inspirieren und unterstützen und füreinander einstehen. In beide Richtungen. Ich glaube, man könnte auf diese Art und Weise sehr viel Frust und Angst und Leeregefühl abbauen. Und ich glaube, so eine Eins-zu-eins-Lösung wäre sehr viel lustiger und erfrischender als pauschale Solidaritätsabgaben (die trotzdem gerne unbedingt gemacht werden sollen). Pauschallösungen tragen immer die Gefahr in sich, Menschen zu Nummern zu machen. Und das bekommt uns doch so schlecht.
Gefährliche Gewohnheiten
Im Altersheim, in dem ich arbeite, gibt es auch Wohnungen, in denen Leute leben, die keine vollumfängliche Betreuung benötigen. An ihrer Tür ist auf einem Täfelchen ein Strichcode angebracht. Wenn eine Pflegerin die Wohnung betritt, muss sie als Erstes diesen Code mit einem Scanner einlesen und somit die Person erfassen. Dann muss sie die zu erbringende Pflegeleistung, die ebenfalls als Strichcode auf einem Papier aufgeführt ist, einscannen und die Zeiterfassung aktivieren. Nun wird die entsprechende Pflegeleistung (wie etwa Stützstrümpfe anziehen) erbracht und daraufhin die Zeiterfassung gestoppt. Wenn noch eine weitere Leistung erbracht werden soll, geht das Spiel von vorne los.
Recht unappetitlich, nicht wahr? Es sind die Krankenkassen, die diese genauen Abrechnungen verlangen. Aber zu einem pflegebedürftigen Menschen zu kommen und ihn beim Hallosagen erst mal wie ein Produkt an der Kasse einzuscannen, ist nicht fein. Und auch wenn wir alle alles geben, spielerisch und charmant mit diesem System umzugehen und kein grosses Ding daraus zu machen, fürchte ich dennoch, dass diese Gesten mehr mit uns machen, als wir denken.
Mona Petri (38) ist Theater- und Filmschauspielerin, Mutter und Altenpflegerin. Sie kandidiert als eine von 35 Kulturschaffenden auf der Zürcher Liste Kunst + Politik für die diesjährigen Nationalratswahlen.