Big Tech in deinem Körper (6): «Der Computer macht nur Vorschläge, mehr nicht»
Techfirmen dominieren in den USA zunehmend den Gesundheitsmarkt. Was hat das mit der Schweiz zu tun? Viel, sagt Medizinprofessor Johann Steurer. Vor allem, wenn es darum geht, künftige ÄrztInnen vernünftig auszubilden.
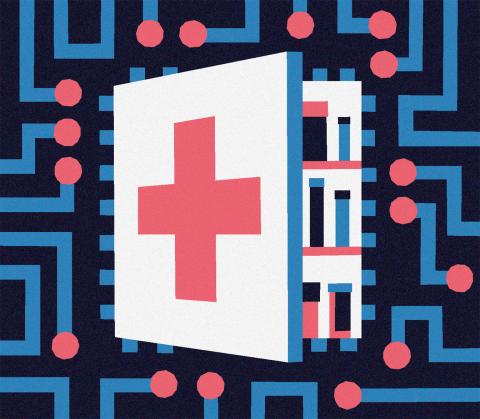
WOZ: Herr Steurer, die grossen Techfirmen wie Google, Amazon oder Facebook drängen in den Gesundheitsmarkt. Das löst düstere Fantasien aus. Dabei hat die Digitalisierung der Medizin doch grosse Fortschritte gebracht.
Johann Steurer: Das glaube ich nicht. Den grossen Durchbruch gibt es in der medizinischen Praxis aus meiner Sicht noch nicht. Das Potenzial für massive Veränderungen ist aber vorhanden – damit muss man sich auseinandersetzen.
Haben sich die ärztlichen Diagnosen nicht verbessert?
Klar, wenn jemand im Engadin einen Unfall hat, kann der Arzt das Röntgenbild nach Zürich schicken, damit noch ein Spezialist drauf schaut. Das war vor dreissig Jahren nicht möglich und ist sicher eine Erleichterung. Aber dass sich wegen der Digitalisierung Diagnose oder Therapie massiv verändert hätten, das sehe ich nicht – vielleicht in ganz kleinen Bereichen.
Was bringt denn die Digitalisierung?
Es bedeutet ja nichts anderes, als dass man Daten, die vorhanden sind, in digitaler Form ablegt. Damit werden sie versendbar und bearbeitbar. Das wird vieles verändern, von der Administration über die Verwaltung der Patientendaten bis hin zur Forschung – vor allem aber auch die Arbeit der Mediziner selber. Die intellektuelle Leistung, die sie erbringen, wird in Zukunft zum Teil vom Computer übernommen. Das gibt uns Ärzten sehr zu denken. Wir halten uns ja für sehr gescheit; wenn plötzlich Maschinen unsere intellektuellen Arbeiten erledigen, führt das zu einer Kränkung. Aber das wird kommen, egal ob wir das wollen oder nicht.
Wie gehen Sie damit um?
Ich bin in die Organisation des Medizinstudiums involviert. Da versuchen wir, den Studierenden beizubringen: «In Zukunft werden Algorithmen einen Teil eurer Arbeit übernehmen – aber glaubt ja nicht alles, was die sagen.» Nur ist es eine grosse Herausforderung, bei einem konkreten Untersuchungsergebnis zu sagen, in diesem Fall stimmt, was der Algorithmus errechnet hat, im anderen nicht. Wie seriös wurde der Algorithmus entwickelt? Das wissen wir oft nicht. Und das ist nicht banal! Zurzeit reden alle von Big Data und Machine Learning. Es gibt die Vorstellung, unendlich viele Daten würden in eine Maschine hineingeschüttet und hinten komme irgendetwas Vernünftiges heraus. So ist das nicht. Big Data allein löst kein Problem. Der Computer ist keine wahrheitsverkündende Maschine.
Was dann?
Meine Vorstellung von der Medizin der Zukunft ist die: Ein Patient sagt, er habe Kopfweh. Der Computer bietet dem Arzt ein Frageraster an. Die Fragen geht dieser mit dem Patienten durch. Der Computer gibt ein erstes Ergebnis im Sinn von: Am wahrscheinlichsten ist, dass der Patient ein gewöhnliches Kopfweh hat, es besteht aber die geringe Wahrscheinlichkeit, dass etwas Ernsthaftes dahintersteckt. Der Computer stellt anschliessend noch einige präzisierende Fragen. Am Schluss spuckt er aus: Die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Ernsthaftes vorliegt, ist praktisch null. In Zukunft wird er auch gleich noch empfehlen, welche Therapie für diesen Patienten die wirksamste ist.
Der Computer entscheidet also doch über die Therapie.
Nein. Eben gerade nicht, auch wenn die Leute das glauben. Das Einzige, was er tut: Vorschläge machen. Die Algorithmen werden dabei zwar eine grosse Rolle spielen, aber es braucht den Arzt, der sie interpretiert und dem Patienten erklärt. Entscheiden, welche Therapie angewendet wird, muss immer noch der Patient zusammen mit dem Arzt.
Heute lesen Computer Röntgenbilder von Coronakranken schneller als Radiologen. Braucht es in Zukunft überhaupt noch Radiologen?
Das ist eine Frage, mit der wir uns intensiv beschäftigen: Wie bilden wir Leute aus, die gescheiter sind als der Computer? Gescheiter als der Computer wird man nur mit Erfahrung. Da beginnt das Problem. Erfahrung gewinnt man, indem man die einfachen Probleme abarbeitet. Diese Probleme löst aber der Computer effizient und schnell. Dieses Übungsfeld fällt für die angehenden Radiologen also weg. Wie bilden wir dann die Leute aus? Wie bringen wir die Leute auf den Wissensstand oder Erfahrungsstand, wenn ein Teil der ganz simplen Diagnose von den Maschinen übernommen wird?
Wie lösen Sie das Dilemma?
Das wissen wir noch nicht, da müssen wir noch nachdenken.
Google verwaltet in den USA schon für viele Gesundheitsnetzwerke die Patientendaten. In der Schweiz gibt es immer noch kein elektronisches Patientendossier. Was könnte man von Google lernen?
Das Grundproblem in der Schweiz ist, dass die medizinischen Daten in einer Form erfasst werden, mit der man danach praktisch nichts anfangen kann. Sie werden nicht strukturiert erfasst und nicht standardisiert abgelegt. Es gibt um die zehn Softwarefirmen, die für Arztpraxen Programme für die Verwaltung von Patientendaten anbieten. Die haben kein grosses Interesse, dass es ein einheitliches System gibt, weil es sie nicht mehr brauchen würde, sobald alle Daten einheitlich erfasst würden. Der Bund hat schon vor zehn Jahren landesweite Standards gefordert. Die gibt es aber bis heute nicht. Google ist nicht mein Freund, aber Google sagt: Wir machen das! Wenn die anderen keine Standards setzen, setzen wir sie. Google macht das aber nicht aus altruistischen Gründen. Wissenschaftliches Wissen in der Medizin würde damit privatisiert.
Was wäre problematisch daran?
Wenn wir in der Forschung Wissen generieren, dann publizieren wir das und stellen es der Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Es findet ein offener Diskurs statt. Ist nun aber dieses Wissen privatisiert, legen die Unternehmen auch ihre Algorithmen, die daraus entstanden sind, nicht mehr offen. Dann wird es ganz schwierig. Im Medizinstudium versuchen wir, den Studentinnen und Studenten ja beizubringen, wie sie mit den Algorithmen umgehen sollen. Sie müssen beurteilen können, ob das, was am Ende aus der Maschine rauskommt, Hand und Fuss hat. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, weil die Big-Tech-Firmen nicht sagen, auf welchen Grundinformationen ihre Algorithmen beruhen, dann … (seufzt)
… wird es richtig ungemütlich.
Genau. Mit Patientendaten können diese Firmen natürlich wahnsinnig viel Geld verdienen. Google könnte zu einer Pharmafirma gehen und sagen: Wir haben von 50 000 Patienten die Krankenakten, wie viel zahlt ihr dafür? Patienten können ihre Daten der Pharmaindustrie verkaufen, damit habe ich kein Problem. Wenn bei diesem Geschäft die wissenschaftliche Medizin aber total ausgebootet wird, wird es heikel.
Wenn alle Patientendaten zentral gespeichert werden, haben Hacker es leicht, an die Daten heranzukommen. Sie klauen oder verschlüsseln sie, um Geld zu erpressen. In der Zwischenzeit sterben Leute, weil die Ärzte nicht mehr auf die Patientendaten zugreifen können.
Das sind zwei Aspekte. Wenn im Unispital die IT aussteigt, ist das katastrophal. Ohne Zugriff auf den Computer geht nichts. Der zweite Aspekt wäre, dass Hacker die Daten vom Server holen würden. Es gibt derzeit in Finnland einen grossen Skandal, weil Hacker sensible psychiatrische Daten von Tausenden von Personen abgesaugt haben. Damit können sie jetzt die Leute erpressen. Das ist ein grosses Problem. Aber es müsste doch möglich sein, das heute sicher zu machen.
Wie könnte eine demokratische Digitalisierung der Gesundheitsdaten aussehen?
Ich würde den Vorschlag von Ernst Hafen, der an der ETH lehrt, umsetzen. Hafen hat schon vor zehn Jahren gesagt: Wir gründen eine Genossenschaft, die, demokratisch organisiert, unsere Gesundheitsdaten verwaltet. Ihre Aufgabe ist es, das technisch so sicher wie möglich zu machen. Jeder Patient wird selber entscheiden, wem er Zugriff auf seine Daten gewährt. Er kann sie Firmen – gratis oder gegen Bezahlung – für die Forschung zur Verfügung stellen, wenn er das möchte. Die Idee finde ich sehr gut. Hafen selber ist langsam zermürbt, weil es nicht vorwärtsgeht. Wahrscheinlich sind die Gegeninteressen, die bremsen, zu stark.
Führen die vielen verfügbaren Daten vermehrt zu individuell zugeschnittenen Therapien? Oder wird es die nur für Reiche geben?
Individualisierte Medizin wird sicher teurer. Aber eigentlich meint man damit ja etwas anderes: Nehmen wir das Beispiel der Antidepressiva. Salopp gesagt, geht man heute nach dem Trial-and-Error-Prinzip vor. Man probiert das erste Medikament aus. Das hilft nicht. Also nimmt man das zweite, das hilft auch nicht. Danach probiert man ein drittes und mogelt sich irgendwie durch. Wenn ich nun aufgrund von individuellen Daten vorhersagen könnte, dass Medikament A bei Patient Müller mit grosser Wahrscheinlichkeit besser als Medikament B wirkt, wäre das ein Gewinn, weil er sonst nur sinnlos unter den Nebenwirkungen leidet. Die individualisierte Medizin wird derzeit aber stark überschätzt. Meine bösartige Bemerkung dazu: Das Gebiet wird von den Genetikern total okkupiert. Unbestritten ist die Genetik ein Teil davon, aber es gibt andere Faktoren, die ebenso einen Einfluss auf den Verlauf einer Krankheit haben – zum Beispiel, wie oft sich ein Patient bewegt, wie viele soziale Kontakte er hat, ob er oder sie depressiv verstimmt oder optimistisch unterwegs ist.

Mit den individualisierten Therapien dürfte es verstärkt zu einer Entsolidarisierung kommen. Die Leute werden sagen: Wozu soll ich die Therapie eines Rauchers oder eines schwer Übergewichtigen bezahlen, wenn die sich nicht vernünftig verhalten?
Das ist eine Frage, die wahrscheinlich im Untergrund überall rumort. Sollte sie einmal an die Oberfläche kommen, stellt sich die Frage, ob wir mit dem Solidaritätsprinzip fortfahren oder ob wir alles individualisieren – dann nehmen wir hin, dass zehn oder zwanzig Prozent der Bevölkerung durch alle Maschen fallen werden. Das wollen wir hoffentlich nicht.
Johann Steurer
Der Zürcher Medizinprofessor Johann Steurer (66) leitete das Horten-Zentrum an der medizinischen Fakultät, das die patientenorientierte Forschung fördert. Heute koordiniert er die gemeinsame Medizinausbildung zwischen der Universität Zürich sowie den Universitäten in Luzern und St. Gallen und beschäftigt sich mit der Frage, wie man die Digitalisierung vernünftig ins Medizinstudium integriert.
Die Serie
In der Reihe «Big Tech in deinem Körper» nimmt die WOZ die US-Konzerne unter die Lupe, die die Digitalisierung mit Macht vorantreiben. Nach dem Auftakt in WOZ Nr. 35/2020 erschienen Beiträge zu Apple (Nr. 37/2020 ), Google (Nr. 39/2020 ), Microsoft (Nr. 41/2020 ) und Facebook (Nr. 43/2020 ). Mit diesem Interview beenden wir die Serie.




