Big Tech in deinem Körper (1): Keine Angst, Google will doch nur deine Gesundheit
Die Konzerne aus dem Silicon Valley investieren Milliarden, um den globalen Gesundheitsmarkt mittels Technologie umzukrempeln. Die Digitalisierung dieses Bereichs ist nicht nur datenrechtlich problematisch.
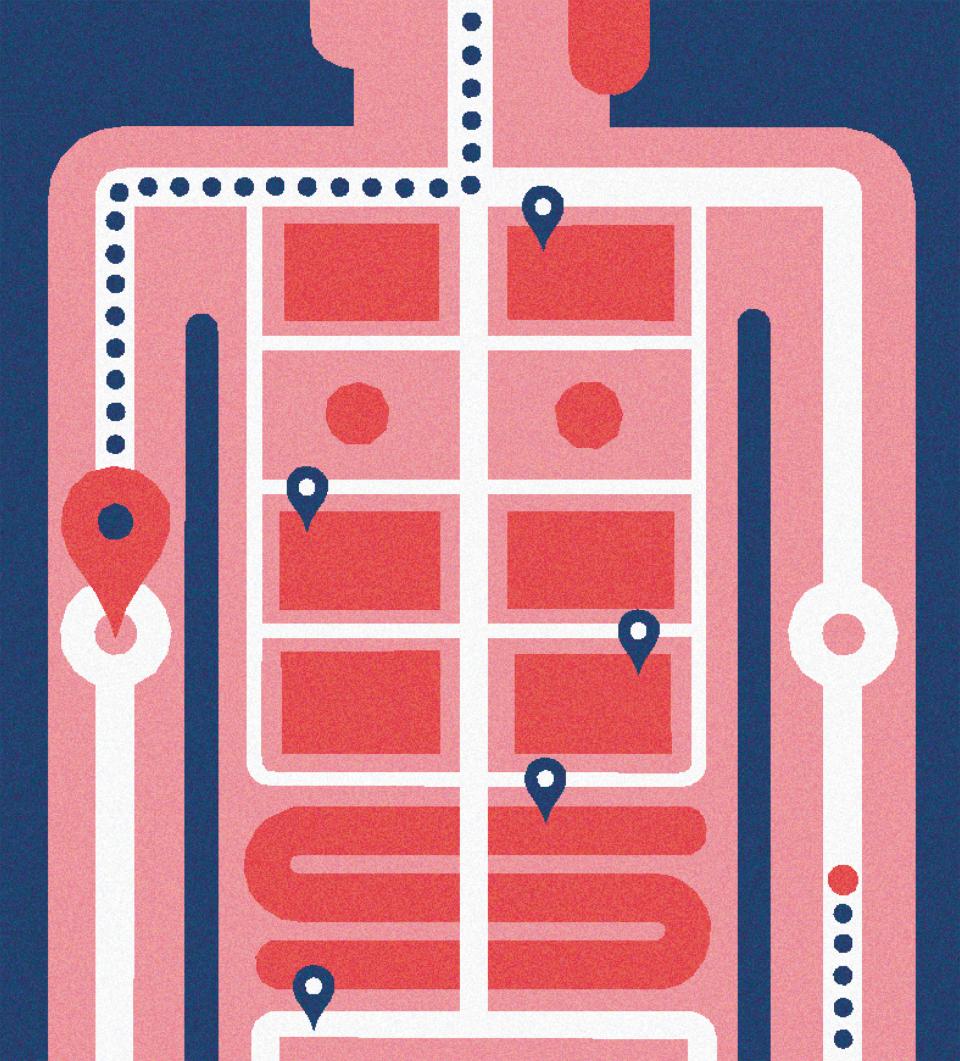
Die WettbewerbshüterInnen scheuten die grossen historischen Vergleiche nicht: «Unsere Gründerväter wollten sich nicht einem König unterwerfen, genauso wenig sollten wir uns den Herrschern der Internetwirtschaft unterwerfen», sagte David Cicilline, demokratischer Politiker und Vorsitzender des Antitrust-Ausschusses des US-Kongresses, dem Ende Juli vier der wichtigsten Köpfe aus dem Silicon Valley Rede und Antwort stehen mussten. Das Gremium hatte für seine Ermittlungen über potenzielle Kartellrechtsverstösse Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon) und Sundar Pichai (Alphabet/Google) vorgeladen und mit teils scharfer Kritik konfrontiert, etwa was ihren Umgang mit Drittanbietern oder aufkeimender Konkurrenz angeht (siehe WOZ Nr. 32/2020 ).
Möglich, dass das aufsehenerregende Hearing eine Zeitenwende für jene Branche markiert, die die globale Ökonomie in den vergangenen beiden Jahrzehnten wie keine andere bestimmt hat, und dass die Techbranche bald schon neuen Regulierungen unterworfen wird. Selbst eine Zerschlagung der Internetmonopolisten wird mittlerweile diskutiert – immerhin stellt die Macht der Konzerne nicht erst seit kurzem ein Problem dar. Die Ökonomin Shoshana Zuboff etwa, eine der international renommiertesten KritikerInnen von Big Tech, spricht von einem immer weiter um sich greifenden «Überwachungskapitalismus», der eine «zutiefst antidemokratische soziale Kraft» darstelle, der Menschen zu «dressieren» und die modernen Gesellschaften unter eine neue Form der «Tyrannei» zu zwingen versuche. Allzu falsch läge der Antitrust-Beauftragte Cicilline mit seiner historischen Analogie demnach nicht.
Run auf den Gesundheitsmarkt
Besonders greifbar wird die Bedrohung, die von Big Tech für die Autonomie des Einzelnen wie auch für öffentliche Güter ausgeht, in einem Geschäftsfeld, dem die Branche seit einiger Zeit schon besondere Aufmerksamkeit schenkt: der Gesundheitsindustrie. Um dort Fuss zu fassen, investierte das Silicon Valley in den vergangenen Monaten Milliarden. Im November machte beispielsweise Google Schlagzeilen mit seinen Übernahmeplänen für Fitbit. Das kalifornische Unternehmen vertreibt Fitnesstracker und Smartwatches, mit denen KundInnen ihre Trainingseinheiten aufzeichnen und auswerten können – was Fitbit wiederum mit Daten über die NutzerInnen versorgt: Herzfrequenz, Bewegungsdaten, Ernährungsgewohnheiten. Für den Deal nahm Google rund zwei Milliarden US-Dollar in die Hand. Wenig später machte das «Wall Street Journal» publik, dass der Konzern überdies PatientInnendaten von über 2600 Spitälern in den USA gesammelt hatte – ohne das Wissen der Betroffenen. Diese Daten sollten Googles «Project Nightingale» zugutekommen, das mithilfe selbstlernender Algorithmen Hinweise auf Diagnosen und die richtige Medikation Erkrankter liefern will.
Aber nicht allein Google, sondern auch die anderen Techgiganten sind auf diesem Feld aktiv. So verkündete Microsoft vergangenen Herbst, künftig mit dem Pharmakonzern Novartis zu kooperieren, um die Potenziale künstlicher Intelligenz unter anderem für die Herstellung von Medikamenten auszuloten. Amazon wiederum kaufte für 750 Millionen Dollar die Onlineapotheke PillPack auf und etablierte kurz darauf einen umfassenden digitalen Gesundheitsservice für die eigenen MitarbeiterInnen in den USA.
Auf den ersten Blick mag das überraschen, weil Gesundheit nicht unbedingt ein Themenkomplex ist, den man intuitiv mit einem Softwarehersteller wie Microsoft oder einem Konzern wie Amazon assoziieren würde, der ja in erster Linie als gigantisches Onlineversandhaus in Erscheinung tritt. Dass sich Big Tech dennoch brennend für unsere Körper interessiert, hat einen profanen Grund: Der Gesundheitsmarkt ist einer der wirtschaftlichen Zukunftsmärkte schlechthin. So schätzt die «Financial Times», dass die globale Gesundheitsindustrie gigantische 8,7 Billionen US-Dollar wert ist.
Also forcieren die Techkonzerne die Digitalisierung der Gesundheitsdienstleistungen, um sich ein möglichst grosses Stück dieses gewaltigen Kuchens zu sichern. «In fast allen OECD-Staaten hat man es mit einer alternden Bevölkerung zu tun – das bedeutet, dass da ein Markt ist, der aus unternehmerischer Sicht natürlich sehr interessant ist», sagt Philipp Staab, der an der Berliner Humboldt-Universität zur Soziologie der Arbeit der Zukunft forscht und vergangenes Jahr bei Suhrkamp die Studie «Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit» veröffentlicht hat. Der Wissenschaftler sieht auf dem Gesundheitsmarkt zudem zwei weitere wichtige Faktoren am Wirken: Einerseits sei seit den sechziger Jahren der «säkulare Aufstieg von Gesundheitskulturen» zu beobachten gewesen – immer mehr Menschen kümmern sich immer intensiver um das eigene Wohlbefinden, gehen ins Fitnessstudio oder besuchen Yogakurse und sind daher auch potenzielle KundInnen digitaler Anwendungen, die die Sorge um die eigene Wellness technisch unterstützen. Zum anderen sei der Gesundheitsbereich aus Sicht der politischen Ökonomie besonders interessant: «Das ist ein Feld, in dem die Nachfrage von der öffentlichen Finanzierung gewährleistet wird. Daher ist diese Nachfrage nicht konjunkturabhängig, während in anderen Bereichen bei wirtschaftlichen Einbrüchen schnell mal die Werbeanzeigen wegbrechen», sagt Staab.
Das Virus und die Digitalisierung
Durch die Coronapandemie hat die Digitalisierung zudem einen weiteren Schub erhalten, weil auch öffentliche Einrichtungen beispielsweise Sprechstunden von der Offline- in die Onlinewelt verlegten, um Spitäler und Arztpraxen zu entlasten und eine Weiterverbreitung des Virus in überfüllten Wartezimmern zu verhindern. In Grossbritannien hat das staatliche Gesundheitssystem NHS sogar eine Partnerschaft mit Amazon, Microsoft und dem Softwarehersteller Palantir abgeschlossen, um Datenmodelle zu entwickeln, die eine effiziente Verteilung von knappen Krankenhausbetten, Beatmungsgeräten und knappem Personal ermöglichen sollen. Und auch in den USA sicherte sich Palantir – das zwar von einem ehemaligen Philosophiestudenten mit Hippie-Habitus geleitet wird, aber immer wieder wegen seiner Zuarbeit für Geheimdienste und auch Grenzschutzbehörden in der Kritik stand – einen millionenschweren Deal mit dem dortigen Gesundheitsministerium.
Tatsächlich sehen nicht nur Techkonzerne im Gesundheitsmarkt ein enormes Digitalisierungspotenzial, auch die in Genf ansässige Weltgesundheitsorganisation WHO will mithilfe von Technologie das Wohlergehen von Milliarden Menschen verbessern. Im jüngsten Entwurf für die globale digitale Gesundheitsstrategie argumentiert die WHO, dass «die innovative Nutzung von digitalen und modernsten Informationstechnologien» ein «wesentlicher Faktor» sei, um die weltweite Gesundheitsversorgung zu stärken. Zu denken wäre dabei an virtuelle Pflege, Big-Data-Analysen, Wearables und Gadgets oder Plattformen zum Datenaustausch. Da beim Versuch, dergleichen Zukunftsvisionen zu realisieren, kaum ein Weg an den marktbeherrschenden Techkonzernen vorbeiführen dürfte, werden sich diesen noch weitere Gelegenheiten bieten, wie in Grossbritannien mit staatlichen Institutionen Partnerschaften einzugehen.
Im Süden ist es leichter
Genau darin besteht allerdings eine wesentliche Problematik der skizzierten Entwicklung: Big Tech drängt derzeit mit Macht in einen gesellschaftlichen Bereich, der eigentlich in die öffentliche Hand gehört und in dem private Akteure allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen sollten. Dass die Digitalkonzerne gerade in Staaten mit einem unterfinanzierten Gesundheitssektor wie Grossbritannien oder den USA leichter Fuss fassen, ist kein Zufall – Microsoft etwa engagiert sich auch in der Entwicklung von Technologien zur Bekämpfung von Lepra, einer Krankheit, die praktisch ausschliesslich im Globalen Süden ein Problem darstellt. In ihrem Selbstverständnis dürften die Konzerne damit dort, wo der Staat versagt oder über nicht ausreichend Ressourcen verfügt, einen Beitrag zum Wohlergehen aller leisten. Umgekehrt aber wird so ein öffentliches Gut wie die Gesundheitsfürsorge abhängig vom Gutdünken privater Wirtschaftsakteure, die gewiss nicht aus blosser Menschenliebe handeln, sondern weil sie sich zumindest mittelfristig Profite ausrechnen.
Zwar habe die Coronakrise erfreulicherweise den Staat «als Finanzierer öffentlicher Güter» zurückgebracht, sagt Staab. «Gleichzeitig aber ist der Staat nach dreissig oder vierzig Jahren Neoliberalismus viel zu ausgeblutet, als dass er diese Krise ohne private Dienstleister hätte bewältigen können. Die Vorstellung etwa, der Staat könne plötzlich selbst im Bereich der Softwareentwicklung die Aufgaben der privaten Akteure übernehmen, muss man sich abschminken», sagt der Soziologe. Trotzdem habe in Deutschland etwa die Entwicklung der Corona-Tracing-App, bei der der Softwarehersteller SAP eng mit dem Kanzleramt zusammenarbeitete, gezeigt, dass eine «politische Einbindung» bestimmter privater Dienstleister sehr wohl möglich sei.
Sprechstunde bei Amazon
Schon Monate vor der Pandemie indes hat Amazon den Dienst «Amazon Care» ins Leben gerufen. Dieser Gesundheitsservice richtet sich vorerst zwar nur an die MitarbeiterInnen des E-Commerce-Riesen, der mittlerweile freilich zu den grössten Arbeitgebern in den USA zählt; gleichwohl spricht viel dafür, dass es sich dabei um einen Testlauf handelt, der zu einem späteren Zeitpunkt auch auf die Gesamtbevölkerung ausgeweitet werden könnte.
Amazon Care veranschaulicht, wie man sich die schöne neue Welt der digitalen Gesundheitsfürsorge ungefähr vorzustellen hat: Via App kann man sich per Text- oder Videochat Rezepte verschreiben und in Gesundheitsfragen beraten lassen, etwa wenn es darum geht, welche Impfungen vor einer Ferienreise nötig sind oder was bei kleineren Verletzungen im Haushalt zu tun ist. Falls nötig, arrangiert die App den Hausbesuch einer medizinischen Fachkraft, zudem lassen sich Medikamente bestellen. Dass dabei sehr sensible Daten generiert und erfasst werden, liegt auf der Hand – und stellt unter kommerziellen Gesichtspunkten sogar die Hauptsache dar: Wenn ein Digitalkonzern intime Einblicke in das körperliche Befinden der Kundin hat, kann er vorhersagen, welche Bedürfnisse diese künftig haben könnte und für welche Produkte sie daher eine potenzielle Konsumentin ist.
Genau hier liegt eine zweite wesentliche Problematik der Digitalisierung des Gesundheitswesens: Die dort erfassten Daten sind besonders sensibel. Wie problematisch es sein kann, diese in die Hand von privaten Unternehmen zu geben, zeigt eine vergangenen Sommer veröffentlichte Studie der britischen Datenschutzorganisation Privacy International. Diese nahm den bereits heute boomenden Markt für Gesundheits- und Fitnessapps unter die Lupe: Im Apple Store und bei Google Play finden sich buchstäblich Zehntausende solcher Anwendungen. Sehr beliebt sind Sport-Apps, die die eigene Leistungsfähigkeit exakt messen und aufzeichnen, aber auch beispielsweise Menstruations-Apps, mit deren Hilfe Frauen ihren Zyklus tracken können, um so etwa menstruationsbedingten Beschwerden vorbeugen oder auch eine Schwangerschaft besser planen zu können.
Masturbationsabfrage
Privacy International wies nun in der Studie nach, dass gerade die Zyklus-Apps häufig Unmengen sensibler Daten über die Nutzerinnen erfassen und weiterleiten: Eine Anwendung teilte Facebook gar mit, wie häufig die Nutzerin masturbiert – der Hersteller der App nutzte für diese ein von Facebook bereitgestelltes Tool, um Werbeanzeigen zu schalten, wofür der Techriese im Gegenzug die UserInnendaten erhielt. Für Google, Facebook, Apple und Co. ist die Sammlung selbst derart sensibler Informationen offenkundig unproblematisch. Aus der Sicht von Googles Chefökonom Hal Varian sei die Weitergabe privater Gesundheitsdaten dasselbe, wie wenn wir unsere Intimitäten mit ÄrztInnen oder auch AnwältInnen teilen: Immerhin bekämen wir in allen Fällen «etwas zurück». Solche Äusserungen veranschaulichen das Selbstverständnis der Techkonzerne, die sich als digitale Dienstleister für praktisch alle menschlichen Lebensbereiche gerieren.
In einer aktuellen Kampagne anlässlich des Fitbit-Google-Deals zeichnet Privacy International daher ein düsteres Bild der Zukunft: Dank immer mehr aufgekaufter Firmen und Technologien drohten die grossen Techkonzerne allmählich die Oberhand über unser Leben zu gewinnen. Über Smartwatches und Algorithmen könnten sie bald schon nicht nur unsere täglichen Routinen kontrollieren, sondern auch beispielsweise unsere PartnerInnenwahl steuern – etwa wenn die intelligenten Armbanduhren zweier Personen, die sich zufällig begegnen, ihren TrägerInnen signalisieren, dass ihre Datenprofile gut zusammenpassen und sich daher romantische Avancen lohnen könnten.
Sind solche Szenarien aber nicht ein bisschen überzeichnet? «Wollen Sie denn in einer Welt leben, in welcher der Zugang für Menschen zu staatlichen Dienstleistungen, Sozialleistungen und zur Gesundheitsfürsorge auf den Algorithmen von Google basiert?», erwidert Ioannis Kouvakas, Rechtsexperte von Privacy International, auf eine Anfrage der WOZ. Die besagten Bedrohungsszenarien seien keineswegs abwegig, meint der Datenrechtler: «Am Aufbau dieser düsteren Zukunft wird bereits heute gearbeitet – teils ganz bewusst, teils auch unbeabsichtigt. Wenn Google die von dem Konzern angestrebte globale digitale Architektur tatsächlich errichten sollte, wird das die Freiheit aller einschränken und gleichzeitig die immense Macht dieses Unternehmens weiter zementieren.» Immerhin nehme man bei Privacy International aber erfreut zur Kenntnis, dass inzwischen auch staatliche Wettbewerbshüter vermehrt auf die problematischen Entwicklungen aufmerksam würden.
Die digitale Besitznahme des Körpers
Folgt man Shoshana Zuboff, die mit ihrer 2018 erschienenen Studie zum «Überwachungskapitalismus» ein Standardwerk über die vom Silicon Valley ausgehende Bedrohung für die liberalen Demokratien veröffentlicht hat, stellt man sich das Vorgehen der Techkonzerne am besten ähnlich vor wie dasjenige der kolonialistischen Eroberer zu Beginn der Neuzeit: Wie bei den Konquistadoren steht auch im digitalen Raum am Anfang die Landnahme eines bislang noch unregulierten Raums, in dem territoriale Ansprüche markiert und Fakten geschaffen werden. Die neoliberale Regulierungsscheu in den Jahren um die Jahrtausendwende spielte den Techkonzernen dabei genauso in die Hände wie der auf mehr Überwachung gestimmte Zeitgeist während des «Kriegs gegen den Terror».
Pionier des Überwachungskapitalismus war Google: Der Konzern habe «eine beispiellose Marktoperation losgetreten, einen Vorstoss in die unkartierten Weiten des Internets, wo es mangels Gesetz oder Wettbewerb so gut wie keine Hindernisse gab», schreibt Zuboff. In ihrem Buch führt sie dieses Vorgehen beispielhaft daran vor Augen, wie Google vor mehr als zehn Jahren seinen Onlinedienst «Street View» initiierte: Damals filmten spezielle, mit Panoramakameras bestückte Autos im Auftrag des Konzerns weltweit Strassen ab, dem aufkeimenden Protest der Bevölkerung in manchen Regionen zum Trotz. Rechtliche Regulierungen gab es kaum, und bis Behörden in die Gänge kamen, hatte Google längst Fakten geschaffen – und die KonsumentInnen hatten sich an die Bequemlichkeiten, die ein virtueller Spaziergang durch ansonsten unerreichbare Städte bietet, gewöhnt.
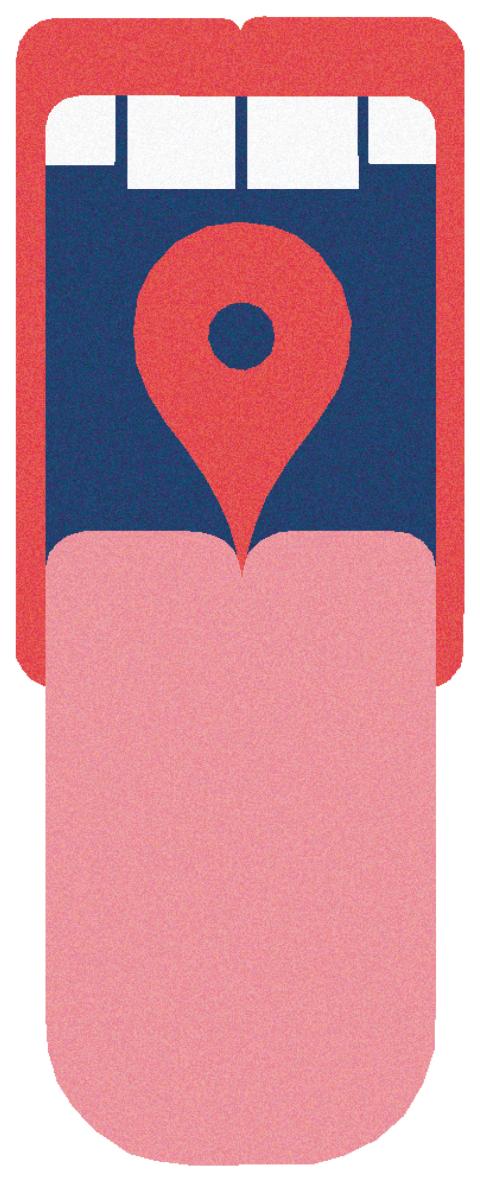
Heute ist es nicht mehr der Terrorismus, sondern ein Virus, das für einen globalen Ausnahmezustand sorgt. Google hat inzwischen eine neue Losung ausgegeben und wirbt mit: «Wir haben die Welt kartografiert. Jetzt lasst uns die menschliche Gesundheit vermessen.» Ging es also vormals um die digitale Besitznahme des öffentlichen Raums, sind nun unsere Körper an der Reihe. Auch Apple-CEO Tim Cook meinte vor ein paar Monaten in einem Interview, dass der grösste Beitrag, den sein Konzern für das Wohl der Menschheit liefern möchte, «im Bereich der Gesundheit» liegen solle. Solche Sätze könnte man auch als Drohung lesen.
Big Tech in deinem Körper
In der Serie «Big Tech in deinem Körper» nimmt die WOZ die US-Techkonzerne unter die Lupe, die die Digitalisierung der Gesundheitsindustrie mit Macht vorantreiben.
Auf den Auftakt folgen in den kommenden Wochen weitere Texte, zunächst zu Apple: Das Unternehmen zählt mit seiner Smartwatch zu den Marktführern im Bereich der Wearables. Die bei den NutzerInnen beliebte intelligente Armbanduhr versorgt den Konzern mit deren Gesundheitsdaten. Anschliessend steht Google im Fokus: Das Technologieunternehmen rief schon 2006 den Dienst «Google Health» ins Leben, war also auch in dieser Sparte Pionier. Heute verfolgt der Konzern mit dem «Project Nightingale» im grossen Stil die Akquise der PartientInnendossiers von Ärzten und Spitälern.
In Konkurrenz zu Google entwickelt auch Microsoft Diagnosesysteme, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Mit dem Programm «AI for Health» will der Windows-Hersteller zudem die Gesundheit der Menschen im Globalen Süden fördern. Zum Abschluss wird es um Facebook gehen – wie auch um die Frage, welche Chancen Big Data in der Medizin tatsächlich bietet.