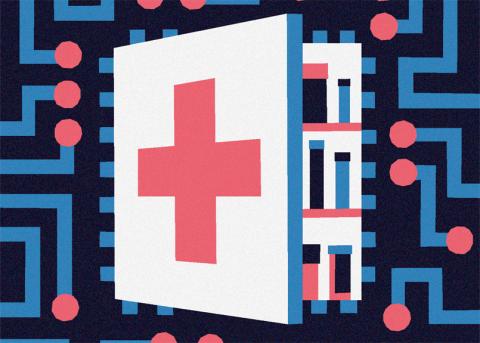Big Tech in deinem Körper (5): Facebooks Feldzug gegen die Krankheiten
Mittels umfassender Vernetzung der Menschheit will Mark Zuckerberg das globale Wohlbefinden verbessern. Kommen dann aber Widerworte, reagiert der Chef der Plattform schon mal dünnhäutig.

Im April lancierte Facebook auf seiner Plattform mehrere Umfragen. Ob sie positiv getestet worden seien, will Facebook seither von seinen NutzerInnen wissen. Ob sie die Social-Distancing-Regeln befolgten, wie ihr allgemeiner Gesundheitszustand sei und ob sie an Vorerkrankungen litten. Rund 1,5 Millionen Personen würden wöchentlich an diesen Umfragen teilnehmen, berichtet der Fernsehsender CNBC. Sie sollen helfen, die Verbreitung des Coronavirus nachzuzeichnen und Hotspots vorherzusagen.
Erarbeitet hat Facebook die Umfragen zusammen mit verschiedenen Forschungsinstitutionen wie der Carnegie Mellon University, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Johns Hopkins University. Die Daten aus diesen Umfragen hätten wohl entscheidend dazu beigetragen, den jüngsten Ausbruch in Florida vorherzusagen, sagt ein Studienleiter gegenüber CNBC. Sie hätten guten Grund zur Annahme, dass diese Methode ein «big deal» sei. Er sei überrascht, dass diese Datenquellen nicht öfters angezapft würden. Neu ist sie trotzdem nicht, die Idee, das soziale Netzwerk mit seinen 2,5 Milliarden aktiven NutzerInnen in einen gesellschaftlichen Pulsmesser zu verwandeln.
Altruismus als Business
Facebook hat die Vernetzung mit medizinischen Forschungseinrichtungen in den vergangenen Jahren vorangetrieben. 2015 gründete CEO Mark Zuckerberg mit seiner Partnerin Priscilla Chan die Chan Zuckerberg Initiative – dies mit dem ambitionierten Ziel, bis Ende des Jahrhunderts «sämtliche Krankheiten zu heilen, diesen vorzubeugen oder sie zumindest zu beherrschen». Ganze 99 Prozent ihrer Aktienanteile an Facebook wollen sie in Forschungsinfrastruktur und Communityprojekte fliessen lassen. Mit seinem «Data for Good»-Programm wiederum bietet Facebook Hilfsorganisationen und Forschenden spezifische Datensets an: zum Beispiel die Disease Prevention Map, mit welcher sich Bewegungsmuster bestimmter Menschengruppen bis ins Detail analysieren lassen, um etwa Hilfslieferungen zu planen – alles aufbereitet mit den Daten, die die Facebook-NutzerInnen tagtäglich produzieren.
Das Zusammenspiel seines sozialen Netzwerks und wissenschaftlicher Institutionen ist integraler Teil von Mark Zuckerbergs grosser Vision namens «Connectivity». Spricht Zuckerberg über den Weg zu einer gesünderen Welt, landet er immer irgendwann bei diesem Begriff. «Connectivity» meint ganz einfach: Je mehr Menschen miteinander verbunden sind und Informationen teilen, desto besser für den Einzelnen und damit für uns alle. Zuckerberg führt dann Beispiele von Personen an, die dank Facebook-Zugang eine Krankheit frühzeitig erkannt oder sich aus der Armut befreit hätten. «Connectivity» sei gar ein Menschenrecht, schreibt er an einer Stelle.
Um Zuckerbergs Bemühungen für eine heilere Welt einzuordnen, müssen sie vor ihrem ökonomischen Hintergrund betrachtet werden. Denn trotz ihrer geballten altruistischen Verheissung ist «Connectivity» vor allem eines: die Basis von Facebooks Geschäftsmodell. Je mehr Menschen sich mittels der Dienste des Konzerns, zu denen auch Whatsapp und Instagram zählen, über intime Befindlichkeiten austauschen, desto lukrativer wird die Plattform für WerbekundInnen. 2019 lag der Umsatz von Facebook bei 70 Milliarden US-Dollar. Davon stammen 98,5 Prozent aus Werbeeinnahmen. Damit die Investorenschaft weiterhin bei der Stange bleibt und Mark Zuckerbergs Vision finanziert, muss Facebook neue Märkte erschliessen und in den bestehenden Märkten die NutzerInnen noch stärker an die Plattform binden. Von diesem eindeutigen Verhältnis von Geschäftsmodell und Altruismus sollten auch Zuckerbergs rhetorische Nebelpetarden nicht ablenken, etwa wenn er sagt: «Wir entwickeln keine Dienste, um Geld zu machen; wir machen Geld, um bessere Dienste zu entwickeln.»
Verspricht Facebook seinen NutzerInnen medizinische Selbstermächtigung oder den Forschenden medizinische Erkenntnisse, dann nur im Austausch gegen den steigenden Einfluss eines Konzerns, der schon mal launisch reagieren kann, wenn die Connectivity nicht nach seinen Vorstellungen vorangetrieben wird. 2013 rief Facebook die Initiative internet.org ins Leben. Diese hat zum Ziel, Menschen in ländlichen Gebieten – insbesondere in Teilen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens – mit einem kostenlosen Internetzugang zu versorgen und ihnen damit zu ermöglichen, sich etwa über Krankheiten zu informieren. Der Haken: Das sogenannte Free-Basics-Angebot ist keineswegs das Tor ins freie Web, sondern bloss zu einem von Facebook kuratierten Teil.
Wie kann man da nur dagegen sein?
Als sich nach der Lancierung in Indien breiter Protest rührte, weil Free Basics damit die Netzneutralität und die Privatsphäre missachtet und zudem als koloniales Projekt verstanden wurde, steigerte sich Zuckerberg in eine paternalistische Kampagne hinein. Kurz bevor ein indisches Gericht Free Basics offiziell beerdigte, fragte er in einem verzweifelten Meinungsartikel in der «Times of India»: «Wie um alles in der Welt kann man dagegen sein?»
Free Basics, heute verfügbar in mehr als sechzig Ländern, soll Hunderte Millionen neue NutzerInnen ins Ökosystem Facebook einbinden. Es sind Menschen aus ärmeren Regionen, die die Möglichkeit erhalten, sich trotz fehlender Gesundheitsversorgung über Symptome und Rezepte gegen Krankheitserreger zu informieren, zum Preis ihrer digitalen Autonomie. Auch bei den Diensten, die auf die gesättigten Märkte abzielen, dürften vornehmlich Menschen in gesundheitlich und sozial prekären Verhältnissen dieses Angebot nutzen – gerade in den USA, wo Facebook mit seinen Diensten auf riesige Lücken in der Gesundheitsversorgung reagiert.
Das US-amerikanische Gesundheitswesen ist in einem desolaten Zustand. Im Jahr 2018 beliefen sich seine Kosten auf 3,65 Billionen US-Dollar – unter den OECD-Ländern seit Jahren mit Abstand das teuerste. 30 Millionen Menschen sind unversichert, Schätzungen zufolge sterben als direkte Folge davon jährlich 45 000 Menschen. Viele Menschen können sich die teuren Medikamente und Arztbesuche nicht leisten. Gemäss einer Gallup-Umfrage hat bereits jede vierte Person in den USA trotz einer gravierenden Erkrankung schon mal viel zu spät die zuständige Fachperson konsultiert, was die Genesung hinauszögerte. Dies liegt abgesehen von der Angst vor untragbaren Kosten auch am fehlenden Zugang zu Informationen.
Ein «ganzheitliches» Menschenbild
Vor diesem Hintergrund lancierte Facebook 2019 etwa das Tool «Preventive Health». Es soll helfen, die zwei häufigsten Todesursachen in den USA, Herzerkrankungen und Krebs, durch Prävention einzudämmen. Dazu geben NutzerInnen bei «Preventive Health» Alter und Geschlecht an, worauf sie laufend an medizinische Check-ups wie Cholesterintests erinnert und an medizinische Partnerinstitutionen in der Nähe verwiesen werden. «Wir wissen, dass viele Menschen keine Versicherung haben. Um ihnen zu helfen, zeigen wir auch gemeinnützige Gesundheitszentren in ihrer Nähe an», betont Freddy Abnousi in der Pressemitteilung. Abnousi ist Head of Healthcare Research bei Facebook, er hat das Tool mitentwickelt. Auf die Frage, warum der praktizierende Kardiologe zu Facebook gewechselt habe, sagt er in einem Interview: Viele Krankheiten liessen sich nur bekämpfen, wenn man die sozialen Verhältnisse verstehe, in denen sie entstehen. Facebook sei die einzige Instanz, die über Datensets verfüge, die den Menschen «ganzheitlich» abbilden – «samt seinen Gewohnheiten, seiner Beziehung, seines sozialen Umfelds».
Um diese Daten noch besser auswerten zu können, startete Facebook unter der Leitung Abnousis 2018 ein geheimes Projekt. Abnousis Team schrieb mehrere Spitäler an, um von diesen anonymisierte PatientInnendaten zu erhalten. Diese sollten anschliessend mit Facebook-Profilen abgeglichen werden. Ziel war es, «soziale» und «medizinische» Daten zu kombinieren und massgeschneiderte Genesungspläne für alle PatientInnen zu gestalten. Doch dann kam der Datenskandal um Cambridge Analytica, und das Projekt wurde eingefroren: zu gross das Risiko, erneut ins Visier von DatenschützerInnen zu gelangen. Denn die Verarbeitung gesundheitsbezogener Informationen ist auch in den USA strengeren Regulierungen unterworfen. Und diese stehen Facebook bei der Steigerung seiner Werbeeinnahmen durch die Pharmaindustrie im Weg. Konzerne wie Bayer verschoben ihre Budgets in den vergangenen Jahren nur zögerlich vom Fernsehen auf Social Media, eben auch weil Facebook seinen WerbekundInnen keine direkten Angaben über den Gesundheitszustand seiner NutzerInnen machen darf.
So weist Freddy Abnousi in der Ankündigung von «Preventive Health» auch ausdrücklich darauf hin, dass keine Daten an Drittparteien weitergegeben würden. Eine nennenswerte Ausnahme: Liken NutzerInnen aufgrund der Empfehlungen von Facebook etwa die Seite einer Herzchirurgin oder eines gemeinnützigen Gesundheitszentrums, werden diese Informationen ganz regulär weiterverarbeitet. Das ist ungefähr so, als würde bei einer Google-Suchanfrage zwar nicht das eingetippte Wort aufgezeichnet, sehr wohl aber das angeklickte Suchergebnis. Wer aber braucht noch die Angabe des Geschlechts, wenn man weiss, dass die Person eine gynäkologische Praxis besuchte?
Die Serie
In der Reihe «Big Tech in deinem Körper» nimmt die WOZ die US-Techkonzerne unter die Lupe, die die Digitalisierung mit Macht vorantreiben.
Nach Beiträgen zu Apple (WOZ Nr. 37/2020 ), Google (WOZ Nr. 39/2020 ), Microsoft (WOZ Nr. 41/2020 ) und Facebook wird sich die letzte Folge mit der Frage beschäftigen, welche Bedeutung die in der Serie skizzierten Entwicklungen für das Gesundheitswesen hier in der Schweiz haben.