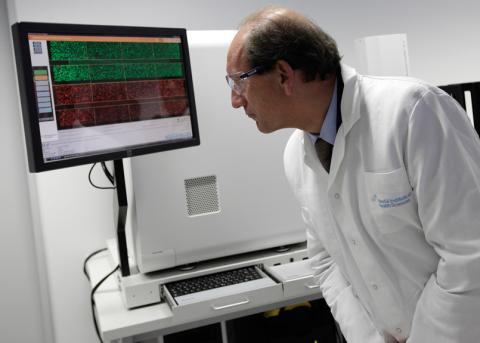ETH Lausanne: Der brillante Verkäufer
Patrick Aebischer sprüht vor Optimismus und gilt als der Schweizer Vorzeigewissenschaftsfunktionär. Von Risiken spricht der Präsident der ETH Lausanne (EPFL) allerdings nicht gern.

Dies ist die Geschichte eines Verkäufers. Von einem, der seine Sache gut macht, da sind sich Bewunderer und Kritikerinnen einig. Uneinigkeit herrscht in der Frage, ob das, was er gut macht, auch gut ist.
Patrick Aebischer ist seit 2000 Präsident der ETH Lausanne (EPFL). In dieser Zeit hat die kleine Schwester der ETH Zürich Gewicht gewonnen. 2010 konnte sie gleich viele öffentliche Forschungsgelder von Bund und EU einwerben wie die doppelt so grosse ETH Zürich. Die eingeworbenen Privatmittel vervierfachte Lausanne zwischen 2004 und 2010 – die ETH Zürich konnte die ihrigen im selben Zeitraum lediglich verdoppeln.
Vor Aebischers Antritt zählte die Schweizerische Mediendatenbank ein paar Dutzend Zeitungsartikel pro Jahr, in denen die EPFL erwähnt wurde; 2011 waren es fast 500. Als der «Tages-Anzeiger» kürzlich einen Hintergrundbericht über die dynamische Romandie publizierte, illustrierte er ihn mit einem Foto des Lausanner Hochschulcampus. Wenn die EPFL an der Rennjacht Alinghi mittüftelt oder für Bertrand Piccards Solarflugzeug Berechnungen anstellt, sind ihr die Schlagzeilen sicher.
«Wir stehen erst am Anfang»
Auf die Frage, was eine gute Universität sei, nennt Patrick Aebischer drei Faktoren: Basis von allem sei eine gute Grundlagenforschung. Diese müsse eine gute Ausbildung ermöglichen. Und schliesslich sollten die Resultate der Forschung «valorisiert», also ökonomisch verwertet werden.
Wenn Aebischer heute als der Musterwissenschaftsfunktionär der Schweiz gilt, so vor allem wegen des dritten Punkts. «Prototyp einer unternehmerischen Hochschule» nannte der «Schweizer Monat» die EPFL anerkennend. Aebischer schwärmte darin: «Wir stehen erst am Anfang. Und das macht mich so zuversichtlich!»
Am Anfang wovon? Zur WOZ sagt Aebischer: «Die Schweiz ist innovativ. Wir schaffen es aber zu wenig, Innovationen in Wertschöpfung und Arbeitsplätze umzusetzen. Der Schweizer Werner Arber hat die Restriktionsenzyme entdeckt, das World Wide Web wurde im Cern bei Genf entwickelt. Aber Geld verdienen andere damit. Wo entstehen die Technologieunternehmen, die gross werden, die Googles, die Facebooks, die Amgens, die Genentechs? In den USA!»
Aebischer hat deshalb das Quartier de l’innovation geschaffen: Hochschul-Spin-off-Firmen, etablierte Unternehmen und die Forschungslabors der EPFL sollen hier in einen fruchtbaren Austausch treten. Und vielleicht wird sich eines der Lausanner Spin-offs dereinst als neues Google oder Amgen herausstellen.
Ins Nest mit Nestlé?
Zu den ganz grossen Unternehmen pflegt Patrick Aebischer beste Kontakte. Etwa zu Nestlé: 2006 beschloss der Nahrungsmittelkonzern, mit 25 Millionen Franken zwei Lehrstühle an der EPFL zu finanzieren. Einer der «Nestlé Chairs» soll am neurowissenschaftlichen Brain Mind Institute den Zusammenhang zwischen Ernährung und Hirnentwicklung erforschen, um «Alterungsprozesse zu verlangsamen und Krankheiten wie Alzheimer vorzubeugen», wie es in der Pressemitteilung hiess.
Die Vision: Jede und jeder soll sein oder ihr Genom analysieren lassen, um festzustellen, für welche Krankheiten er oder sie ein erhöhtes genetisches Risiko aufweist, um vorbeugend eine «personalisierte» Diät einzunehmen. Auf 100 bis 150 Milliarden Dollar pro Jahr schätzt Nestlé das Potenzial. 2011 gründete Nestlé für diesen Geschäftsbereich die Tochter Nestlé Health Science. Standort: der EPFL-Campus. Im Verwaltungsrat: Patrick Aebischer. Ein Dankeschön für einen massgeschneiderten Lehrstuhl?
Aebischer sagt etwas ungehalten: «Wenn Novartis in Nyon einen Standort schliessen will, schreien alle auf, weil Arbeitsplätze verloren gehen. Aber wenn ich dazu beitrage, 300 Arbeitsplätze zu schaffen, ruft man: ‹Interessenkonflikt!›»
Nun, fast niemand hat «Interessenkonflikt!» gerufen. Aber nicht mal die Bewunderer vom «Schweizer Monat» kamen umhin, etwas gewunden festzustellen, es gebe «Kritiker, die befürchten, dass private Donatoren und Privatunternehmen zu viel Kontrolle gewinnen». «Hallo», antwortete Aebischer, «wer bezahlt die Steuern?» So direkt hat es selten einer gesagt.
Zahmes Aufsichtsgremium
2003 hat die EPFL Richtlinien erlassen, die festhalten: «Es besteht ein erhöhtes Potenzial für Interessenkonflikte an der EPFL. Je höher die Position, in der sich jemand befindet, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, mit Interessenkonflikten konfrontiert zu sein.» Gezeichnet: Patrick Aebischer.
Für wen soll das gelten, wenn die Person mit der höchsten Position an der Hochschule im Verwaltungsrat eines Unternehmens sitzt, von dem seine Schule Geld erhält? Aebischer sagt: «Ich habe Nestlé seit fünf, sechs Jahren gesagt: Functional Food ist wichtig, um Alzheimer vorzubeugen. Und es ist mir gelungen, die Chefs zu überzeugen, da einzusteigen. Da wäre es doch eigenartig, wenn ich den Verwaltungsratsposten abgelehnt hätte!» Und EPFL-Hausjuristin Susan Killias sagt: «Potenzielle Interessenkonflikte und die Nebentätigkeiten des Präsidenten werden dem ETH-Rat einmal pro Jahr gemeldet. Die Dinge sind absolut transparent.»
Der ETH-Rat ist das Aufsichtsgremium über ETH Zürich und EPFL. Allzu ernst scheint er seine Aufsichtspflicht nicht zu nehmen. Sein Sprecher Markus Bernhard sagt: «Über seinen Eintritt in den Verwaltungsrat von Nestlé Health Science hat Patrick Aebischer den Präsidenten des ETH-Rats mündlich orientiert. Der Fall wurde nicht im ETH-Rat diskutiert.»
Als der starke Mann im ETH-Rat gilt Patrick Aebischer, der seinem eigenen Aufsichtsgremium von Amtes wegen angehört – wie auch der Zürcher ETH-Präsident Ralph Eichler. «Lieber zerstört er ein Projekt, als anderen den Vortritt zu lassen», zitierte die «NZZ am Sonntag» den ehemaligen ETHZ-Präsidenten Olaf Kübler. «Das ist Küblers Meinung», sagt Aebischer dazu. «Die Polemik bringt nichts. Die ETH Zürich ist eine sehr gute Schule, die ich bewundere.»
Auch Ralph Eichler würde nichts Schlechtes über den EPFL-Präsidenten sagen. Doch nach den Sitzungen des ETH-Rats soll er jeweils über Patrick Aebischer schimpfen, wie mehrere Quellen aus dem ETHZ-Umfeld sagen. Die beiden Partnerhochschulen sind Konkurrentinnen: Beide erhalten ihre Mittel aus demselben Topf. Aebischer kommt dabei zugute, dass er in vieler Hinsicht das genaue Gegenteil Eichlers ist: charismatisch, eloquent, bestens vernetzt. Er umgibt sich mit Medienprofis, die wissen, wie man sich in Szene setzt – ein brillanter Verkäufer eben.
Wie beispielsweise Anfang 2011, vor versammelter Belegschaft des «Tages-Anzeigers». Aebischer sprach über die Defizite der Schweiz im Verwerten ihrer Innovationen. Er präsentierte sein Vorzeigeprojekt, den Hirnsimulator Blue Brain, der gute Chancen hat, das von der EU inszenierte «Flagship»-Rennen um eine Milliarde Euro zu gewinnen. Was damals noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen war: Blue Brain ist in Fachkreisen stark umstritten (siehe WOZ Nr. 4/2012 ). Ein Zuhörer soll Tränen der Rührung geweint haben. Begonnen hatte der Vortrag mit einem Werbefilm: kühne Kamerafahrten und -flüge, viel Animation, Bilder aus dem Weltraum und aus Labors, dramatische Musik. Der Film ist hoch professionell gemacht und knüpft an Bubenträume an, hat mit den Problemen der realen Welt jedoch nichts zu tun.
Idée fixe der Wissenschaftspolitik
Seit gut dreissig Jahren geistert eine Idée fixe durch die forschungspolitischen Positionspapiere: Hochschulen sollen zur treibenden Kraft hinter einer «wissensbasierten Ökonomie» werden, die Jobs und Wachstum schafft. Daran knüpft Aebischer an. Er hat selbst Spin-off-Firmen gegründet und sei dafür, wie er sagt, bei seiner Anstellung von der damaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss gelobt worden.
Dumm nur, dass etwa die Biotechbranche als Ganzes seit ihrem Bestehen laut dem Beratungsunternehmen Ernst & Young mehr Geld verloren als verdient hat. Ein typischer Fall ist Actelion: 2011 von Patrick Aebischer in seinen Vorträgen noch als Musterbeispiel gepriesen, kämpft das Schweizer Biotechunternehmen heute ums Überleben.
Profiteure der Biotech-Spin-offs sind vor allem die Pharmakonzerne, die abwarten, wer überlebt, um die Erfolgreichen nach einigen Jahren aufzukaufen. So lagern sie einen Grossteil der risikoreichen Forschung und Entwicklung an die Spin-offs aus, denen staatliche Wirtschaftsförderagenturen und universitäre Technologietransferstellen Starthilfen gewähren.
Dass Politik und Universitäten der Schimäre der «wissensbasierten Ökonomie» nachjagen und von einem europäischen Silicon Valley träumen, verändert den Charakter der Wissenschaften. Libero Zuppiroli, Professor an der EPFL («mein Freund Libero», sagt Aebischer), schreibt in seinem Büchlein «La bulle universitaire», an der EPFL – wie allgemein an den technischen Universitäten – handle man heute viel mehr, als man denke. Aebischer sei wie ein Odysseus, der die Ohren seiner Mannschaft mit Wachs verstopft, damit die WissenschaftlerInnen vor lauter «Sirenenklängen der Liebe zur Natur, der Poesie, der Kreativität» die «rationale Welt der Ökonomie und des Fortschritts» nicht vergessen.
Passt das Bild? Aebischers Leidenschaft für die Grundlagenforschung wirkt ehrlich. Gewiss, sagt Zuppiroli: «Aebischer liebt die Kunst und die Wissenschaften. Aber Odysseus war ja der Einzige auf seinem Schiff, der sich die Ohren nicht verstopfte und die Sirenen hörte!»
Geheimverträge mit Nestlé
In den Verträgen, die die Finanzierung zweier Lehrstühle an der EPFL durch Nestlé regeln, stehe nichts Heikles, sagt Patrick Aebischer: Da werde nur der Forschungsbereich definiert und die akademische Freiheit gesichert. Ein Gesuch, die Verträge gestützt auf das Bundesgesetz zum Öffentlichkeitsprinzip einsehen zu dürfen, hat die EPFL aber abgelehnt: Man könne sie nicht offenlegen, da sie Geheimhaltungsklauseln enthielten, schreibt EPFL-Juristin Susan Killias. Dazu sagt Thomas Kliche, Spezialist für Korruption in den Wissenschaften an der Uni Magdeburg: «Geheimhaltungsklauseln sind mit wissenschaftlicher ‹Good Practice› nicht vereinbar.»
Ebenfalls abgelehnt hat die EPFL ein Gesuch, das Register der Interessenverbindungen ihrer MitarbeiterInnen einzusehen zu können. Killias berief sich auf Persönlichkeitsschutz. Sie selbst hatte das Register zuvor aber als «nicht geheim» bezeichnet. Auch die ETH Zürich hat ein analoges Gesuch abgelehnt. Zurzeit sind die Gesuche beim Eidgenössischen Öffentlichkeitsbeauftragten zur Schlichtung hängig.