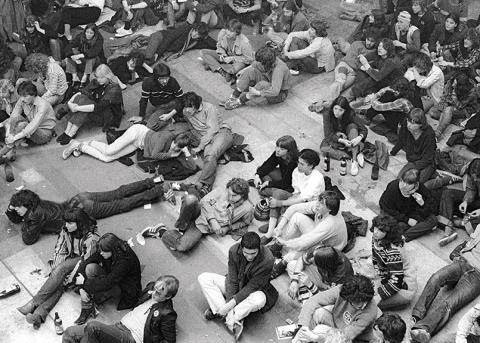Radio Lora: Das verschwundene Studio
Das alternative Lokalradio Lora in Zürich erlebt stürmische Tage. Doch mit der Wahl eines neuen Vorstands besteht Hoffnung, dass die Zeit der internen Polarisierung und Konfrontation zu Ende geht.
Dieses Jahr wird das linksalternative Lokalradio von Zürich (Lora) dreissig Jahre alt. Auf dem Sender laufen regelmässig über 180 Sendungen in rund zwanzig Sprachen, alle produziert von unbezahlten Freiwilligen, in der Mehrzahl MigrantInnen, die sonst kaum je Zugang zu Schweizer Medien hätten. Lora bietet den verschiedensten kulturellen und politischen Gruppierungen einen Ort, wo sie zum Ausdruck bringen können, was sie bewegt. Besonders gefördert werden Frauensendungen, was 2011 mit dem Zürcher Gleichstellungspreis an die Frauenredaktion «Hälfte des Äthers» anerkannt wurde. Lora stärkt Gemeinschaften und bietet einen niederschwelligen Einstieg für alle, die Radio machen wollen – inklusive Zugang zu einem breiten Ausbildungsangebot.
Allerdings gibt es bei der Verwaltung des Radios immer wieder Probleme. Mitschuldig ist eine inzwischen antiquierte Struktur, die teilweise noch aus einer Zeit stammt, als das Radio noch gar nicht sendete. Radio Lora basiert auf zwei voneinander unabhängigen Körperschaften: Die Stiftung Alternatives Lokalradio (ALR) ist Inhaberin der Sendekonzession, bezieht Geld aus dem Topf der Erträge durch Radio- und Fernsehgebühren des Bunds und besitzt die meisten Studioeinrichtungen. Der Verein Radio Lora organisiert die SendungsmacherInnen und UnterstützerInnen, gewährleistet den Studiobetrieb und fungiert als Arbeitgeber einer fest angestellten Betriebsgruppe.
Während der Verein demokratisch organisiert ist und Gremien wie eine Sendekommission und einen Vereinsvorstand jährlich wählt, konstituiert sich die Stiftung gemäss Stiftungsrecht selbst und ist keiner Basis rechenschaftspflichtig. Die Idee, einer schlecht kontrollierbaren Stiftung so viel Macht im Radio zu geben, geht auf die unseligen linken Zersplitterungen der siebziger Jahre zurück. Man wollte das Radio vor einer unfreundlichen Übernahme durch eine der damals zahlreichen linken Sekten schützen.
Eskalation Ende 2011
In den Anfangsjahren des Sendebetriebs war diese Konstruktion wenig problematisch, da das Radio faktisch von einer Kerngruppe geführt wurde, in der Aktive des Vereins, StiftungsrätInnen wie auch Betriebsgruppenmitglieder eng zusammenarbeiteten. Zudem erhielt zu dieser Zeit Radio Lora noch keine Gebührengelder. Je mehr Geld jedoch vom Bundesamt für Kommunikation überwiesen wurde, desto grösser wurde die Macht der Stiftung, die die Weitergabe der Gelder an den Verein an Bedingungen knüpfen konnte. Zudem waren die ehrenamtlichen StiftungsrätInnen oft sehr weit weg vom eigentlichen Sendebetrieb. Die Konflikte nahmen zu.
Die Lage eskalierte Ende 2011. Anlass war der schlecht lancierte Vorschlag einer Gruppe aus StiftungsrätInnen und Vorstandsmitgliedern des Vereins, eine Geschäftsleitung zu schaffen. Es kam die Stunde der Anheizerinnen und Polarisierer: Die StiftungsrätInnen wurden an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember als neoliberale Totengräber eines politischen Projekts diffamiert, andere aus der Arbeitsgruppe niedergeschrien.
Ein neu gewählter Vereinsvorstand, der auf einen Kurs gegen die Umstrukturierung festgelegt wurde, trieb die Polarisierung weiter. Gespräche mit der überforderten Stiftung wurden fortan verweigert. Der neue Vorstand verfolgte das Ziel, Radio Lora möglichst unabhängig von der Stiftung werden zu lassen, ohne die Strategie jedoch breit zu diskutieren und transparent zu machen. So wurde, um Geld zu sparen, Betriebsgruppenmitgliedern gekündigt, ein undurchsichtiger Unterstützungsverein gegründet, der dann angeblich den Kauf eines alten Studios des Privatsenders Radio 24 mitfinanzierte, und in einer Petition wurde die Übernahme der Sendekonzession von der Stiftung gefordert. Ausserdem bildete sich offenbar im neuen Vorstand eine Kerngruppe heraus, die relativ unabhängig von den andern Mitgliedern agierte.
Zum offenen Konflikt kam es dieses Jahr nach erneuten Kündigungen gegen Betriebsgruppenmitglieder. Eine Arbeitsgruppe für ein basisdemokratisches Lora rief daraufhin vor der Generalversammlung vom 25. Juni zur Abwahl des Vorstands auf. Sie beklagte fehlende Transparenz, eine unfaire Behandlung der Beschäftigten und eine Gefährdung des Projekts wegen der mangelnden Zusammenarbeit mit der Stiftung.
Jetzt überstürzten sich die Ereignisse: Das Radio-24-Studio wurde in einer Nacht- und Nebelaktion wieder ausgebaut. Die Vorstandskerngruppe gab in einem «Communiqué Teilvorstand» ihren sofortigen Rücktritt bekannt. Sie sei «mit Gewalt bedroht worden», und es seien «gezielt Falschmeldungen und Diffamierungen in Umlauf gesetzt worden». Der von dieser Gruppe offenbar inszenierte Abbau der Studioeinrichtung wurde damit gerechtfertigt, dass «die Unterstützergruppe und die Darlehensgeber sich von Radio Lora zurückgezogen haben».
Neuer Vorstand, neuer Anfang?
An der Generalversammlung des Vereins ist nun am Dienstag letzter Woche bei einhelliger Empörung wegen des Studioraubs ein neuer Vorstand gewählt worden. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, die Sendekonzession zu sichern, die Arbeitsplätze zu garantieren, die Finanzen zu sanieren und so transparent wie möglich zu agieren.
Radio Lora könnte also in nächster Zeit wieder in etwas ruhigere Bahnen gebracht werden. Die Zeit der Polarisierung scheint vorbei. Doch nötig wäre, dass auch die veraltete Struktur mit der Stiftung als Machtzentrum beseitigt und so das Radio demokratisiert werden könnte.
Daniel Stern war in den achtziger und den neunziger Jahren in verschiedenen Funktionen bei Radio Lora aktiv und hat sich zusammen mit anderen im letzten Jahr vergeblich um eine Verständigung zwischen dem Vereinsvorstand und dem Stiftungsrat bemüht.