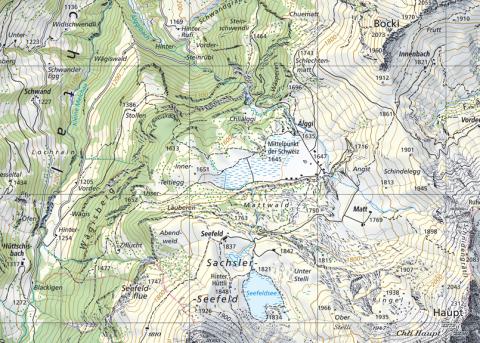Visionen: Die Ausserirdischen sind wir selbst
Papa ist auf Dienstreise, und der Weg führt ihn durchs Wurmloch in ferne Galaxien: So weit ist noch niemand gereist, um am Ende doch wieder zurück zu seiner Tochter zu finden. Wir reden von Matthew McConaughey in «Interstellar», dem neusten Film von Christopher Nolan. Die Quintessenz der langen Reise durchs All ist denkbar romantisch: Die Liebe, namentlich jene des Vaters zu seinem Kind, ist eine Kraft, die alle raumzeitlichen Dimensionen transzendiert. So weit, so banal. Das Vertrackte am Film ist aber, dass er sich nicht auf diese vordergründige Sentimentalität reduzieren lässt.
Denn «Interstellar» ist auch ein Blockbuster, der den vermeintlich nutzlosen Blick ins All gegen materiellen Nutzwert und kurzfristiges Zweckhandeln ausspielt. Wenn die Erde verödet, was bringt es uns, von fernen Galaxien zu träumen? So bekommt es der Raumfahrer beim Elterngespräch zu hören, als es um die Zukunft seines Sohnes geht: «Wir brauchen Bauern, keine Ingenieure.» In der Schweiz hatten wir einen Namen dafür: Anbauschlacht. «Interstellar» ist ein Film, der wissenschaftliche Fantasie und Spekulation gegen den Geist der Anbauschlacht in Stellung bringt.
Die bestechendste Analyse zu «Interstellar» aber war nicht in einem altehrwürdigen Feuilleton zu lesen und auch nicht in einem profanen Filmblog. Sondern in einer unverschämt kurzen Gastkolumne in der «ZS», der Studierendenzeitung der Universität Zürich. Philipp Theisohn, Literaturprofessor mit spekulativer Bodenhaftung, schreibt dort: «Die Entdeckung, dass die Signale aus dem All von uns selbst stammen, ja: dass wir selbst einen Kommunikationszirkel angestossen haben, der uns in neue Lebensräume führen wird, ist der Grundgedanke dieses Films. Der Verwandlungsprozess, den er dem Menschen auferlegt, ist damit gewaltiger, als es jede Alienmaskerade je sein könnte.» So zeige der Film auf eindrückliche Weise, was das eigentlich bedeute, «ausserirdisch zu werden». In diesem Sinne: Bon voyage!
«Interstellar» läuft weiterhin in den Kinos.