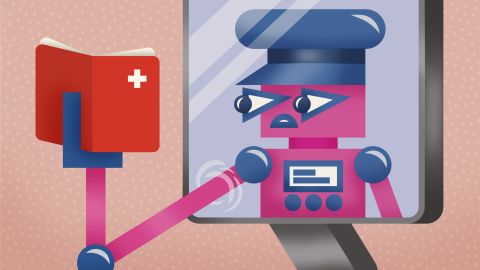Digitale Politik: Die Demokratie in deinem Handy
Von der Teilhabe über die Meinungsbildung bis hin zur Mobilisierung – Internet und Digitalisierung haben die Spielregeln der Politik verändert. Jetzt will der Netzaktivist Daniel Graf die Revolution der direkten Demokratie. Gelingt es ihm, alte Machtverhältnisse ins Wanken zu bringen?

Es war ein Dienstagmorgen Anfang April, und auf dem Bundesplatz verstellten Marktstände die freie Sicht auf das Bundeshaus und die angrenzenden Banken. Das war Louise Schneiders Glück. So konnten die zwei Polizisten, die nur wenige Schritte entfernt einen protestierenden Mann im Hungerstreik kontrollierten, nicht sehen, wie die 86-Jährige langsam auf die weisse Bauabschrankung zuging, von der die Wörter «Schweizerische Nationalbank» glänzten.
Mit festem Griff hielt die Rentnerin in ihrer rechten Hand eine Spraydose. Sie hob den Arm, aber die rote Farbe verlor sich zunächst im Wind. Dann schüttelte sie die Dose noch einmal, rückte ein paar Zentimeter näher und sprühte in etwas zittriger Schrift den Spruch «Geld für Waffen tötet» auf die Bauabschrankung.
Die Aktion dauerte nur wenige Minuten, und die anwesenden Polizisten bemerkten sie erst, als sie vorbei war. Aber mehrere Hundert Personen, die an diesem Morgen noch etwas verschlafen im Bett lagen und über ihr Smartphone wischten, konnten live auf Facebook verfolgen, wie eine kleine, alte Frau mit weissen Haaren rote Farbe auf der mit Stacheldraht gesicherten Bauabschrankung anbrachte. Denn auf der Seite der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) wurde die Aktion in Echtzeit übertragen. Zudem waren neben einigen GSoA-AktivistInnen und Jungen Grünen auch eine Handvoll ausgewählte JournalistInnen anwesend, die das Geschehen verfolgten. Sie fotografierten und filmten: Wie die Berner Polizei nach einem Verantwortlichen fragte, wie sich Louise Schneider bei ihnen meldete, wie die Beamten ungläubig ihren Ausweis studierten – und nach einigem Hin und Her die 86-Jährige abführten und für eine kurze Befragung mit auf den Polizeiposten nahmen.
Schneider war, so erzählte sie später den Medien, zeitlebens eine Friedensaktivistin – schon seit sie Hitlers Reden am Radio gehört hatte. Als die FriedensaktivistInnen beschlossen, eine Volksinitiative zu lancieren, die die Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten verbieten sollte, ergab das eine das andere: GSoA-Mitglied Schneider erfüllte sich einen lang gehegten Wunsch – und die GSoA erhielt einen medienwirksamen Schub für ihre neue Kriegsgeschäfteinitiative.
Revolution der direkten Demokratie
Die Sprayaktion von Louise Schneider ist ein Paradebeispiel dafür, wie man heute mit wenig Aufwand und geringen finanziellen Mitteln für ein politisches Anliegen werben kann: Der Livestream der Aktion ging viral, die Bilder der Aktion verbreiteten sich auf Social Media wie von selbst, über 160 000-mal wurde das Video mittlerweile angesehen, weltweit berichteten traditionelle Medien über die Aktion. Es war ein Kampagnenstart nach Drehbuch.
Geschrieben worden war es lange zuvor. Im März sassen Lewin Lempert und Dimitri Rougy im GSoA-Sekretariat in Zürich und planten die Lancierung der Initiative, das heisst: deren mediale Begleitung. Ausgewählten traditionellen Medien (in diesem Fall: Tamedia) kam beim Kapern der Aufmerksamkeit bloss noch die Rolle des Verstärkers zu. 100 000 Unterschriften muss man in der Schweiz innerhalb von achtzehn Monaten sammeln, um eine Volksinitiative an die Urne zu bringen. «10 000 Unterschriften wollen wir in den ersten 24 Stunden online sammeln», sagte GSoA-Sekretär Lempert damals.

Lempert wollte damit den Rekord brechen, den die Initiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub vor einem Jahr gesetzt hatte. Mittlerweile haben rund 20 000 Personen die Kriegsgeschäfteinitiative unterzeichnet, 13 000 Unterschriften gingen digital ein. Ihr ehrgeiziges Ziel verpasste die GSoA nur knapp. Es dauerte 48 Stunden, bis die ersten 10 000 Unterschriften gesammelt waren – analog auf der Strasse, vor allem aber digital auf einer webbasierten Plattform.
«Die ersten 24 Stunden sind entscheidend», sagt der Zürcher Daniel Graf, Kampagnenexperte und Onlineaktivist. Wie so häufig bei linken Kampagnen stand Graf auch der GSoA beratend zur Seite. Vor allem aber stellte er seine Onlineplattform «WeCollect» zur Verfügung, die es erlaubt, übers Netz Unterschriften für die Initiative zu sammeln.
Es ist nicht neu, dass online um Unterstützung für ein Anliegen geworben wird. Aber bislang beschränkte sich das im Wesentlichen auf Unterschriftensammlungen für Petitionen, die zwar symbolisch wirksam sein können, aber rechtlich nicht bindend sind. Daniel Graf gründete gemeinsam mit Donat Kaufmann vor einem Jahr «WeCollect», um das zu ändern. Über seine Plattform können ausgewählte Komitees seither auch Unterschriften für Initiativen und Referenden online sammeln. Komplett digital läuft die Unterschriftensammlung allerdings nicht: Man kann auf der Onlineplattform zwar Namen, Adresse und E-Mail angeben und erhält dann ein ausgefülltes und vorfrankiertes Dokument gemailt, aber man muss es noch immer handschriftlich unterzeichnen und in den Briefkasten werfen – so will es das Gesetz.

Wenn es nach Daniel Graf ginge, würde das sofort geändert. Seit Graf Ende April 2016 seine Idee von «WeCollect» umgesetzt hatte, wurden knapp 140 000 Unterschriften für neun Initiativen und Referenden gesammelt. Aber wichtiger als die einzelnen Initiativen ist für Graf der Aufbau eines Netzwerks, das sich immer wieder neu zusammenschliessen kann, um gemeinsam für ein Anliegen einzustehen. Wer bei «WeCollect» eine Initiative unterstützt, kann sich als Mitglied der Community eintragen und wird per Mail auf neue Initiativen oder Referenden aufmerksam gemacht. Mittlerweile hat Graf so ein Netzwerk mit knapp 20 000 Mitgliedern aufgebaut. Die nächsten Ziele sind klar: 50 000 Unterschriften braucht es für ein Referendum, doppelt so viele für eine Initiative. Eine Adresse allein bedeutet zwar noch keine Unterschrift, aber die Rücklaufquote von «WeCollect» beträgt laut Graf rund fünfzig Prozent – eine Zahl, von der Parteien oder NGOs mit Briefversänden oder Newslettern bloss träumen können.
Als Graf die Onlineplattform lancierte, bezeichnete die NZZ die Idee als «Unterschriftenautomaten» und befürchtete «Instantreferenden» von links. Davon ist Graf noch ein Stück entfernt, aber es ist schon richtig: Graf will nichts Geringeres als die Revolution der direkten Demokratie.
Wenig Mut zur Veränderung
Die Digitalisierung hat die Spielregeln in fast allen Lebensbereichen verändert – auch in der Politik. Heute werden politische Botschaften mit den Methoden der kommerziellen Werbung durchs Netz gejagt, in der Hoffnung, dass sie sich verselbstständigen und viral verbreiten. So ist es möglich, dass auch eine politisch relativ kleine Akteurin wie die GSoA mit der richtigen Vorbereitung und dem nötigen Glück kurzzeitig die weltweite Aufmerksamkeit auf sich und ihre Botschaft lenken kann.
Was kontrovers ist, wird geteilt und so verbreitet – das ist die Logik des Facebook-Algorithmus, der jene Meldungen verstärkt auf den Schirm bringt, die viele Reaktionen auf sich ziehen. Im US-amerikanischen Wahlkampf erreichten die fünf Top-Fake-News mehr Menschen als die fünf meistgelesenen echten Newsstorys. So erhielt die frei erfundene Meldung, dass der Papst Donald Trump zur Wahl empfehle, mehr als doppelt so viele Interaktionen wie der echte Aufruf eines ehemaligen CIA-Direktors, Hillary Clinton zu wählen.
Adrienne Fichter ist freie Tech-Journalistin und sammelt viele solche Beispiele. Die Politikwissenschaftlerin baute vorher bei der NZZ das Social-Media-Team auf, derzeit arbeitet sie an einem Buch mit dem Titel «Die Smartphone-Demokratie». Es soll im Herbst erscheinen und die grundlegenden Entwicklungen auf dem Weg hin zur digitalen Demokratie thematisieren: Fake News, Filterblasen, Hacking oder Microtargeting von Social-Media-NutzerInnen mit auf die EmpfängerInnen abgestimmten Botschaften. Sie untersucht, welche Felder der Demokratie die Digitalisierung berührt: welche Möglichkeiten der Partizipation sich dadurch ergeben, wie sie die Meinungsbildung beeinflussen oder neue Formen der Mobilisierung ermöglichen.
«Wir verbringen heute täglich zwei, drei Stunden in diesen Ökosystemen der sozialen Medien», sagt Fichter. «Räume wie Facebook sind sehr fragmentiert und folgen einer Logik, die einen unter Gleichgesinnten bleiben lässt. Das finde ich gefährlich.» Natürlich sei es auch in der analogen Welt so, dass man sich oft unter Gleichgesinnten bewege, aber Facebook verstärke diesen Effekt. Sie meint damit nicht nur die viel beschworenen Filterblasen (deren Bedeutung in jüngsten Untersuchungen relativiert wurde), sondern auch das gezielte Ausspielen von Inhalten an ausgewählte Gruppen. Im Moment sei dieses Targeting zwar nur für gesponserte Inhalte möglich. «Aber was ist, wenn das auch für den organischen Newsfeed von Facebook gilt? Wenn man das weiterdenkt, landen wir irgendwann an einem Ort, wo wir alle andere Identitäten haben, andere Realitäten. Es gibt keinen öffentlichen Raum mehr, wo wir unfreiwillig zusammensitzen und debattieren. Dann stirbt auch der Diskurs.»
Fichter sieht diese Entwicklung skeptisch, aber sie ist keine Netzapokalyptikerin. Die Digitalisierung der Demokratie ermögliche auch eine Vielzahl von neuen Formen der politischen Teilhabe. Fichter erwähnt Apps wie DemocracyOS, mit denen in repräsentativen Demokratien wie etwa in Argentinien oder Mexiko die Bevölkerung konsultativ eingebunden wird. Die Schweiz müsste als direktdemokratisches Land eigentlich ein ideales Spielfeld für derartige Versuche sein. Kein anderes Land stimmt so häufig über so viele Details des gesellschaftlichen Zusammenlebens ab wie die Schweiz. Und doch laufen die meisten Abstimmungskämpfe nach dem immer gleichen Schema mit nur wenig Innovation oder Mut zur Veränderung.
«Es passiert wenig in diesem Bereich», sagt Daniel Graf. «Es ist absurd: Wir leben im Jahr 2017 noch immer in einer völlig veralteten Briefkastendemokratie. Man muss die Demokratie pflegen und weiterentwickeln, sonst müssen wir uns in fünf oder zehn Jahren nicht wundern, wenn die Partizipation abnimmt. Wir machen Rückschritte, weil wir keine Fortschritte machen.»
Kampagnen in Guerillalogik
Daniel Graf: Aufgewachsen in der Zürcher Agglomeration, politisiert durch SVP-Hetzkampagnen und Wef-Proteste, aktiv in Grassroots-Bewegungen, Geschichtsstudium in Zürich und Berlin. Einstieg in den Journalismus beim «St. Galler Tagblatt» und der deutschen «Jungle World», dann Abzweigung in die Politik. Parteisekretär der Grünen Stadt Zürich, als sich die Partei in Grünliberale und Grüne spaltete. Mediensprecher der Gewerkschaft Comedia, Wechsel zu Amnesty International, wo sein Gesicht erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, weil Graf öffentlich über die Gefangennahme der beiden ABB-Mitarbeiter Max Göldi und Rachid Hamdani in Libyen Auskunft gab.
Damals machte Graf seine erste Onlinekampagne: Die Öffentlichkeit konnte virtuelle Kerzen anzünden und über den Kurznachrichtendienst Twitter Botschaften an Göldi und Hamdani schicken. Über 10 000 Personen beteiligten sich an «Kerzen für Libyen», und Graf sagt heute, er habe damals gelernt, dass man im Internet nur etwas bewegen könne, wenn es von unten wachse. «Eine Kampagne kann man nicht top-down verordnen. Die Leute wollen sich engagieren, sie wollen sich einmischen. Aber man muss ihnen auch die Möglichkeit dazu geben.»
Graf gehörte in der Schweiz mit zu den Ersten, die die Möglichkeiten von Digitalisierung und Internet in der politischen Kampagnenarbeit nutzten. Er begriff das Netz als demokratisierende Kraft, die es schaffen kann, Ungleichgewichte in der politischen Auseinandersetzung ins Wanken zu bringen. Seine Spezialität: mit kleinem Budget grosse Wirkung erzielen. Während Economiesuisse und die SVP wie Panzer über die Schweiz rollen, mit Millionenbudgets das Land vollplakatieren und Extrablätter in alle Haushalte verteilen, bewegt sich Graf mit seinen Onlinekampagnen wie eine kleine Guerilla: unberechenbar, agil, schlagkräftig.
Häufig setzt er dabei auf spontane Zusammenschlüsse. Er nennt das «chaotischen Pluralismus»: neue Formen, neue Leute, neue Netzwerke. Dabei sieht er sich als Verstärker, als Katapult, das die Botschaft in eine höhere Umlaufbahn bringt. «Die Zeit der Massenproteste ist vielleicht vorbei», sagt Graf. Und schiebt nach: «Sie sind zumindest nicht mehr unbedingt nötig.» Als Beispiel führt er eine Roboterdemo an, die er vergangenes Jahr für das bedingungslose Grundeinkommen organisierte. Gerade mal hundert Personen zogen als Roboter verkleidet durch die Bahnhofstrasse, aber sie erreichten damit eine weltweite Medienberichterstattung. «Es war die vielleicht kleinste Demo mit dem grössten Echo.»
Graf wird oft um Hilfe gerufen, wenn die Budgets schmal sind. Dann muss er experimentieren, Neues versuchen, die Grenzen des Möglichen ausloten: Um die Idee eines Grundeinkommens zu bewerben, verteilten AktivistInnen am Hauptbahnhof in Zürich etwa Zehnernoten, 2012 luden die Juso und er am Wef die TeilnehmerInnen in ein Protestcamp aus Iglus, vor der Fussballweltmeisterschaft in Brasilien 2014 simulierte er eine gehackte Fifa-Website und liess Sepp Blatter Samba tanzen, er erfand 2012 Ziggy Zaugg, einen überdrehten Tabaklobbyisten, der so für die Passivraucheninitiative der Lungenliga warb.
Man kann diese Kampagnen als PR-Stunts abtun. Aber Graf will das nicht so einfach gelten lassen. «Stark sind solche Aktionen nur, wenn sie gutes Kopfkino sind. Dafür muss wirklich etwas passieren: Die Iglus am Wef mussten gebaut werden und die Aktivisten darin übernachten, die Zehnernoten mussten tatsächlich verteilt werden und Louise Schneider die Nationalbank auch tatsächlich besprühen …»
Nun also arbeitet Graf an seinem bislang ambitioniertesten Projekt, der Demokratisierung der direkten Demokratie.
Die Schweiz als Briefkastendemokratie: Das ist das Bild, das Graf von der Schweiz immer wieder zeichnet. Die Mitbestimmung laufe heute nur über Papier und Briefmarken, dabei sei unser Alltag längst digital und online: Neun von zehn Haushalten sind ans Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen, rund fünf Millionen Menschen nutzen täglich ein Smartphone oder Tablet. «Aber die Digitalisierung der Demokratie lässt weiter auf sich warten.»
Das werde zunehmend zum demokratiepolitischen Problem. Zwar sind immer wieder Warnungen zu hören, dass die Demokratie wegen der gestiegenen Anzahl an Initiativen überlastet sei. Tatsächlich ist das niederschwellige Unterschriftensammeln auf der Strasse viel schwieriger geworden – auch weil Wählen und Abstimmen heute vielfach auf dem Postweg erfolgen. In der Stadt Zürich zum Beispiel stimmen mittlerweile rund achtzig Prozent der Stimmbevölkerung brieflich ab. Während früher ein Grossteil der Unterschriften direkt vor den Wahllokalen gesammelt werden konnte, kommen die nötigen Unterschriften heute vielmehr dank professionalisierter Abläufe zusammen. Oder anders gesagt: Eine Initiative an die Urne bringen kann, wer über eine grosse, gut gepflegte Adressliste verfügt – oder wer viel Geld hat. Die Kosten für die Sammlung zu einer Volksinitiative betragen heute schätzungsweise eine halbe bis eine ganze Million Franken.
Die digitale Unterschriftensammlung, wie sie Graf vorschwebt, würde diese Kosten massiv senken. Der Preis für eine einzige Unterschrift liegt auf seiner «WeCollect»-Plattform inklusive Porto bei rund fünfzig Rappen, er sinkt mit jeder Unterschrift. «Zwei Dinge sind wichtig geworden», sagt Graf. «Erstens: das Engagement. Die Leute wollen etwas tun. Zweitens, und das ist fast noch wichtiger: das Geld.» «WeCollect» vereinfache nicht nur das Sammeln von Unterschriften, sondern auch von finanziellen Mitteln. Die Botschaft laute nicht mehr bloss: Tu etwas! Sondern eben auch: Gib etwas! «Im Netz ist es möglich, kostendeckend zu sammeln. Wenn man es richtig gut macht, könnte man mit einer Unterschriftensammlung sogar den folgenden Abstimmungskampf mitfinanzieren.»
Zuviel Macht für einen Einzigen?
Andrea Arezina ist da skeptischer. Und sie weiss, wovon sie redet: Sie hat letztes Jahr mit dem «Dringenden Aufruf» 1,2 Millionen Franken gesammelt, um Plakate gegen die Durchsetzungsinitiative der SVP zu finanzieren, sie leitete erfolgreich die Kampagne gegen die Unternehmenssteuerreform III, und jüngst schaffte sie für das Onlinemagazin «Republik» den Weltrekord im Crowdfunding (über drei Millionen Franken in zwei Wochen). Aus Erfahrung sagt sie, das meiste Geld für eine Kampagne komme erst zusammen, während diese laufe, nicht schon bei der Unterschriftensammlung. «Eine Kampagne», sagt Arezina, «ist dann gut, wenn sie Online und Offline verbindet. Man muss den Leuten Möglichkeiten zur Teilnahme geben, dann sind sie auch bereit, etwas zu spenden.» Dazu brauche es gute Ideen, aber am Ende sei Campaigning eben immer auch Knochenarbeit. «Man muss die Leute zusammenbringen, gemeinsam Ideen entwickeln, diese dann aber auch umsetzen. Man muss genug Möglichkeiten bieten, dass alle, die etwas tun wollen, auch wirklich etwas tun können.» Das bedingt viel Koordination und Planung. «Wer am Ende einer Kampagne nicht erschöpft ist, hat etwas falsch gemacht.»
Auch Arezina sieht in der Digitalisierung Chancen für eine weiter gehende Demokratisierung: «Die SVP hat das Geld. Die Linken haben die Menschen.» Aber letztlich könne man das Handwerk noch so gut beherrschen und über eine grosse Community verfügen – ohne den richtigen Inhalt funktioniere nichts: «Die beste Mobilisierung allein reicht nicht. Du musst am Ende auch die besseren Argumente haben.»
Daniel Graf sieht das ähnlich. Campaigning sei in dieser Hinsicht ähnlich wie Domino: «Man kann die Steine noch so sorgfältig aufstellen: Ob sie wirklich richtig fallen, sieht man erst, wenn es losgeht.»
Die erste Initiative, die Graf vergangenes Jahr auf «WeCollect» laufen liess, war in dieser Hinsicht eine Enttäuschung. Die Transparenzinitiative, die eine Offenlegung der Parteienfinanzierung verlangt, schien auf den ersten Blick wie zugeschnitten auf das Netz. Aber bislang gingen seit einem Jahr online nicht mehr Unterschriften ein als bei der GSoA, die ihre Initiative vor einem Monat lancierte.
Besser lief es bei der Initiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub, das Aushängeschild von «WeCollect»: Über 55 000 UnterstützerInnen liessen sich einen ausgefüllten Bogen zuschicken, die Hälfte schickte ihn tatsächlich ab. Wenn die Initiative im Sommer eingereicht wird, wird ein Viertel der nötigen 100 000 Unterschriften über «WeCollect» gekommen sein.
Graf würde die Plattform gerne ausbauen. «Vielleicht hat ‹WeCollect› eines Tages 100 000 Mitglieder. Dann wären wir plötzlich ein ernst zu nehmender politischer Akteur für Initiativen und Referenden. Vielleicht entsteht so etwas, das jenseits der Parteien und NGOs existiert.»
Was, wenn Graf wirklich 100 000 Mitglieder vereinen könnte? Hätte er dann seine eigene kleine direktdemokratische Community, die er bei Bedarf abrufen könnte? Im Moment ist er der Einzige, der darüber entscheidet, welche Anliegen der «WeCollect»-Community vorgelegt werden. Graf winkt ab: «Derzeit ist das noch kein Problem, aber ich möchte in Zukunft nicht mehr alleine entscheiden müssen. Verschiedene Modelle sind denkbar.»
Im Moment sind diese Fragen allerdings noch eher theoretischer Natur. Denn im April hat der Bundesrat Grafs Plänen einen herben Rückschlag verpasst, als er E-Voting zur Priorität erklärte, aber das wesentlich weniger umstrittene E-Collecting auf die lange Bank schob. Für Graf ist das Ausdruck eines «stillschweigenden Pakts der Eliten». Er meint damit die Parteien, grossen Verbände und die Verwaltung, die nicht wollten, dass neue Player auftauchten. «Es heisst, die heutige Demokratie werde durch eine Initiativenflut überlastet. Ich halte das für ein Gerücht. Wir haben heute nicht zu viel Demokratie, sondern zu wenig. Dass der Bundesrat E-Collecting ablehnt, ist ein Entscheid gegen die direkte Demokratie.»
Schäferhunde vor der Nationalbank
Eine Stunde nach ihrer Sprühaktion stand Louise Schneider bereits wieder auf der Strasse. Vor dem Käfigturm, nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt, hielt ihr jemand einen Unterschriftenbogen für die Kriegsgeschäfteinitiative der GSoA hin, die sie bisher noch nicht unterschrieben hatte. Es war 9.03 Uhr, und Schneider schrieb sorgfältig ihren Namen, ihre Adresse und ihr Geburtsdatum hin: 19. 7. 31. Dann setzte sie in der Spalte ganz rechts ihre Unterschrift aufs Blatt.
Am Tag danach war von ihrer Tat nichts mehr zu sehen. Stattdessen standen drei uniformierte Soldaten mit Schäferhunden vor der Bauabschrankung der Nationalbank und hielten Wache.
«Schweizerzeit» lanciert «Tells Geschoss»: Crowdfunding für ganz rechts
Es war bloss eine Frage der Zeit, bis in der Schweiz eine rechte Organisation die Vorteile des Onlinepolitmarketings für sich entdecken würde. Seit kurzem ist es so weit: Die «Schweizerzeit», Presseorgan von Rechtsaussen Ulrich Schlüer, hat Ende April eine eigene Kampagnenwebsite lanciert.
Die Plattform mit dem Namen «Tells Geschoss» soll sich ausschliesslich auf die Finanzierung politischer Projekte und Kampagnen mit «dezidiert freiheitlicher» Ausrichtung konzentrieren, oder wie die «Schweizerzeit» das auch nennt: «rächti Sache». Crowdfunding befinde sich «auf dem Vormarsch», schreiben die Macher in der «Schweizerzeit». Und da wolle man «das Feld nicht den Linken überlassen».
Nicht minder militärisch umschreiben sie ihre Motivation weiter: «Bevor die Linken aufrüsten, wollen wir unsere Mobilisierung und Kampagnenfähigkeit weiter verbessern.» Für die Website verantwortlich zeichnet Anian Liebrand, der ehemalige Präsident der Jungen SVP und heutige Redaktor der «Schweizerzeit». Auf der Website werden verschiedene politische Projekte beworben, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Bislang ist allerdings nicht allzu viel Geld zusammengekommen.
Eine Informationskampagne gegen den «schleichenden EU-Beitritt» entlockte bislang vier UnterstützerInnen zusammen 370 Franken. Das Manifest «Ja zu einer starken Armee» wird von einer Person mit 1000 Franken unterstützt. Und für die finanzielle Unterstützung der Unterschriftensammlung zur Initiative für ein Burkaverbot konnten gerade mal zwei Menschen gefunden werden, die insgesamt 150 Franken locker machten. Das weitaus beliebteste Projekt ist zurzeit eine Gedenkveranstaltung zum 600. Geburtstag von Bruder Klaus: Neun Leute wollen dafür 11 600 Franken spenden, fast ein Viertel der erhofften 50 000 Franken.
Carlos Hanimann