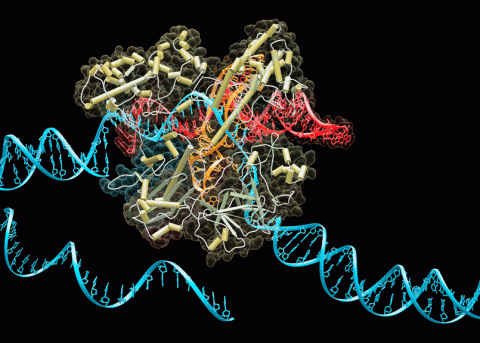Gentests vor dem Gesetz: Mutierte Schnipsel oder das Recht auf Nichtwissen
Wie Lifestyle-Gentests boomen, was Analysen des menschlichen Erbguts bringen und mit welchen ethisch wie sozial heiklen Fragen sich der Ständerat bald befassen muss.
«Übergewicht muss nicht sein!», steht in fetten Lettern auf der Homepage der Firma Progenom. «Planen Sie Ihre Mahlzeiten nach Ihren Genen!» Zwischen sechzig und achtzig Prozent des Übergewichts seien genetisch bedingt, behauptet die Firma – und bietet eine ganze Palette an genetischen Analysen an, die helfen sollen, die individuell optimale Diät zu finden. Solche Lifestyle-Gentests boomen. Rund 400 verkauft Progenom jeden Monat allein in der Schweiz, vorwiegend über Apotheken. Mittlerweile bietet eine Vielzahl an Firmen Gentests im Internet an. Das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG), vor erst zehn Jahren in Kraft gesetzt, muss angesichts dieser Entwicklung bereits revidiert werden. Am 30. Mai berät der Ständerat über den neuen Vorschlag, der die Bevölkerung besser vor möglichem Missbrauch schützen soll.
Bereits im März hat die GUMG-Debatte im Nationalrat für hohe Wellen gesorgt. Sollten Lebensversicherungen Einsicht in genetische Untersuchungen erhalten? Die Mehrheit lehnte das ab, der Ständerat muss jetzt nur noch darüber bestimmen, ob eine Einsicht im Fall extrem hoher Versicherungssummen zulässig ist. Für Zündstoff dürfte dafür die Frage sorgen, ob Firmen wie Progenom auch öffentlich Werbung für ihre Lifestyle-Gentests machen dürfen, wie es die Revision vorsieht.
Im Kern rührt die Sorge um das Missbrauchspotenzial von Gentests an die Frage, wie seriös und aussagekräftig genetische Untersuchungen überhaupt sein können. Und diese Frage geht weit über Lifestyletests hinaus.
Die grosse Dateneuphorie
Auf dem Genom ist die gesamte Erbinformation gespeichert, sie umfasst beim Menschen rund 25 000 Gene. Seit 2003 gilt mit dem Erfolg des Human Genome Project das gesamte menschliche Erbgut als entschlüsselt – was seither eine unglaubliche Forschungseuphorie ausgelöst hat, die mit der technologischen Entwicklung und Digitalisierung weiter Auftrieb erhält. Stichwort: Big Data. «Je mehr Daten wir erzeugen und je mehr Wissen wir vernetzen können, desto schneller werden wir Wege finden, um mehr Krankheiten zu heilen», prophezeite ETH-Vizepräsident Detlef Günther vor wenigen Wochen anlässlich der Lancierung zweier grosser nationaler Initiativen im Bereich Medizin und Big Data, die der Bund bis 2020 mit 118 Millionen Franken finanziert. Im Fokus: genetische Daten.
Peter Meier-Abt, Vizepräsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, setzt im Rahmen der Initiativen auf routinemässige Genomanalysen und hofft, dass bis in wenigen Jahren weltweit über zehn Millionen Genome sequenziert, also aufgeschlüsselt, sein werden, die für eine datengetriebene Gesundheitsforschung zur Verfügung stehen. Aktuellstes Vorbild ist eine kürzlich gestartete britische Populationsstudie, finanziert von sechs Pharmakonzernen: Bis 2020 wollen sie die Genome von einer halben Million Freiwilligen sequenzieren und – nach einer Frist von einem Jahr – in der UK Biobank öffentlich zugänglich machen. Diese würde damit zur weltgrössten medizinisch-genetischen Datenbank.
Molekularbiologen wie der ETH-Forscher Ernst Hafen oder George Church, Mitinitiator des Human Genome Project, rufen seit über zehn Jahren unermüdlich jede und jeden dazu auf, das eigene Genom screenen zu lassen – egal ob krank oder gesund. Beide haben mittlerweile eine je eigene Form der Biodatenbank ins Leben gerufen – Midata respektive Nebula Genomics –, in die man die eigenen Daten einstellen und selbst darüber entscheiden kann, wer für welchen Zweck Zugriff erhält.
Was ob all dieser Dateneuphorie vergessen zu gehen droht: Auch wenn grundsätzlich alle unsere Eigenschaften, unser Aussehen und unsere Begabungen in unserm Erbgut festgelegt sind: Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Gene. Umwelt, Erziehung und andere biologische Faktoren spielen ebenso eine Rolle. Wie intelligent jemand ist oder ob jemand an Krebs erkrankt, ist letztlich das Resultat eines extrem komplexen Zusammenspiels zwischen all diesen Faktoren. Kommt hinzu, dass man heute nach wie vor noch längst nicht die jeweilige Funktion aller Gene kennt. Was bedeutet das für die Aussagekraft von genetischen Untersuchungen?
Kausale Zusammenhänge fehlen meist
Weltweit sind die verschiedensten Formen von Gentests in Umlauf: von diagnostischen Tests, die bei ersten Krankheitssymptomen zum Einsatz kommen, über prognostische Tests, die eruieren, ob eine erbliche Veranlagung für gewisse Krankheiten vorliegt, bis hin zu Lifestyle-Gentests, die helfen sollen, den für die Gesundheit optimalen Lebensstil zu finden.
Wird das gesamte Genom gescreent, geschieht dies meist in Form einer genomweiten Assoziationsstudie. Dabei wird nach Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) gesucht, sogenannten Snips. Das sind Mutationen, die im Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen statistisch gehäuft auftreten. Daher gelten sie als mit der Krankheit assoziiert, ohne dass deswegen auch ein kausaler Zusammenhang bestünde: Ein Snip sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob ein bestimmtes Gen an der Entstehung einer Krankheit beteiligt ist oder nicht.
Die allermeisten Gentests, die über Firmen wie 23&Me oder Progenom vertrieben werden, basieren auf solchen Snips. Progenom etwa bietet – ausschliesslich über ÄrztInnen – eine ganze Reihe medizinischer Analysen an, darunter auch einen Test, der das Brustkrebsrisiko anhand von zehn verschiedenen «Genen» eruieren soll. Bei diesen handelt es sich aber lediglich um Snips. «Mit dieser Untersuchung lassen sich keine primär Krankheit verursachenden Varianten identifizieren», sagt die Humangenetikerin Sabina Gallati vom Inselspital Bern (vgl. «Was sollen die Leute mit diesen Zahlen?» ).
Gesicherte Aussagen zu einem Erkrankungsrisiko – also solche, die auf einem kausalen Zusammenhang beruhen – können nur diagnostische Tests bieten. Denn in diesem Fall werden einzelne Gene, Genabschnitte oder auch mehrere Gene sequenziert, von denen wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sie gewisse Krankheiten (mit-)verursachen. Bei Krankheiten wie dem Nervenleiden Chorea Huntington oder der juvenilen Form von Alzheimer, die von einem einzelnen Gen verursacht werden, bietet ein positiver Befund nahezu Gewissheit, dass die Krankheit ausbrechen wird.
Schwieriger wird die Aussage, sobald mehrere Gene in die Entstehung einer Krankheit involviert sind, etwa bei Brustkrebs. So trägt eine Frau mit Mutationen auf dem BRCA1-Gen zwar immer noch ein rund achtzigprozentiges Risiko, bis zu ihrem 70. Lebensjahr an Brustkrebs zu erkranken, doch gewinnen im Gegenzug präventive Massnahmen wie regelmässige Untersuchungen und ein gesunder Lebensstil an Bedeutung. Wo wie im Fall der allermeisten Krankheiten eine Vielzahl an Genen mitwirkt – und Umwelteinflüsse entsprechend wichtiger werden –, bietet eine ärztliche Familienanamnese oft die treffsicherere Voraussage für ein Erkrankungsrisiko als ein Gentest.
Schwierig zu interpretieren
Was namentlich das weitum propagierte Screenen des gesamten Genoms problematisch macht und die Gesetzeshüter in der Schweiz auf den Plan gerufen hat, erschöpft sich indes nicht allein in der fragwürdigen Aussagekraft solcher Gentests. Wie genomweite Assoziationsstudien produzieren nämlich auch sogenannte Hochdurchsatzsequenzierungen des Genoms, wie sie in der Diagnostik angewandt werden, viel Überschussinformation und damit auch Zufallsbefunde. Das, so die SP-Nationalrätin Martina Munz, wirft «heikle ethische und soziale Fragen» auf. Wie soll mit diesen Informationen umgegangen werden?
In den USA zum Beispiel wird bei einem Gentest routinemässig ein vordefiniertes Set von rund fünfzig Genen analysiert, die daraus resultierenden Befunde werden mitgeteilt – egal ob es die Getesteten wissen wollen oder nicht. Auch in Europa zeichnet sich unter HumangenetikerInnen zunehmend ein Konsens ab, Zufallsbefunde, die schwere gesundheitliche Konsequenzen haben können, den Betroffenen mitzuteilen – selbst wenn sich eine Person im Vorfeld des Gentests explizit dagegen ausgesprochen hat. «Das ist in der Schweiz undenkbar», sagt Humangenetikerin Gallati mit Blick auf die Revision des GUMG, durch die das Recht auf Nichtwissen explizit verankert werden soll. «Persönlich empfinde ich es als einen höchst problematischen Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen, wenn man sich da einfach drüber hinwegsetzt.»
Das revidierte GUMG verbietet im Fall von Lifestyle-Gentests sogar grundsätzlich, Überschussinformationen mitzuteilen. Ausserdem dürfen solche Tests nicht an urteilsunfähigen Personen durchgeführt werden. Ebenso verboten ist es, in der Pränataldiagnostik Eigenschaften ausserhalb des gesundheitlich relevanten Bereichs genetisch abzuklären oder mitzuteilen.
Für den Verein Biorespect geht die revidierte Vorlage des GUMG trotzdem noch zu wenig weit – gerade wenn es um eine seriöse und unabhängige Aufklärung über die Aussagekraft und die damit verbundenen Risiken von genetischen Untersuchungen geht. Biorespect will den Bund zu mehr Öffentlichkeitsarbeit verpflichten und kritisiert, dass auch die revidierte Vorlage nicht regle, wer überhaupt die vor- und nachgelagerte Beratung übernehmen dürfe und über welche biologisch-medizinischen Qualifikationen diese Personen verfügen müssten.
Die Firma Progenom jedenfalls steht bereits in den Startlöchern: Sie will künftig die Zusammenarbeit namentlich mit HausärztInnen in der Schweiz intensivieren. Sie plant, im Juli ein Schulungsportal für ÄrztInnen und medizinisches Fachpersonal im Internet aufzuschalten, über das diese «weiterführende Erkenntnisse über genetische Analysen erlangen können», wie Geschäftsführer Wilhelm Schöfbänker auf Anfrage mitteilt. «Beratung vor Ort mit Hilfestellung und Kontaktmöglichkeiten sehen wir als wichtige Voraussetzung für seriöse Genanalysen.»
Testen oder nicht?
Nur die wenigsten Gentests, so könnte man bilanzieren, sind also tatsächlich sinnvoll. Denn was ein erhöhtes Risiko, das meist in einer Prozentzahl ausgedrückt wird, tatsächlich bedeutet, ist von Krankheit zu Krankheit verschieden. Als Vergleichswert dient immer die Gesamtbevölkerung, und wenn das Erkrankungsrisiko bereits hier extrem niedrig ist wie etwa im Fall seltener Krankheiten, dann bedeutet auch ein vergleichsweise erhöhtes Risiko nicht viel.
Sein gesamtes Erbgut sequenzieren zu lassen, ist also in den allerwenigsten Fällen überhaupt sinnvoll. Eine wichtige Ausnahme bilden aber gerade bei seltenen Krankheiten diagnostische Tests: In ihrem Fall kann ein gezieltes genetisches Screening durchaus wertvoll sein, wie ein eben im «Lancet Oncology» publiziertes Forschungsprojekt zeigt. Es hat eine ganze Reihe sogenannter Prädispositionsgene identifiziert, die mit der Entwicklung eines bösartigen Hirntumors in Zusammenhang gebracht werden, der im Kindesalter ausbricht. Mutationen in diesen Genen werden vererbt, es besteht also, wie bei rund zehn Prozent aller Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, eine familiäre Veranlagung. Das internationale Forschungsteam hat ein genetisches Routinescreening für diesen spezifischen Hirntumor entwickelt und dazu in Deutschland ein «Register für Patienten mit erblicher Krebsdisposition» eingerichtet.
Solche Register sind enorm wichtig, wie die Humangenetikerin Sabina Gallati betont. Denn bei seltenen Krankheiten können einzelne ÄrztInnen kaum auf ihre Erfahrungen zurückgreifen und sind darauf angewiesen, sich über solche Register mit anderen ÄrztInnen auszutauschen, um die eigenen PatientInnen möglichst gut zu beraten und zu behandeln. Darüber hinaus spielen die in standardisierten Registern gesammelten Daten auch eine wichtige Rolle für die Entwicklung geeigneter Therapien und Medikamente.
(Prospektiven) Eltern allerdings wird dadurch erst einmal gar nichts erleichtert. Würden Sie sich oder Ihr Kind einem solchen genetischen Routinescreening unterziehen?