Drogen: Das Glück kommt, wenn das Ich schmilzt
Psychedelische Drogen zeigen erstaunliche Erfolge bei der Behandlung von psychischen Leiden. Hatten die Hippies doch recht? Verändert LSD die Welt?
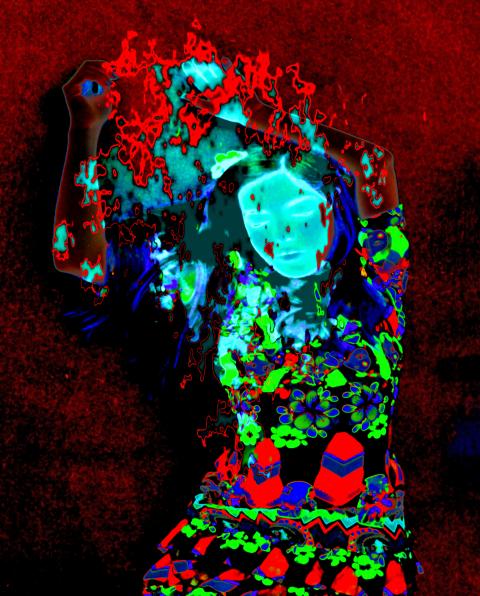
Was hilft gegen psychisches Leiden: Freud oder Prozac? Geht es um Kindheitstraumata oder um Hirnchemie? Braucht es Gesprächstherapie oder einfach nur ein Medikament? Diese Fragen polarisieren, denn in ihnen treffen Weltbilder aufeinander, die grossen Fragen nach dem Einfluss von Natur und Kultur. Sind wir Produkte unserer Erfahrungen oder unserer Gene? Oder sind schon diese Fragen falsch?
In der Praxis fällt die Antwort heute oft zugunsten der Chemie aus: Sie hat die einflussreichere Lobby, und es ist billiger, ein Medikament zu verschreiben, als eine Gesprächstherapie zu verordnen. Erschreckend viele Depressive nehmen sich trotz Behandlung das Leben, und nicht einmal die reiche Schweiz schafft es, den Zugang zu Psychotherapien für alle erschwinglich zu machen (siehe WOZ Nr. 11/2019 ).
Doch mitten in dieser selbst ziemlich depressiven Branche setzen einige Menschen grosse Hoffnungen in Chemie – in psychedelische Drogen. Denn LSD und Psilocybin, die beide ihren Ursprung in Pilzen haben, zeigen starke Wirkungen bei Depressionen, Suchtproblemen und Angststörungen. Die Berichte sind erstaunlich: Krebskranke, die vor Todesangst wie erstarrt sind, verlieren ihre Angst und können ruhig sterben. Depressive fühlen zum ersten Mal seit Jahren wieder Glück. Manche Alkoholiker und Raucherinnen schaffen es, ihre Drogen fast schon beiläufig links liegen zu lassen. Und das alles dank eines einzigen, hoch dosierten und von einer Fachperson begleiteten LSD- oder Psilocybintrips. Zu gut, um wahr zu sein?
Der Täter wird zum Pferd
Der US-amerikanische Sachbuchautor Michael Pollan ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Er hat Psychiater, Neurowissenschaftler und Versuchsteilnehmerinnen interviewt – und die Witwe des krebskranken Journalisten Patrick Mettes, der sich nach einer Psilocybinsitzung kurz vor seinem Tod als «glücklichsten Menschen auf Erden» bezeichnete. Für ihn und viele andere hat die psychedelische Erfahrung das Leben verändert. Sie sei «wie ein Urlaub vom Gefängnis meines Gehirns» gewesen, wie plötzliches Licht in einem dunklen Haus, wie das Abfallen eines Betonmantels, berichten Depressive. Ein von sexuellen Übergriffen traumatisierter Mann trifft den Täter – seinen Vater – auf dem Trip wieder: «Aber er war ein Pferd! Ein Militärpferd, das auf den Hinterbeinen stand, in Militäruniform und Hemd gekleidet, in der Hand ein Gewehr.» Der Sohn will flüchten, stattdessen blickt er der Gestalt in die Augen – «und fing sofort an zu lachen, es war so lächerlich. Und damit war der Horrortrip vorbei.»
Eine Raucherin sieht sich auf Psilocybin als «grässlichen hustenden Wasserspeier» und denkt seither jedes Mal, wenn sie rauchen will, an dieses eklige Bild. Anderen scheint das Rauchen plötzlich einfach belanglos, und sie hören ohne Mühe auf. Eine Alkoholikerin spürt erstmals Empathie mit sich selbst und kann ihren Selbsthass überwinden. Sie stürzt zwar immer noch gelegentlich ab, aber nicht mehr tagelang; für sie «stellt ein gelegentliches eintägiges Besäufnis einen Fortschritt dar».
Auch in der psychedelischen Therapie gibt es keine Wunderheilungen – vielen Depressiven ging es einige Monate nach dem Psilocybinversuch wieder schlechter. Und bei manchen psychischen Erkrankungen, etwa Psychosen, ist die Tripbehandlung keine Option, sie wäre viel zu riskant. Trotzdem: Wie kann eine einmalige Drogenerfahrung so viel verändern? Viele, die begleitet und in einer sicheren, stressfreien Umgebung LSD oder Psilocybin genommen haben, berichten von ähnlichen Erfahrungen: Oft entsteht ein Gefühl überwältigender Liebe – sogar eine überzeugte Atheistin, die Pollan interviewt hat, benutzt den Ausdruck «in Gottes Liebe getaucht». Genauso überwältigend ist die veränderte Wahrnehmung. Auf einem Psilocybinselbstversuch hat Pollan sogar beim Pinkeln ein mystisches Erlebnis: «In der Toilette herrschte ein Aufruhr aus funkelndem Licht. Der Wasserbogen, den ich hervorbrachte, war wirklich das Schönste, was ich je gesehen hatte.» Später hört der Autor Bachs Cellosuiten und fühlt sich selbst zum Cello werden. Relativ hohe Dosierungen der Drogen erzeugen oft ein Gefühl der Ich-Auflösung: «‹Ich› verwandelte sich in ein Bündel von Zetteln, nicht grösser als Post-its, und die wurden in alle Winde verstreut. (…) Es gab ein Leben nach dem Tod des Ichs.»
Das alles heisst nicht, dass es auf dem Trip immer harmonisch zugeht. Viele KonsumentInnen erinnern sich an verdrängte Erfahrungen oder erleben den eigenen Tod; häufig sind auch Geburtserlebnisse, und brutal durchgeschüttelt wird Pollan von der kurz, aber umso heftiger wirkenden Droge DMT: «Rückwärts durch vierzehn Milliarden Jahre rasend, sah ich, wie die Dimensionen der Wirklichkeit eine nach der anderen in sich zusammenfielen, bis nichts mehr übrig war, nicht einmal das Sein. Nur das überwältigende Dröhnen.» Doch sogar dieser Schrecken nimmt ein gutes Ende: Überglücklich, dass er seinen Körper wieder spürt und die Welt wieder wahrnimmt, verspricht Pollan, «nie zu vergessen, was für ein Geschenk (und Geheimnis) es ist, dass etwas und nicht nichts existiert».
Was tun mit solchen Erfahrungen? Manches, was Menschen auf dem Trip erleben, wirkt in der Beschreibung furchtbar banal – wie ein Hippieklischee halt:
«Liebe ist alles.
Okay, aber was hast du noch gelernt?
Nein, du hast mich wohl nicht gehört: Sie ist alles!
Ist eine so tief empfundene Plattitüde noch immer bloss eine Plattitüde?»
Hockt Gott im Hirn?
Pollan will auch die Chemie der Psychedelika verstehen und trifft Robin Carhart-Harris, einen britischen Neurowissenschaftler mit ungewöhnlichem Lebenslauf: Er ist auch ausgebildeter Psychoanalytiker. Als Student kam Carhart-Harris zum Schluss, dass Psychedelika einen wirksameren Zugang zum Unbewussten öffnen könnten als die von Freud empfohlenen Träume. Er hängte ein Neurowissenschaftsstudium an, blieb hartnäckig, bis er 2009 die Bewilligung bekam, mit Psilocybin zu arbeiten. Und er fand – nicht etwa den Ort, wo Gott im Hirn hockt. Zu seiner eigenen Überraschung stellte er bei Versuchspersonen auf Psilocybin einen Rückgang der Hirnaktivität in einem gewissen Bereich fest.
Nun sind bildgebende Verfahren bis heute eine relativ krude Angelegenheit: Es lässt sich zwar sichtbar machen, wo das Gehirn gerade wie stark «arbeitet», aber das allein sagt noch nicht viel aus. Trotzdem brachte diese Beobachtung Carhart-Harris auf eine spannende Fährte. Ein anderer Neurologe, Marcus Raichle von der Washington University, hatte nämlich um die Jahrtausendwende das Hirnareal untersucht, das auf Psychedelika zur Ruhe kommt: Das sogenannte Default Mode Network gilt als Sitz des Ichs, als die Hirnregion, die im Wachzustand die Leitung übernimmt und die menschliche Identität zusammenhält.
Es braucht also gar kein «Religionszentrum» im Hirn – der beste Weg zu transzendenten Gefühlen ist die Abschwächung oder Auflösung des Ichs. Eigentlich logisch: Wenn die Grenzen zwischen Innen und Aussen, zwischen Selbst und Welt verschwimmen, entsteht ein Gefühl der Verbundenheit mit allem – zumindest wenn die Erfahrung nicht als bedrohlich empfunden wird.
Und hier trifft sich die psychedelische Erfahrung mit der Meditation, die Hirnforschung mit dem Buddhismus, der das Ich schon immer als Quelle des Leidens bezeichnet hat. Erfahrene Meditierende berichten von einem ähnlichen – sehr positiv empfundenen – Gefühl von Ich-Auflösung wie KonsumentInnen psychedelischer Drogen. Bei beiden ist das Default Mode Network weniger aktiv.
Mehrere Wissenschaftler, die Pollan interviewt, sind überzeugt, dass viele psychische Leiden – Depression, Zwangsneurosen, Sucht – mit einem übersteigerten Ich zu tun haben, mit einem zu aktiven Default Mode Network. «Ein Grossteil menschlichen Leidens rührt von diesem Ich her, das um jeden Preis psychisch verteidigt werden muss», sagt etwa Matthew Johnson, der Psychologe, der die Psilocybinstudien mit RaucherInnen leitete. «Wir sind in einer Geschichte gefangen, die uns als unabhängige, in der Welt isoliert tätige Akteure betrachtet.»
Die psychedelische Erfahrung kann diese Geschichte ausser Kraft setzen und rigide, starre Identitäten aufbrechen. Pollan ist überzeugt, dass die Auflösung des Ichs der «weitaus wichtigste und gesundheitsförderndste» psychedelische Effekt sei. Die Frage, ob es um Körper oder Geist, Chemie oder Kindheit geht, löst sich auf: Der Dualismus ist falsch. Mystische Erfahrungen sind chemische Erfahrungen – aber das macht sie nicht weniger wertvoll.
Beschädigt und kostbar
Eigentlich ist das alles überhaupt nicht neu. Unzählige Kulturen auf verschiedenen Kontinenten nutzten psychedelische Drogen oder ohne Drogen erzeugte, aber hirnchemisch eng verwandte Trancezustände genau so wie die heutigen Psychedelik-TherapeutInnen: rituell, unter Anleitung erfahrener Personen. Nur der christlich-kapitalistische Westen witterte überall den Teufel.
Umso heftiger brachen die Psychedelika in den sechziger Jahren über Europa und Nordamerika herein. Patrick Mettes, der mit Psilocybin seine Todesangst überwand, beschrieb 2010 in seinem Tripprotokoll genau das, worauf mehr als vierzig Jahre früher viele Hippies gehofft hatten: «Ich sagte, dass jeder es verdient hätte, diese Erfahrung zu haben … dass dann niemand mehr einem anderen etwas antun könnte … dass es unmöglich wäre, Kriege zu führen.» Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Trotzdem beginnt der «irrationale Überschwang», den laut Pollan viele Forscherinnen und Therapeuten ausstrahlen, die mit Psychedelika arbeiten, verständlich zu werden. Man fragt sich unwillkürlich: Wenn noch viel mehr Menschen, nicht nur kranke, in einem sicheren, begleiteten Umfeld so etwas erleben könnten – würde das die Gesellschaft vielleicht doch verändern?
Die Gegenwart wirkt manchmal wie eine seltsame Neuauflage der Sechziger: Nicht nur die Psychedelika sind zurück, sondern auch die vielen Demos, die Angst vor der Atombombe, die polarisierten politischen Lager, und Yoga und Meditation boomen wie noch nie. Die Hippies wollten die Welt vom Konsumwahn befreien, und dieses Anliegen ist heute dringender denn je. Vielleicht sind Psychedelika einfach gute Werkzeuge für die Welt nach der Konsumgesellschaft. Denn das Glück im Materiellen zu suchen, ist schlicht nicht mehr möglich, wenn der Planet bewohnbar bleiben soll. Psychedelika sind die ressourcenschonendste und CO2-ärmste Form des Reisens. Und sie machen Ökologie körperlich erfahrbar: Alles ist verbunden und unendlich kostbar – sogar im heutigen, schwer beschädigten Zustand.
Michael Pollan: «Verändere dein Bewusstsein. Was uns die neue Psychedelika-Forschung über Sucht, Depression, Todesfurcht und Transzendenz lehrt». Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Verlag Antje Kunstmann. München 2019. 496 Seiten. 42 Franken.



