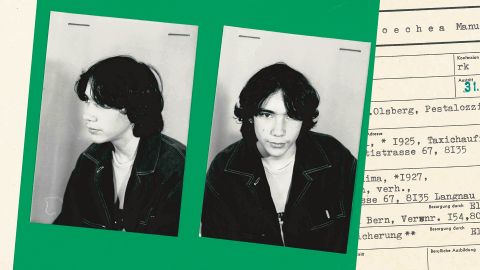Grundrechte: «Es gibt kein zu wenig oder zu viel an Härtefällen»
Jedes Jahr bläst die SVP von neuem zum Kampf gegen die Härtefallklausel. Diesmal gaben Zahlen des Bundes der Polemik Auftrieb. Rekonstruktion einer Sommerlochdebatte – und einige Argumente von Leuten aus der juristischen Praxis.
In dieser Hinsicht war es doch ein relativ normaler Sommer: Es brauchte bloss ein paar nüchterne Zahlenreihen – und schon rief die SVP, für die es nicht mehr gut läuft im politischen Alltagsgeschäft, «Skandal, Skandal!» ins mediale Sommerloch. Was war geschehen?
Sogenannte kriminelle Ausländer sind bekanntermassen das Lieblingsthema der Milliardärspartei. Umso mehr dürfte sie eine Publikation des Bundesamts für Statistik (BFS) von Ende Juni gefreut haben, bei der die Behörde erstmals umfassend die Folgen der 2010 angenommenen «Ausschaffungsinitiative» in den Fokus nahm. Demnach wurden 2019 insgesamt 58 Prozent aller AusländerInnen, die für Straftaten verurteilt wurden, auf die ein Landesverweis folgt, auch tatsächlich ausgewiesen. Diese – angeblich zu tiefe – Zahl konnte die SVP nun genüsslich ausschlachten.
Empörung und Rassismus
Wer die 58 Prozent für sich allein nimmt, bekommt aber ein unvollständiges Bild. Bei Freiheitsstrafen über sechs Monaten betrug die Quote nämlich schon 86 Prozent, tiefer war sie bei milden Delikten, die etwa Geldstrafen nach sich ziehen. Sie werden von der Staatsanwaltschaft üblicherweise per Strafbefehl erledigt, kommen also gar nicht vor Gericht. Um genaue Rechnungen schien sich die SVP allerdings nicht zu scheren, Schuld an der angeblichen Missachtung des Volkswillens soll gewesen sein: die Härtefallklausel.
Was folgte, war einmal mehr eine polemische Debatte. Der «Blick» war entrüstet, von einer «pfefferscharfen Umsetzung» der Ausschaffungsinitiative, wie sie die Bevölkerung gewollt habe, keine Spur. Und wie bei den ähnlich gelagerten Diskussionen in den letzten Jahren gab SP-Ständerat Daniel Jositsch gerne den Advocatus Diaboli: Auch «die Linke» sei empört. Den absoluten Tiefpunkt bildete dann die vor rassistischen Stereotypen triefende «Blick»-Schlagzeile vom «Kosovo-Delinquenten», «Spanien-Räuber» und «Serben-Schläger».
Später wurde zwar publik, dass die Zahlen im föderalen Dickicht (wie schon früher) unvollständig und fehlerhaft erhoben waren. Doch für die SVP, die im Parlament den Bundesrat ganze dreizehn Mal nach der Ausschaffungsstatistik gefragt hat, ist die Forderung ohnehin klar: Die Härtefallklausel, die den RichterInnen einen gewissen Ermessensspielraum bei Ausweisungen gibt, muss weg.
Wird die Härtefallklausel tatsächlich zu grosszügig interpretiert, wie das die SVP seit Jahren behauptet? Am besten lässt sich die Frage mit jenen klären, die in der Praxis mit potenziellen Härtefällen zu tun haben: den Anwältinnen und Richtern.
«Irritiert» von der Debatte um die BFS-Zahlen zeigt sich etwa der Schaffhauser Oberrichter Kilian Meyer. «Es ist grob fahrlässig, dass mit falschen Statistiken mit schlechter Datenqualität politischen Polemiken Vorschub geleistet wird.» Dies schade der Gewaltenteilung und dürfe nicht mehr passieren, findet Meyer – und fordert Konsequenzen. «Ich könnte mir vorstellen, dass der Auftrag in Zukunft extern vergeben wird und ein universitäres Team die Zahlen erhebt.»
Die Zürcher Anwältin Fanny de Weck, die von Ausweisungen bedrohte Personen juristisch vertritt, hält die Zahlendiskussion derweil grundsätzlich für verfehlt. «Im Strafrecht wird jeder Fall einzeln beurteilt, es gibt kein zu wenig oder zu viel an Härtefällen, keine Kontingente für Verhältnismässigkeit und Grundrechte», sagt sie.
Ein rechtsstaatlicher Notnagel
Die heutige Regelung ist das Produkt eines jahrelangen Ringens um die Umsetzung einer Initiative, die nach Ansicht vieler JuristInnen von Anfang an für ungültig hätte erklärt werden müssen, weil sie den Grundrechten widerspricht. Aus Angst vor der SVP hat sich das im Departement der damaligen BDP-Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf offenbar niemand getraut. Stattdessen wurde dem grundsätzlichen Ansinnen mit einem Gegenvorschlag erst noch Legitimität verliehen.
Die Annahme der Ausschaffungsinitiative hatte zur Folge, dass Menschen ohne Schweizer Pass nicht bloss für eine bestimmte Tat bestraft werden, sondern nach Verbüssung der Strafe automatisch das Land verlassen müssen. Mit diesem Automatismus widersprach die Initiative allerdings dem in der Verfassung verankerten Prinzip der Verhältnismässigkeit.
Vier Jahre später war der Ausschaffungsautomatismus dann vom Tisch: Der Ständerat setzte die Einführung einer Bestimmung durch, die den Gerichten erlaubt, in Härtefällen von einem Landesverweis abzusehen. Besonderes Augenmerk legte der Gesetzgeber dabei auf den Schutz der Secondas und Secondos: Der «besonderen Situation von Ausländern, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind», sei Rechnung zu tragen. Die Klausel war der letzte rechtsstaatliche Notnagel einer restriktiven wie diskriminierenden Praxis.
In der Zwischenzeit hatte die SVP schon ihre nächste Initiative lanciert, um «den Volkswillen durchzusetzen» und den mit der Ausschaffungsinitiative beschlossenen Deliktkatalog deutlich auszuweiten. Ihre «Durchsetzungsinitiative» sollte zudem den Druck aufs Parlament erhöhen. Nach einem emotionalen Abstimmungskampf mit breiter gesellschaftlicher Mobilisierung schiffte das Ansinnen im Februar 2016 an der Urne ab. Die vom Parlament beschlossene Härtefallklausel hatte damit auch die ausdrückliche Legitimation der Bevölkerung.
Problematische Ungleichbehandlung
Eigentlich müsste die SVP mit der Umsetzung ihrer Initiative zufrieden sein: Im Abstimmungsbüchlein hatte sie 1500 Ausschaffungen pro Jahr gefordert, gemäss der BFS-Statistik mussten 2019 beinahe 2000 Personen die Schweiz verlassen. Dass die Umsetzung durchaus Konsequenzen hatte, hält auch das Bundesgericht in einem Urteil vom Juni fest. «Mit der Gesetzgebung zur Landesverweisung wurde die bisherige ausländerrechtliche Ausschaffungspraxis massiv verschärft», heisst es darin.
«Die Strafkammer des Bundesgerichts legt in ihrer Rechtsprechung das Gewicht zu einseitig auf den vermeintlichen Willen der Initianten der Ausschaffungsinitiative, obwohl es die Verfassung als Ganzes zu berücksichtigen hat», kritisiert Migrationsanwältin Fanny de Weck. Gerade der Situation von Secondos trage das Gericht zu wenig Rechnung, beobachtet sie. Von Kuscheljustiz also keine Spur.
Grundsätzlich problematisch sei laut de Weck ohnehin, dass die Ungleichbehandlung Beschuldigter an der Herkunft anknüpft und nicht an der Straftat oder Gefährlichkeit einer Person. Dabei sei die Nationalität einer Person kein sachliches Kriterium für ein Strafverfahren. Vielmehr würde die Bevölkerung ohne Schweizer Pass doppelt bestraft.
Für Richter Kilian Meyer ist klar, was das Zahlengezeter bezweckt: Es sei nicht zuletzt ein Versuch, Druck auf die Gerichte auszuüben. Als Richter dürfe man sich davon nicht beeinflussen lassen, müsse die Härtefallklausel schon allein darum anwenden, weil der Gesetzgeber dies so verlangt. «Es erschwert unsere Aufgabe, jeden Einzelfall fair zu entscheiden, wenn ständig wiederholt wird, wir seien zu nachsichtig.»
Dass die SVP sich mit rechtsstaatlichen Argumenten kaum zufriedengibt, ist klar. Nationalrat Gregor Rutz hat bereits den entsprechenden Vorstoss für die Abschaffung der Härtefallklausel angekündigt. Kilian Meyer hält diese Entwicklung für gefährlich: «Steter Tropfen höhlt den Stein.»