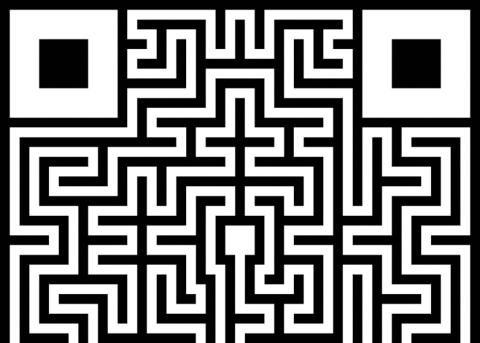Corona-App: Alarm ins Nirgendwo
Die Schweizer Corona-App sollte eine wichtige Stütze zur Eindämmung der Pandemie sein. Für die Kantone ist sie allerdings unbrauchbar. Im Fokus der Kritik: der strenge Datenschutz.
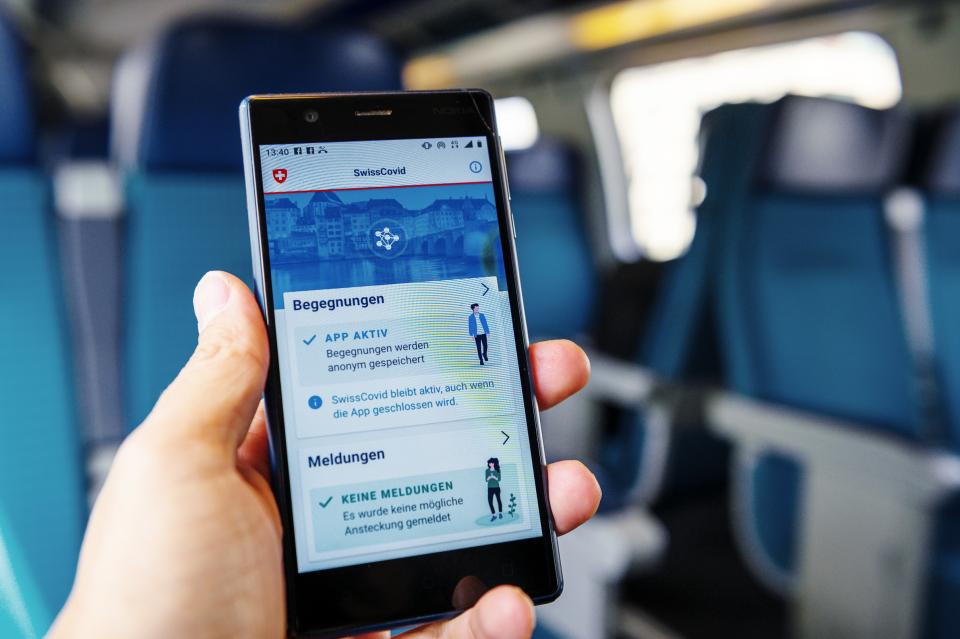
Die Swiss-Covid-App wurde als zentraler Pfeiler des Corona-Lockerungskonzepts lanciert: Eine wieder sehr mobile Gesellschaft erhielt vor zwei Monaten einen digitalen Aufpasser. Die Behörden erhofften sich eine möglichst flächendeckende Nutzung der App.
Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet werden, erhalten von den Behörden – falls sie die App installiert haben – einen Code, den sie in ihr Handy eingeben können. Die App verschickt daraufhin Warnmeldungen an alle NutzerInnen, die mindestens fünfzehn Minuten Kontakt mit der infizierten Person hatten. Effektiv genutzt aber wird die App derzeit nur von 1,5 Millionen Menschen. Und das ist nicht der einzige Grund, weshalb das Projekt zu einem riesigen Leerlauf zu verkommen droht.
Daten für den Informationsfriedhof
Beispiel Kanton Zug. Dort haben die Behörden bislang dreizehn Codes generiert. «Aufgrund der dadurch ausgelösten Warnungen hat sich aber noch nie jemand mit uns in Verbindung gesetzt», sagt der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri. Es sei offensichtlich, dass die Abläufe nach der Eingabe des Codes nicht funktionierten.
Wer von der App eine Warnung erhält, soll sich an eine Infohotline wenden. Deren Betrieb wurde vom Bund an die Firma Medgate ausgelagert. Dort verzeichnet man seit dem Aufschalten der App täglich rund 25 Anrufe von «Alarmierten». Die MitarbeiterInnen versuchen, in den Gesprächen herauszufinden, ob eine Quarantäne notwendig ist. Anordnen dürfen sie eine solche jedoch nicht. Das dürfen nur die KantonsärztInnen. Weil der Datenaustausch mit diesen aber nicht möglich ist, landen die Daten bei Medgate direkt auf dem Informationsfriedhof. Auch ein Quarantänezeugnis kann Medgate nicht ausstellen. Dieses würde den Betroffenen eine Lohnfortzahlung garantieren. Die Firma bemängelt: «Es gibt wenig Anreiz, sich selbst in Quarantäne zu begeben.»
Auch Rudolf Hauri wirkt nicht sonderlich überzeugt von der App. «Damit sie wirklich einen Beitrag ans sogenannte Contact Tracing, also das Aufspüren von Infektionsketten, leisten könnte, müsste sie viel präzisere Daten erheben», sagt er. «Wo ereignete sich der Kontakt? Wann genau?» Genau das aber verhindern die strengen Datenschutzbedingungen: Ort und Zeit der möglichen Ansteckung bleiben unbekannt.
Hauri ist Präsident der Schweizer KantonsärztInnen (VKS). Er sagt, seine Einschätzung decke sich mit Rückmeldungen, die er von AmtskollegInnen erhalte. Auch die Zürcher Kantonsregierung kritisiert auf Anfrage, dass man über die App nicht genauer über den auslösenden Indexfall informiert werde. Bei einem Teil der Alarmierten dürfte dies dazu führen, dass sie die Ansteckungsgefahr nicht ernst genug nehmen.
Kantone tappen im Dunkeln
Es ist denn auch unklar, wie viele Infektionen überhaupt über die App entdeckt wurden. Dem Kanton Aargau etwa ist kein einziger solcher Fall bekannt. Auch nicht dem Kanton Basel-Stadt. Ebenfalls im Dunkeln tappen die Kantone Solothurn und Bern. «Die App hilft uns nicht», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. «Sie ist aus Datenschutzgründen so aufgebaut, dass wir nur sehr wenige Informationen rausziehen können.» Dem Datenschutz sei bei der Entwicklung sehr viel Gewicht beigemessen worden – auf Kosten der Wirksamkeit bei der Kontaktrückverfolgung. Er beklagt: «Dieses Dilemma können wir jetzt nicht mehr auflösen.»
Steffen hat grundsätzliche Zweifel an der Funktionsweise der Swiss-Covid-App. Zum einen sei der gesamte Prozess für Betroffene zu wenig niederschwellig, zu komplex. Zum anderen stellt er die Praxistauglichkeit infrage: «Die App wurde nur in Modellen getestet.» Steffen wünscht sich eine wissenschaftliche Begleitung des jetzigen «gigantischen Experiments», damit die Schweiz die richtigen Schlüsse ziehen könne, «um vielleicht in zehn Jahren ein tragendes System zu haben». Bis dahin setzt Basel-Stadt auf Handarbeit. Siebzig Verwaltungsangestellte stehen bereit, um bei einem schnellen Anstieg der Fallzahlen Infektionsketten aufzudecken.
«Zehn Jahre? Ich würde sagen, ein paar Monate sollten reichen», erwidert Marcel Salathé, Leiter des Labors für digitale Epidemiologie an der ETH Lausanne. Salathé ist der prägende Kopf hinter der Swiss-Covid-App. Mit seinem Team hat er innert weniger Wochen die Software entwickelt. Zentraler Gedanke dahinter: Der Datenschutz muss sehr streng sein, damit möglichst viele Leute die App auch nutzen.
«Wenn die Kantone den Datenschutz kritisieren, nehme ich das als Kompliment», sagt er. Es gehe eben nicht nur darum, mithilfe der Warnmeldungen Infektionsketten aufzuspüren. Die App diene auch dazu, jene Ansteckungen abzufangen, die nicht im unmittelbaren Umfeld passierten. «Da erfüllt die App zweifellos ihren Job», sagt Salathé. Probleme ortet er vor allem bei den Behörden selber. An vielen Orten dauere es viel zu lange, bis ein Infizierter von den Behörden den Code erhalte. «Mich ärgert das», sagt Salathé. Womit er das zentrale Gefühl benennt, das jene teilen, die mit der App arbeiten: Frust.