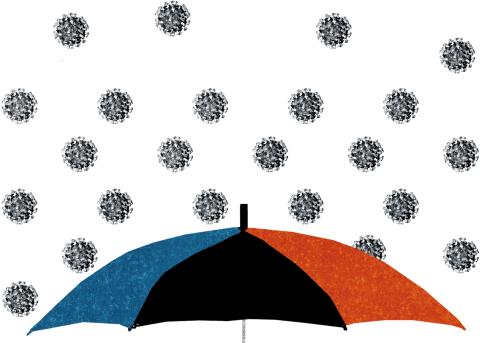Jugend und Corona: Sie verpassen alles und nichts
Die wohl lauteste Lebensphase spielt sich wegen der Pandemie im Stillen ab. Selbstorganisation ersetzt soziale Kontakte, Türen sind verschlossen, wo früher die Welt offenstand. Drei Jugendliche erzählen aus ihrem Leben auf Standby.

Die Haare sind ab. Sofia schmunzelt beim Gedanken an diese vielleicht etwas verrückte Aktion. Das Schmunzeln, eine Momentaufnahme. Das vergangene Jahr war alles andere als einfach für die Achtzehnjährige aus dem 2500-Seelen-Dorf am deutschsprachigen Ufer des Bielersees. Schliesslich war die Lust auf eine Veränderung grösser als die Angst davor, die langen blonden Haare abzurasieren. Es sollte ein Neuanfang sein, ein Schritt aus der zähen, klebrigen Masse der Pandemie. «Jetzt sehe ich wenigstens etwas anderes, wenn ich in den Spiegel schaue.»
Covid, der Türsteher
Sofia gehört zu jenen, die im Lockdown ihre Matur gemacht haben. Oder auch nicht. «Es war ein einziges Hin und Her», erzählt sie, die Unsicherheit sei riesig gewesen. Schliesslich der Abschluss ohne Ende. Sofia vergleicht ihn mit der Musik der achtziger und neunziger Jahre: Der Schluss des Lieds wiederholt sich x-mal und wird dabei immer leiser. Die Schule: ausgefadet. Was bei anderen Generationen Euphorie und gemeinsames Anstossen bedeutet, hinterliess bei ihr zwar auch ein Katergefühl, aber ohne Feiern.
Leicht verwirrt ob dieser Gefühlsmonotonie, lernte sie danach täglich sechs Stunden für den Eignungstest, der für das Medizinstudium notwendig ist, und bestand die Prüfung. Nur um sich gleich am ersten Tag an der Uni in Bern völlig fehl am Platz zu fühlen. «Die Masken und die Distanz haben alles noch schlimmer gemacht», sagt sie und blickt zu Boden. Für sie, die Zeit braucht, sich in neuer Gesellschaft wohlzufühlen, eine Herausforderung. Sie brach ab, ihre Welt fiel in sich zusammen. Als ob sie die Schwere dieser Geschichte ignorieren würde, blinzelt die Morgensonne ins Zimmer und wirft eine Zeichnung vor Sofia auf den Esszimmertisch. Der Blick aus dem Fenster zeigt sanft beleuchtete Feldwege und Wiesen des Bieler Seelands. Die junge Bernerin war bereits mit ihrer Hündin spazieren. Eine Struktur für die leeren Tage zu finden, musste sie sich selbst beibringen.
Die vierzehnjährige Debora verbringt ihre Tage in der zweiten Klasse der Zermatter Oberstufe. Für diese Struktur ist sie dankbar, der schulische Wiedereinstieg nach den Monaten des Lockdowns hat ihr im Herbst einiges abverlangt. «Das war richtig happig», sie schüttelt den Kopf, die Zeit ohne Präsenzunterricht hat sie zwar gemeistert, lerntechnisch ist aber einiges auf der Strecke geblieben. Nun, nach Schulschluss, streift ein Schwarm maskierter Jugendlicher in Gruppen durch die Chaletidylle.
Debbies Weg führt heute nicht direkt nach Hause, sondern in eines der vielen Hotels des Walliser Feriendorfs. Zweimal hat sie dort angerufen, ein E-Mail verschickt: keine Antwort. Der Übergang ins Berufsleben gestaltet sich schwierig, Covid stellt sich wie ein aufgeblasener Türsteher vor alle Schnuppermöglichkeiten. «Es ist zum Verrücktwerden», sagt Debora im Gehen, der Mund-Nasen-Schutz dämpft ihre Worte. Sie ist gesellig, könnte sich eine Lehre in der Kommunikation eines Hotels sehr gut vorstellen. Hier in der Tourismushochburg, wo ein Hotel sich ans nächste reiht, dafür keinen Einblick zu erhaschen, mutet absurd an. Ein Plan B? «Etwas im Gesundheitsbereich», sie lacht laut auf, «das ist noch schwieriger!» Zum Lachen findet sie das allerdings nicht immer, Zukunftsängste kennt sie nun nicht mehr nur aus Erzählungen.
Beim Hotel angekommen, tritt sie ein bisschen zögerlich in den Empfangsbereich. Sie hat Glück, die richtige Ansprechperson findet sich nach wenigen Minuten. Deren Reaktion hinterlässt einen fahlen Beigeschmack: Auf die Nachfrage von Debora hebt die Hotelmanagerin hilflos die Hände, die Augen über der Maske weiten sich. Man müsse flexibel bleiben, was heute gelte, könne sich morgen wieder ändern. Schutzkonzept. Fallzahlen. Nicht wissen, wie es weitergeht. Worte, die sich wiederholen. Debora darf trotzdem ihre Bewerbungsunterlagen schicken. Immerhin, sie möchte jede Chance nutzen. Sie habe aber auch Freundinnen, die die Suche irgendwann aufgegeben hätten.
Die Aufträge stapeln sich
Max hat die Zusage für seine Lehrstelle noch vor dem Lockdown im Frühling erhalten. Er sitzt nun täglich im weniger idyllischen Zürcher Kreis 3 hinter seinem Computer. Seit er die Lehre als Mediamatiker im Sommer begonnen hat, war er zwei Wochen auf der Geschäftsstelle. Die Not, sich selbst zu organisieren, hat erfinderisch gemacht. Durch Kopfhörer ist er während des ganzen Arbeitstags mit einem Lehrlingskollegen verbunden. «So kann ich mich immer austauschen», sagt er, das helfe gegen die Einsamkeit.
Die Arbeitstage sind intensiv, der Stapel an Aufträgen hoch. Ein bisschen lethargisch werde er schon, sagt der Sechzehnjährige, sein Volleyballtraining ist längst gestrichen, vom Bett ins Homeoffice sind es ein paar Schritte. Er teilt die Wohnung mit seinem Vater, dieser bildet im Stadtspital Triemli Personal für die Intensivstation aus. «Ich bin den ganzen Tag allein hier.» Apps zur Kommunikation waren für ihn zwar vorher schon wichtig, nun aber noch zentraler. Kaum fertig gearbeitet, schaltet Max die App Discord ein, man trifft sich online zum Plaudern. Eine willkommene Abwechslung nach dem Arbeitstag allein im eigenen Schlafzimmer.
Ohne Eigeninitiative verloren
Für Sofia gestaltet sich der Austausch schwierig. In den letzten Monaten hat sie sich eingeigelt. Social Media – nicht ihr Ding. «Mich stört es, wenn alle ihre Welt so kunterbunt darstellen», sagt sie, der Kontrast zu ihrer momentanen Gefühlswelt sei zu gross. Sich selbst in diesem Durcheinander wiederzufinden, braucht Energie. Seit sie im Herbst nach ihrem Uniabbruch in ein tiefes Loch gefallen ist, arbeitet sie sich langsam wieder hoch.
Auch für ihre Mutter war es eine Zeit voller Sorgen. «Irgendwann wusste ich, dass ich ihr nur noch helfen kann, indem ich ihr psychologische Unterstützung organisiere», sagt sie, ihre Stimme ist belegt. Eine Hilfe, die Sofia zwar annehmen konnte, die aber Geduld erforderte. Drei Monate wartete sie auf den Ersttermin bei der Psychotherapeutin, die Praxen sind total überlastet. Mit ihrer Mutter hat sie die Zeit überbrückt, Tagespläne gestaltet, Hausarbeitsämtli übernommen.
Ihre Hündin war die ganze Zeit über eine treue Freundin, die sie jeden Tag aus dem Bett gestupst hat. «Mit ihr musste ich aus dem Haus, da war immer der Gedanke: Sie kann ja nichts dafür», erzählt Sofia. Mittlerweile war sie dreimal in Therapie, versucht, diese Durststrecke ihres Lebens als Chance zu begreifen. Die Therapeutin habe etwas Schönes gesagt: dass dieser Stillstand nun die Gelegenheit biete, sich selbst abzutasten und herauszufinden, was sich alles hinter der Oberfläche verbirgt.
Für Debora waren andere Momente schwierig. «Am Anfang der Pandemie weinte ich manchmal, wenn ich mich wieder auf etwas gefreut hatte, das nicht stattfand», sagt sie. Abgesagt. Dieses Wort beeindruckt sie jetzt, ein paar Monate später, nicht mehr. Sie nimmt es hin und hält es aus. Hochgefühle? Tolle Erinnerungen? Dafür sieht sie sich selbst zuständig.
Ihr Vater bedauert es sehr, dass seine Tochter gerade jetzt, in ihrer Jugend, ihr Leben so zurückhaltend führen muss. «Die Jungen müssen doch raus, Freunde treffen», sagt er, ein Grundsatz, den auch Deboras Mutter vertritt. Sie haben sich mit anderen Familien organisiert, damit sich die Vierzehnjährige seit Pandemiebeginn in derselben achtköpfigen Gruppe Jugendlicher treffen kann. Sie schlitteln, bräteln draussen, sind mit Tourenskis am Berg, der Sport ist zentral. Später, in ihrem Zimmer, sagt sie dazu: «Ich weiss nicht, wie es mir ohne diese Gruppe ergangen wäre, wir haben uns gegenseitig sehr gutgetan.»
Die Stille mit Leben füllen
In der anbrechenden Dunkelheit tritt Max vor die Tür. Der Schnee türmt sich auf den Trottoirs und schluckt die wenigen Töne, die neben geschlossenen Bars und Läden bleiben. Er macht sich auf den Weg quer durch die Stadt zu seiner Freundin, so wie er es jede Woche zwei- bis dreimal tut. Es ist sein einziger Ausgang neben kurzen Treffen mit FreundInnen, obwohl die Vielfältigkeit der grössten Schweizer Stadt vor seiner Haustür beginnt.
Am Ziel angekommen, in ihrem Zimmer, Lichterketten an der Wand, macht er sich Gedanken zu ihrer Beziehung. Über zwei Jahre sind sie zusammen, die Pandemie hat sie noch stärker zusammengeschweisst. «Meine Freundin hat mir viel Halt gegeben, ohne sie wäre die Isolation schlimmer gewesen», sagt er. Direkte Kontakte, der direkte Austausch, sind Faktoren, die ihm wichtiger geworden sind. Seine Freundin sitzt auf dem Bett, streicht ihrer Katze über den Rücken und nickt. Auch für sie war die Beziehung in der Pandemie tragend. Was, wenn das gefehlt hätte?
Sofia sieht die Zukunft nun ein bisschen freundlicher auf sich zukommen. Neue Perspektiven beginnen sich abzuzeichnen. Debora wartet noch auf den Bescheid des Hotels. Und Max? Er freut sich auf einen gemütlichen Abend mit seiner Freundin. Der nächste Tag hält viel Arbeit bereit, er muss trotz kurzem Weg vom Bett ans Pult früh raus. Etwas Letztes aber noch. Er mache sich schon Sorgen, in gewissen Momenten nage die Angst an ihm. «Die Angst, dass das noch ewig so weitergeht und wir alle unsere Jugend verpassen. Dass wir alles, was andere Generationen ausprobieren konnten, nicht erleben dürfen.»