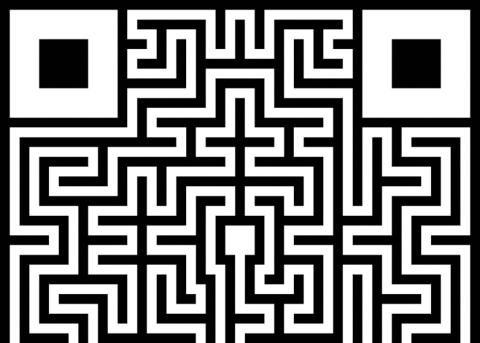Fünf Jahre danach: Das Leben mit Corona
Fünf Personen, die sich um vulnerable Bevölkerungsgruppen kümmerten, blicken zurück. Wie gingen sie mit den Auswirkungen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus um? Wie beurteilen sie die damalige Strategie des Bundes? Und was ziehen sie für Lehren?


Christian Dandrès, Gewerkschafter: Soziale Versäumnisse
Gerade die Anfangszeit rund um den Lockdown empfand ich als sehr herausfordernd – auf gewerkschaftlicher wie auch politischer Ebene. Es waren ja ganz neue Umstände. Wir mussten erst lernen, wie wir uns austauschen, organisieren und mobilisieren konnten. Heute sind Videocalls etabliert, damals war das nicht der Fall. Ich erinnere mich an Sitzungen der Finanzkommission, die in einer riesigen Halle des Bernexpo-Geländes stattfinden mussten statt im Bundeshaus, wo man sehr eng zusammensitzt.
Als Gewerkschafter und SP-Politiker war meine Perspektive vor allem auf soziale Fragen und die Arbeiter:innen gerichtet. Da stechen für mich drei Aspekte hervor – leider im negativen Sinn. Erstens: Die Schweiz ist ja ein Land der Mieter:innen, und diese Mehrheit der Bevölkerung wurde von der Politik im Stich gelassen. Während es bei den Geschäftsmieten wenigstens minimale staatliche Unterstützung gab, blieb diese für Privathaushalte komplett aus. Die von der rechten Parlamentsmehrheit vertretene Linie war: Nichts darf die Profite der Vermieter:innen stören, auch nicht in einer Pandemie. Das fand ich skandalös.
Zweitens vertreten wir beim VPOD mit den Lehrpersonen und insbesondere mit dem Pflegepersonal Branchen, von denen grosse Opfer verlangt wurden – gesundheitlich sowie in Bezug auf Arbeitsbelastung und Verantwortung. Aber bis heute sind die Arbeitsbedingungen in diesen Branchen äusserst streng und die Löhne tief geblieben, insbesondere in der Pflege. Das gibt mir sehr zu denken.
Am unwürdigsten – und das hat kaum Beachtung gefunden – war, drittens, die Situation der Sans-Papiers, der unsichtbaren und am schlechtesten gestellten Arbeiter:innen in unserer Gesellschaft. Viele von ihnen verloren von einem Tag auf den anderen ihr gesamtes Einkommen. Zu uns kamen Menschen, die erzählten, sie hätten ihre Möbel verkaufen müssen, um sich und ihre Kinder ernähren zu können. In Genf, wo ich lebe, gab es riesige Warteschlangen von Menschen, die für Lebensmittel anstehen mussten. Und das in der reichen Schweiz. Absolut beschämend.
Christian Dandrès (44) ist Präsident der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes VPOD und seit 2019 SP-Nationalrat für den Kanton Genf.
Aufgezeichnet von Jan Jirát.

Philip Tarr, Arzt: Vertrauen verspielt
In meiner Tätigkeit als Arzt würde ich rückblickend nichts anders machen. Ganz wichtig ist die patient:innenzentrierte Medizin, die wir auch während der Pandemie betrieben haben. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hätte aber anders kommunizieren sollen. Jahrzehntelang hütete sich das BAG davor, Impfungen zu kritisieren – in der Angst, damit Impfskepsis zu schüren. Mit der Kampagne «Das Problem ist nicht die Impfung, sondern Covid» kommunizierte das BAG ab Januar 2021 zu wenig nuanciert.
Denn während das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs mit fortgeschrittenem Alter stark ansteigt, konnte die Covid-Impfung für jüngere Menschen gewichtige Nebenwirkungen haben. Das Risiko einer Herzmuskelerkrankung war für einen geimpften Sechzehnjährigen etwa gleich hoch wie jenes, schwer an Covid zu erkranken. Zudem konnte die Gefahr einer Krankheitsübertragung durch die Impfung nur minimal gesenkt werden. Der Impfschutz diente in erster Linie den Geimpften, nicht der Gesellschaft.
Dazu lagen bereits im Oktober 2021 solide wissenschaftliche Daten vor. Trotzdem wurde die Zertifikatspflicht erst im Februar 2022 aufgehoben. Rückblickend dauerte auch der Lockdown zu lange. Insbesondere die Kinder hätten schneller wieder in die Schulen zurückkehren müssen. Die harten Massnahmen, die ergriffen wurden, haben einen sozialen Schaden angerichtet. Jetzt müssen die Behörden das verlorene Vertrauen wieder aufbauen. Eine differenziertere Kommunikation hätte das verhindern können.
Zwar kann ich nicht sagen, ob die Impfskepsis während der Pandemie allgemein zugenommen hat. Aber unsere Forschung sowie die von anderen zeigt: Immer wieder darauf zu pochen, dass Impfen sicher und wirksam sei, macht skeptische Menschen eher noch skeptischer. Diese Personen stellen Fragen, sie wollen mitreden können. Gute Impfberatung braucht Zeit. Aber diese fehlt Ärzt:innen im Alltag leider oft. Zwar schreibt das BAG vor, wie Ärzt:innen impfen sollen, nicht aber, wie ein gutes Beratungsgespräch geführt wird. Dabei wäre es wichtig, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und sie in Impfentscheide miteinzubeziehen.
Philip Tarr (56) ist Leiter der Infektiologie und stellvertretender Chefarzt für Innere Medizin am Kantonsspital Baselland. Von 2017 bis 2022 leitete er das nationale Forschungsprogramm NFP 74 zum Thema Impfskepsis.
Aufgezeichnet von Nyima Sonam.

Verena Mühlethaler, Pfarrerin: Ein ständiges Abwägen
Im Lockdown wählten wir unkonventionelle Methoden, um den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde zu zeigen, dass wir für sie da sind. Die Videoübertragung von Gottesdiensten etwa oder das Angebot «pastor to go», bei dem wir Seelsorgegespräche im Freien durchführen, sind bis heute geblieben. Um den Kontakt zu älteren Personen zu halten, telefonierten wir viel. Einmal brachten wir vielen unserer Mitglieder sogar einen Laib Brot vorbei.
Nicht alle Menschen waren gleich stark von den Coronamassnahmen betroffen. Gerade für Arbeitslose, Obdachlose, Geflüchtete und Sans-Papiers war die Zeit besonders hart. Gemeinsam mit Amine Diare Conde, dem Initianten der Aktion «Essen für alle», verteilten wir in der Kirche Essen an Bedürftige. Der Andrang war aber schnell zu gross, daher wurde die Aktion an einen anderen Ort verlegt. Danach stellten wir unsere Räumlichkeiten dem Ärztenetzwerk Medix zur Verfügung. So wurde die Kirche vorübergehend zur Impfstation.
Die Schutzmassnahmen wurden nicht überall gleich gut umgesetzt. Insbesondere in den Bundesasylzentren, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, gab es Zustände, die nicht den Vorgaben des Bundes entsprachen. In einem offenen Brief forderte der Verein Solinetz, der 2009 in unserer Citykirche Offener St. Jakob in Zürich gegründet wurde, mehr Raum, damit sich Asylsuchende schützen können. Vor dem Lockdown reisten jede Woche bis zu 160 Asylsuchende aus dem ganzen Kanton Zürich an, um gemeinsam in den Räumlichkeiten unserer Kirchengemeinde zu essen und Deutsch zu lernen. Das Geld für die Reisekosten, die das Solinetz bis dahin übernommen hatte, stand ihnen während des Lockdowns als Handyguthaben zur Verfügung. So konnten sie dem Deutschunterricht online folgen, und wir konnten den Kontakt per Telefon aufrechterhalten.
Während der Pandemie mussten wir ständig abwägen zwischen Schutzmassnahmen und dem psychischen Wohlbefinden derer, die unser Angebot nutzen. Heute würde ich den sozialen Kontakt stärker gewichten – und zugunsten der Menschlichkeit gewisse Vorgaben hier und da auch mal infrage stellen.
Verena Mühlethaler (52) ist Pfarrerin in der Citykirche Offener St. Jakob in Zürich. Als Kopräsidentin des Solinetzes Zürich und Mitglied im Netzwerk Migrationscharta.ch setzt sie sich seit vielen Jahren für geflüchtete Menschen ein.
Aufgezeichnet von Nyima Sonam.

Ursina Bachmann, Schulsozialarbeiterin: Austausch ermöglichen
Die Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges Angebot: Die Kinder kommen mit ihren Anliegen zu uns. Als während der Pandemie in der Schweiz vom 16. März bis zum 11. Mai 2020 die Schulen geschlossen blieben, war aber Kreativität gefragt, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wir entschieden uns, aktiv auf die Kinder und ihre Familien zuzugehen. Sie sollten spüren, dass wir weiterhin für sie da sind. Jenen Kindern, die sich zu Hause isolieren mussten, schickten wir einen Brief, und wir erkundigten uns per Telefon nach ihrem Wohlbefinden. Das wurde sehr geschätzt.
In den Gesprächen stellte ich grosse Unterschiede fest: Einige Familien brachten der Lockdown und das damit verbundene Wegbrechen des Alltags an den Rand ihrer Kräfte. Andere wiederum schätzten diese Zeit. Sie genossen es, gemeinsam zur Ruhe zu kommen und sich zurückziehen zu können.
Für die Schulsozialarbeit hatte die Telefonoffensive im Nachhinein betrachtet einen Werbeeffekt. Es meldeten sich mehr Eltern; durch den persönlichen Kontakt wirkte das Angebot für sie zugänglicher. Manche waren während der Pandemie sehr vorsichtig und schränkten sich und ihre Kinder stärker ein, als von den Vorgaben verlangt. In den Gesprächen war es mir daher wichtig, sie dabei zu beraten, wie sie ihren Kindern Sicherheit vermitteln können – auch wenn zu der Zeit vieles unsicher war. Würde es wieder zu einer Schulschliessung kommen, würde ich Eltern erneut dazu ermutigen, ihren Kindern im Rahmen der vorgeschriebenen Massnahmen den Austausch mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. Das kann auf kreative Weise geschehen, etwa indem man das Morsealphabet lernt und so am Abend mit der Freundin aus der Nachbarwohnung zu kommunizieren versucht oder indem man für einen Freund eine Schnitzeljagd organisiert.
Im Rückblick hätte ich gern mehr Gespräche persönlich geführt. Das wäre gerade für jene Kinder wichtig gewesen, die sich zu Hause nicht zurückziehen und allein telefonieren konnten.
Ursina Bachmann (45) ist Schulsozialarbeiterin. Sie arbeitet an zwei Schulen der Stadt Bern mit Kindern vom ersten Kindergartenjahr bis zur neunten Klasse.
Aufgezeichnet von Nyima Sonam.

Ruedi Höhn, Pensionierter Lehrer und Massnahmenkritiker: Verletzungen anerkennen
Rückblickend bin ich auf jeden Fall froh, dass ich bereits pensioniert war, als der Lockdown kam. Ich arbeitete früher als Primarlehrer, und es wäre sehr anspruchsvoll gewesen, in jener Zeit zu unterrichten.
Im Grossen und Ganzen würde ich fast alles gleich machen. Ich habe relativ normal weitergelebt und mich nicht zu stark verbogen, aber doch Rücksicht genommen, wenn mein Gegenüber Angst hatte vor einem Menschen ohne Maske. Dann habe ich ausnahmsweise kurz eine angezogen. Zudem suchte ich Ausweichmöglichkeiten. Zum Beispiel herrschte in meinem Bioladen strenge Maskenpflicht, also ging ich im kleinen Coop einkaufen. Dort ging es ganz vernünftig zu. Vielleicht hatte ich auch einen «Seniorenbonus» und wurde deshalb in Ruhe gelassen.
Aus heutiger Sicht hätte ich Kreise, die massnahmenkritisch waren, vielleicht noch stärker unterstützen können. Gemeinsam mit einer Kollegin half ich etwa einer Kindergärtnerin, die mit den Kindern immer nach draussen ging, statt in geschlossenen Räumen zu bleiben, wo Maskenpflicht galt. Wir kochten ihnen Tee und bereiteten das Znüni vor. Von solchen Unterstützungsaktionen hätte es mehr geben können. Anders als in unseren Nachbarländern waren die Einschränkungen hier ja weniger drastisch, es gab gewisse Spielräume.
Was mich bis heute beschäftigt, ist der mediale Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie. Ich war Abonnent des «Landboten» und auch der WOZ, habe aber beide Zeitungen abbestellt. Die massnahmenkritischen Menschen wurden als dumm und unsolidarisch dargestellt. Diese äusserst einseitige und diffamierende Berichterstattung führte leider auch dazu, dass die Kritik an den Massnahmen und der Widerstand dagegen den Rechten überlassen wurde. Dabei gäbe es viele zutiefst linke, kritische Fragen: Wieso etwa haben gerade Pharmakonzerne dermassen von der Pandemie profitiert?
Die sozialen Auswirkungen der Coronazeit beschäftigen mich weiterhin. Ich befasse mich eingehend mit den Themen Versöhnung und Zuhören und organisiere entsprechende Gesprächsrunden. Die Verletzungen und Ängste der jeweils anderen anzuerkennen, ist wichtig, um wieder aufeinander zugehen zu können, und zur Aufarbeitung für die kommenden Generationen.
Ruedi Höhn (75) lebt in Winterthur. Seit seiner Pensionierung gibt er Deutschkurse für Geflüchtete.
Aufgezeichnet von Jan Jirát.