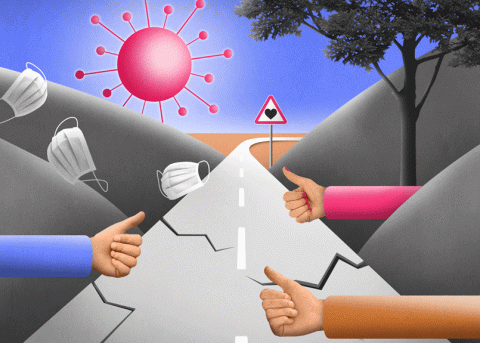Essay: Wir müssen aufhören, Geflüchtete als Personen zu sehen, die nicht rational denken können
Hören wir die Stimmen der Subalternen? Die Geschichten der AutorInnen Parwana Amiri und Seyid Hussein Husseini zeigen, wie geflüchtete Menschen daran gehindert werden, ihre Meinung und ihre Erfahrungen kundzutun.
«In der Nacht, wenn alle schlafen, finde ich die nötige Ruhe, um im Licht einer Taschenlampe zu schreiben», erzählt die Autorin Parwana Amiri. Ihre Worte sind schwer zu verstehen, Regen prasselt aufs Zelt. Das Licht ist milchig,
und es ist kalt an diesem Spätsommernachmittag in Zürich. Die BesucherInnen der antirassistischen Aktionstage «enough.» sind zahlreich erschienen zur Vernissage von Amiris gerade auf Deutsch erschienenem Buch «Meine Worte brechen eure Grenzen».
Es sind aber nicht nur die Kälte, die pandemiebedingte Distanz und das schwere Thema, die für eine trübe Stimmung sorgen: Parwana Amiri kann nicht vor Ort sein, sie spricht via Zoom. Die 2004 in Herat, Afghanistan, geborene Autorin erzählt von den Hintergründen ihres Berichts über das Alltagsleben im Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Sie erzählt von eigenen Erlebnissen oder von denen verschiedener BewohnerInnen des Lagers. Weitere Veranstaltungen in Zürich – im Literaturhaus, im jungen Literaturlabor Jull und am Theaterspektakel – wären mit der Autorin geplant gewesen. Aber dazu kommt es nicht.
Zwei Monate zuvor schicken der Deutschschweizer Ableger des AutorInnenverbands PEN-Zentrum und Amiris Zürcher Verlag, Essais agités, eine offizielle Einladung für die Autorin an das Staatssekretariat für Migration (SEM). Eine Odyssee beginnt, die über den Tisch von SEM-Direktor Mario Gattiker, nach Athen in die Schweizer Botschaft und schliesslich zum griechischen Minister für Migration, Notis Mitarakis, führt. Trotz neunseitigem Dossier und persönlicher Interventionen von Personen aus dem Kulturbereich erreicht Parwana Amiri am 17. September eine E-Mail aus der Botschaft in Athen: «Das Staatssekretariat für Migration gab gestern dem PEN-Zentrum bekannt, dass die Botschaft in Athen den Visa-Antrag abzulehnen hat.» Enttäuscht verschickt Amiri folgende Zeilen an das Publikum der Veranstaltung des Zürcher Theaterspektakels, an dem sie hätte auftreten sollen: «Ich fühle mich verspottet. Und ich weiss nicht, was ich tun soll, wen ich noch um Hilfe bitten kann, um diesen Zustand der Stockung zu beenden.»
Nach Belieben interpretiert
«Can the subaltern speak?» lautet die berühmte Frage der indischen Theoretikerin Gayatri Spivak, die sie in ihrem gleichnamigen Essay 1983 aufwarf. Einen subalternen Status nehmen laut Spivak vor allem die Menschen ein, denen es aufgrund kolonialer Ausschlussmechanismen verwehrt bleibt, für sich selbst zu sprechen. Weiter fragt Spivak: Werden subalterne Menschen überhaupt gehört? Oder verhallen ihre Aussagen ohne Resonanz, werden sie in die herrschenden Glaubenssysteme eingespeist und nach Belieben derjenigen interpretiert, die das Sagen haben? Hängt es weniger vom Inhalt als vom Status der Sprechenden ab, ob wir zuhören oder nicht?
Auch in der gegenwärtigen Berichterstattung über Migration wird oftmals auf das Textformat «Testimonial» zurückgegriffen, um gewisse Argumente zu untermauern oder auf Missstände hinzuweisen. Diese Berichte sollen in emanzipatorischer Absicht für sich selbst stehen. Der Akt des Sprechens droht den Bezeugenden dabei aber ständig zu entgleiten, indem sie niemals wissen können, ob ihnen zugehört wird, ob sie verstanden worden sind – sie können weder berichtigen, noch bekommen sie Gelegenheit, ihrerseits zuzuhören, zu fragen und zu antworten. Spivak kritisiert dieses Vorgehen auch deshalb, weil es dabei primär um die Erfahrung von Ausbeutung und Unterdrückung und nicht um die Analyse oder Überwindung der Situation durch die Betroffenen geht. Die Frage lautet also: Können Hierarchien erst im Dialog sicht- und fassbar und damit überwindbar gemacht werden?
Auf welche Kontexte sich die Analyse von Gayatri Spivak anwenden lässt, ist umstritten, und sie werden auch von der Autorin selber eingeschränkt. Zentral in ihrer Theorie ist aber die These, dass Subalternität das Ergebnis eines Diskurses ist, der bestehende Machtstrukturen durch systematische soziale Aus- und Eingrenzung reproduziert. Das zeigen auch die zwei in diesem Artikel beschriebenen Geschichten: Zusammen mit dem eingeschränkten Recht auf Bewegungsfreiheit legt der Status der Sprechenden den Diskussionsrahmen rund um Migration fest.
Wie Pingpongbälle
Parwana Amiri kommt im Winter 2019 mit einem Schlauchboot in Lesbos an. Als sie die hellen Lichter an der Küste sieht, ist das für die damals Sechzehnjährige einer der wichtigsten Momente ihres Lebens. Der Schrecken weicht der Hoffnung auf ein Leben in Würde und Frieden. Doch schon nach wenigen Tagen auf Lesbos werden diese Aussichten getrübt. Im berüchtigten Registrierungs- und Aufnahmezentrum Moria warten tägliche Überlebenskämpfe unter unmenschlichen Bedingungen und die ständige Gefahr vor Übergriffen und Gewalt.
Amiri beginnt, über das Leben der Menschen im Lager zu schreiben: «Wir sind in Moria nicht sicher. Und wir sind nicht aus unserer Heimat geflohen, um in Moria versteckt und gefangen gehalten zu werden. Wir haben nicht die Grenzen überquert und unsere Leben aufs Spiel gesetzt, um in Angst und Gefahr zu leben.» Mit diesen Worten beginnt der erste von insgesamt vierzehn Briefen an die Welt aus Moria. Aus der Perspektive verschiedener BewohnerInnen berichtet sie mittels eindringlicher poetischer Sprache über die Zustände im Lager und analysiert in aller Schärfe die Situation von Menschen, denen man nicht mal die Befriedigung von Grundbedürfnissen zugesteht: «Man behandelt uns anders, als man die Menschen auf Lesbos, in Griechenland oder in Europa behandelt. Unser Schicksal hängt von bürokratischen Entscheidungen ab; davon, ob der Migration ein ökonomischer und strategischer Wert beigemessen wird – oder nicht. Und nicht davon, dass wir alle miteinander verbunden sind, weil wir doch zur selben Art gehören.»
Amiris Texte wenden sich an politische EntscheidungsträgerInnen und an ein europäisches Publikum, das in der Regel trotz detaillierter Berichterstattung weitgehend unwissend über die Realität an den europäischen Grenzen ist, aber dennoch mitverantwortlich für die Zustände und die Gewalt in den Camps. «In einer Zeit, da Generationen zusammenstehen und sich austauschen sollten, um sich gegenseitig zu verstehen, ziehen die Menschen Grenzzäune in schwindelerregende Höhen, was zur Folge hat, dass Tausende ihr Leben verlieren – darunter Kinder, Jugendliche, schwangere Frauen und alte Menschen.»
Amiri trifft auf eine Gruppe von AktivistInnen von Welcome to Europe und Alarmphone. Zwischen ihr und den solidarischen Netzwerken entsteht ein Austausch. Ihre Briefe an die Welt aus Moria werden unter dem Titel «My Pen Won’t Break, but Borders Will» als Blog auf der Website von Welcome to Europe veröffentlicht. Nach dem Erscheinen einer englischen Version in Hamburg beschliesst der Zürcher Verlag Essais agités, die Briefe aus Moria in Deutsch und Französisch zu publizieren. In der Zwischenzeit werden Parwana Amiri und ihre Familie ins Ritsona Camp auf dem griechischen Festland verlegt. Amiri veröffentlicht ihre Texte weiterhin auf einem eigenen Blog, die sozialen Medien bleiben ihre wichtigsten Kanäle, um ein Publikum auch ausserhalb von Griechenland zu erreichen.
Die Visaabsage für Amiris Besuch in der Schweiz ist keine Überraschung, sondern entspricht einem Trend: Die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt hält in ihrer Analyse der «Worst Practices» aus dem Jahr 2019 fest, dass es für Kulturschaffende aus Afrika oder aus den arabischen «Krisenregionen» immer schwieriger werde, ein Visum für den Schengenraum zu erhalten. «In Europa spielt man mit uns wie mit Pingpongbällen. Die Behörden kicken uns von einem Amt zum nächsten, hin und her, ohne Ende», schreibt auch Amiri in ihrem Buch – die Odyssee rund um die Einladung in die Schweiz bestätigt das.
Am 9. September 2020 passiert, wovor viele seit Jahren gewarnt haben: Das Lager Moria brennt vollständig ab. Zehntausende Geflüchtete harren ohne Grundversorgung aus. Die Bilder von Menschen am Strassenrand gehen um die Welt. Doch die Forderungen nach einem Ende der katastrophalen Zustände und nach der Evakuierung des Lagers verhallen im Nichts. Innerhalb von drei Tagen wird Moria 2.0 errichtet, wo heute noch viel schlimmere Zustände herrschen als davor.
Kein «Katzensprung»
Kurz nach dem Brand lädt Moderatorin Barbara Lüthi verschiedene Gäste in die Sendung «Club» des Schweizer Fernsehens ein, um über die Frage «Moria brennt – Was tut die Schweiz?» zu diskutieren. Mit dabei sind Sozialarbeiter Rolf Widmer, die Berner Sozialdirektorin Franziska Teuscher, der frühere NZZ-Korrespondent Beat Stauffer, SEM-Direktor Mario Gattiker und der Student Seyid Hussein Husseini, der 2015 aus Afghanistan über Moria in die Schweiz gekommen ist und 2020 sein Buch «Die Überfahrt» veröffentlicht hat. Der Autor berichtet von seinem Aufbruch in Afghanistan bis zur Ankunft in der Schweiz. Insbesondere die Szenen auf dem Meer zwischen der Türkei und Griechenland sind von bedrückender Intensität. Wie ergeht es jedoch einem Autor, der es hierher geschafft hat? Welchen Raum kann er sich nehmen, um für sich selbst zu sprechen?
Während Teuscher, Husseini und Widmer die Aufnahme von obdachlos gewordenen BewohnerInnen aus Moria fordern, reden Gattiker und Stauffer von Hunderttausenden, die nur warten würden, ebenfalls in Richtung Europa aufzubrechen. Sie warnen vor den möglichen ungewollten Auswirkungen der Aufnahme von Geflüchteten aus Moria. Die Diskussion im «Club» dreht sich um die Verantwortung der Schweiz und darum, ob man evakuieren oder vor Ort helfen solle. Immer wieder geht es auch um die Person Seyid Hussein Husseini, um seine Fluchtgeschichte und seinen Status, wobei mehrmals in der dritten Person über ihn gesprochen und sein Asylverfahren und seine Befähigung zur Integration zwischen Lüthi, Widmer und Gattiker über seinen Kopf hinweg verhandelt wird.
«Das war nicht abgesprochen, und ich war schockiert. Es bestand die Einigung, dass wir über Moria sprechen. Stattdessen wurden im Fernsehen meine Person und mein Aufenthaltsstatus diskutiert», sagt Husseini im Gespräch mit der WOZ. Doch dabei bleibt es nicht. Beat Stauffer, der als «Migrations- und Maghrebexperte» vorgestellt wird, bezeichnet die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland als Katzensprung*: «Bei schönem Wetter von Assos nach Lesbos, das ist ein Ausflug. Man muss das auch nicht dramatisieren, finde ich.» Diese Aussage irritiert Husseini zutiefst: «Ich wollte mich dazu äussern, wurde aber unterbrochen. Was ist das für ein Experte, der solche Dinge sagt? Würde er sich eingehender mit den Leuten vor Ort beschäftigen, hätte er diese Aussage nicht gemacht.» Offensichtlich hat Stauffer Husseinis Buch nicht gelesen, in dem die Fahrt über das nächtliche Meer als beinahe tödlich endender Horrortrip beschrieben wird.
Die Sendung zeigt exemplarisch, wie Menschen aus subalternen Gruppen zwar in einem bestimmten Rahmen eine Stimme bekommen, aber dazu gezwungen werden, die für sie vorgesehene Rolle zu spielen. Dass Husseini auch Autor ist, wird nicht erwähnt. Er wird nicht ein einziges Mal zum Thema der Sendung befragt, ob die Schweiz Menschen aus Griechenland aufnehmen solle. Er ist als Beispiel und nicht als Teilnehmer für die eigentliche Diskussion vorgesehen. «Ich bin nicht einverstanden!», ruft er zum Schluss. Die Kamera behält ihn für wenige Sekunden im Fokus, während die Moderatorin sich verabschiedet.
«Ich bin nicht einverstanden mit dem, was die Behörden bezüglich Moria entschieden haben; mit dem, was in dieser Sendung behauptet wird, und ich will vehement dagegen halten, die Überfahrt als ‹Ausflug› zu bezeichnen», bekräftigt er im Gespräch: «Die müssen aufhören, Geflüchtete als Personen zu sehen, die sich keine Meinung bilden, die gesellschaftlich und politisch nicht rational denken können.» Als Teilnehmer der Diskussion werde ihm nicht derselbe Stellenwert zugestanden wie den anderen Beteiligten: «Mario Gattiker hatte am meisten Redezeit, obwohl er keine konkreten Antworten gab und versuchte, vom Thema abzulenken, indem er auf andere Probleme verwies. Es machte den Eindruck, als wäre die Moderatorin auf seiner Seite. Dabei sollten insbesondere die dominanten und einflussreichen DiskussionsteilnehmerInnen gebeten werden, zuzuhören.»
Archive der Wunden
Parwana Amiri wie auch Seyid Hussein Husseini wird auf je eigene Weise die Bühne verwehrt. Sie vertreten beide die sogenannt subalternen Stimmen Europas, denen es aufgrund wirtschafts- wie auch migrationspolitischer Strukturen schwer gemacht wird, sich Gehör zu verschaffen. Natürlich kann jede interessierte Person sich die Bücher von Amiri und Husseini kaufen und lesen – aber was passiert dann? In den meisten Fällen entsteht ein starkes Betroffenheits-, vielleicht auch Ohnmachtsgefühl. Und dann kehren die LeserInnen in ihre gewohnten Leben zurück, ohne geprüft zu haben, wie sie die Texte verstanden, inwiefern sie sie unbedacht in ihr eigenes Glaubenssystem eingespeist haben. Damit solche Berichte jedoch eine politische Wirkung entfalten, braucht es Reibung und Auseinandersetzung. Die Erfahrung, dass wir – unabhängig vom zivilrechtlichen Status – Wesen derselben Art und somit gleichberechtigt sein sollten, kann in der Begegnung gemacht werden, in der konkreten Beziehung. Im Angesicht der Person wird Einfühlung spürbar, durch die solcherart entstandene Nähe brechen Vorstellungen, die von Kategorien geprägt sind, zusammen. Betroffenheit kann sich zu Solidarität wandeln. Es braucht Amiris physische Gegenwart, und Husseini müsste im «Club» als gleichberechtigter Gast behandelt werden. In beiden Fällen sollten das Wissen, die persönlichen Erfahrungen und das jeweilige Expertentum der beteiligten Personen zur Geltung kommen.
Um das zu erreichen, müssten wir den konventionellen Archiven der «imperialen» Geschichtsschreibung andere Narrative entgegensetzen, sagt der Politikwissenschaftler Achille Mbembe. Und er fordert «Archive der Wunden, Archive der Solidarität. Denn wir brauchen das gesamte Wissen dieser Welt, um sie zu retten.» Diese Archive der Wunden müssten von jenen gefüllt werden, die den Schmerz erfahren haben, wie zum Beispiel Amiri und Husseini. Die Frage «Can the subaltern speak?» sollte durch die Forderung ergänzt werden, die materiellen und diskursiven Bedingungen, die diese Subalternität hervorbringen, gemeinsam zu überwinden. Mbembes Weltethik fordert das universale Recht auf einen würdigen Platz für jedes Lebewesen.
«Unsere Geschichte ist eine des Kampfes für universale Rechte. Die Realität zeigt jedoch, dass diese Kämpfe nicht zum Erfolg führen, weil man in Europa keine Geflüchteten haben, weil man ihre Stimmen nicht hören will», schreibt Parwana Amiri in «Meine Worte brechen eure Grenzen»: «Mit eurer Unterstützung kämpfe ich jedoch weiter, damit das Reiseverbot aufgehoben wird. Ich möchte unter euch sein. Ich möchte meine Worte mit meiner Stimme und meine Gefühle mit meiner Anwesenheit mitteilen. Nur so haben wir eine Chance, aus den Kategorien herauszutreten und als diejenigen gesehen zu werden, die wir sind.»
Mittlerweile stehen Amiri und Husseini in Kontakt und tauschen sich aus. Die nächste Einladung in die Schweiz folgt bestimmt.
* Anmerkung der Redaktion: Beat Stauffer setzt sich seit dreissig Jahren mit dem Maghreb und der Migration aus der Region auseinander, hat mehrere Bücher zum Thema publiziert und legt Wert darauf, dass er Migrations- und Maghrebexperte ist.
Parwana Amiri: Meine Worte brechen eure Grenzen. Briefe an die Welt aus Moria.. essais agités. Zürich 2020. 80 Seiten. 10 Franken
Seyid Hussein Husseini: Die Überfahrt. Zocher & Peter Verlag. Zürich 2020. 160 Seiten. 32 Franken
Johanna Lier: Amori. Die Inseln. die brotsuppe. Biel 2021. 324 Seiten. 31 Franken