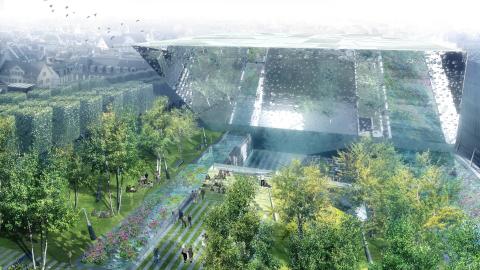Peter Weibel (1944–2023): Im Warenlift zu den Gedanken
Nicht das Reale wolle er zeigen, sondern das Mögliche. Der am 1. März überraschend verstorbene Konzeptkünstler, Schnelldenker und Vernetzer Peter Weibel wirkte die letzten zwei Jahrzehnte hauptsächlich vom süddeutschen Karlsruhe aus. Das dortige Zentrum für Kunst und Medien (kurz ZKM) wurde dank ihm zur international bekannten Adresse für Medienkunst. «Medien sind Erweiterungen unserer Sinnesorgane» war eines seiner Leitmotive.
Eingestiegen in die Kunst war er via den Wiener Aktionismus, als dieser noch symbolgewaltig die verklemmte Gesellschaft und Nazivergangenheit Österreichs blosslegte; bevor die geforderte sexuelle Befreiung dann vor allem als Triebabfuhr der männlichen Aktionskünstler daherkam. Weibels Aktionismus reichte in den sechziger Jahren bis in die Schweiz: Seine «Underground Explosion» brachte 1969 das Zürcher Volkshaus zum Zittern. Von seiner Gefährtin Valie Export liess er sich als Hund durch die Strassen Wiens führen (aktuell im Fotomuseum Winterthur zu sehen). Überhaupt: viel Körpereinsatz. So verschwand Weibel während eines TV-Vortrags «über das Ende der Zeit» langsam hinter dem Rot seines eigenen Bluts, das er sich live abzapfen und in einen Glasbehälter füllen liess, durch den er gefilmt wurde. Auch bei seinen legendären Aktionen war er stets das menschliche Medium zwischen Message und Publikum, etwa als er das Schild «LÜGT» unter die Gebäudeaufschrift «POLIZEI» streckte. Mit «Erweiterte Fotografie» stellte er bereits 1981 die Kamera und ihre technischen wie künstlerischen Möglichkeiten ins Zentrum, nicht die Abbildung von «Wirklichkeit». 1986 argumentierte er früh für «Personalcomputer an Kunsthochschulen». Und schon 1996 thematisierte er in der Schau «Inklusion und Exklusion», dass der Eurozentrismus in der Kunst sein Ablaufdatum überschritten habe. Prägend war auch, als Bilderstürmer Weibel mit dem Bildliebhaber Bruno Latour 2002 zur sogenannten Gedankenausstellung «Iconoclash» zusammenfand.
Geboren wurde Weibel 1944 in Odesa als Sohn eines Wehrmachtsoffiziers und einer deutschrussischen Mutter. Er wuchs in Geflüchtetenlagern auf, später bei Pflegefamilien, sagte dazu: «Ich war ein Schlüsselkind, ich war auf der Strasse. Ich musste lernen, alles selber zu machen.» Dass er blitzgescheit war, hat sicher geholfen. Der fehlende gutbürgerliche Habitus wirkte mittelfristig wohl auch eher befreiend. Noch in diesem Jahr wollte er nach Wien zurückziehen, in eine einfache, mehrstöckige Bibliothekswohnung mit Tausenden von Büchern und einem Warenlift als Schlafzimmer. Dazu wird es nun leider nicht kommen.