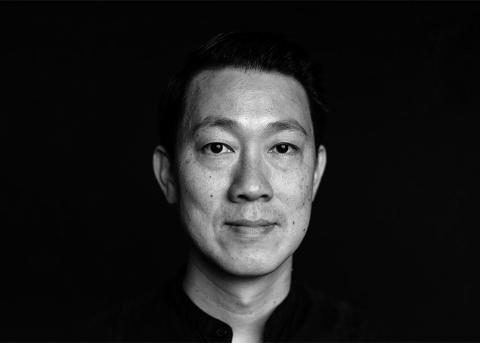Film: In den Abgründen der Abfallbeseitigung
Der österreichische Filmemacher Nikolaus Geyrhalter zeigt sich mit «Matter out of Place» erneut als Archivar des Anthropozäns.

Vom Wind verweht, bläht sich ein weisser Wolkenvorhang über einer blendend hellen Ebene. Fast reibt man sich im Kino die Augen, wo sind wir hier nur gelandet? Da, weit im Hintergrund, scheint sich für einen Moment die Silhouette eines Radfahrers abzuzeichnen, kurz darauf noch einer, näher jetzt. Und dann tauchen über ihnen Umrisse einer Ellipse auf, sie scheint auf Stelzen zu stehen, wie ein gelandetes Raumschiff. Aber halt, schwankt da nicht ein Mensch auf Stelzen daher? Irgendwann: Stimmen … eine Blaskapelle, sie klingt wie eine Fasnachtsgugge …
Die Bilder könnten passender nicht sein für einen Film mit dem Titel «Matter out of Place», der da erzählt von Dingen, die nicht hingehören, wo sie landen. Spuren, hinterlassen von menschlicher Zivilisation, die längst weg oder schon immer anderswo war. Diese Bilder tragen die Handschrift von Nikolaus Geyrhalter, dessen Werke immer wieder wie ein Requiem anmuten, «eine Videobotschaft aus einer nicht allzu fernen Zukunft», so war in dieser Zeitung schon über «Homo sapiens» (2016) zu lesen.
Wie Sisyphus bei der Arbeit
Geyrhalter würde das gefallen. Sein unbescheidener Anspruch ist, Filme zu drehen, die auch in einem Archiv der Zukunft noch lesbar sind. Man könnte sie als antididaktisch bezeichnen: Da gibts keine eingeblendeten Hinweise, die Orientierung oder gar Zusammenhang böten, nichts wird erklärt, meist fängt die Kamera Gespräche nur per Zufall ein, und an welchen Schauplätzen sie sich aufgehalten hat, erfährt man erst im Abspann.
Wie im rätselhaften Auftakt der Schlusssequenz, die dem neusten Werk den Titel verliehen hat und mit Menschen endet, die in langen Ketten mit verlängerten Pinzetten im Wüstensand auch winzigste Spuren (Kontaktlinsen!) der vergangenen Tage tilgen: Verfolgt vom schweren Atem eines Mannes und dem monotonen Geräusch seines Rechens, der den Boden kämmt, steht da endlich weiss auf schwarz «Burning Man Festival, Nevada».
«Leave nothing behind» lautet das Motto dieses Festivals, es steht auch sinnbildlich für das Thema von Geyrhalters Film. Er zeigt in manchmal minutenlangen, starren Tableaus die oft absurd, ja grotesk anmutenden Bemühungen, der wuchernden Abfallberge Herr zu werden, die wir Tag für Tag produzieren. Mitunter entbehrt das nicht einer gewissen Komik. Wenn zum Beispiel ein Bagger mitten im grünen Nirgendwo des Schweizer Mittellands zu graben beginnt und schon bald, wie einer der beiden Behelmten am Rand bemerkt, «Sackware» zum Vorschein bringt oder einen Zeitungsfetzen mit Werbung für Schokoladepulver, «Nestlé ist überall».
Anderswo auf der Welt zwingt einen die sture Kamera, Szenen zu folgen, die an griechische Mythen mahnen: in den Hügeln Nepals etwa, wo voll bepackte Lastwagenkolonnen, schwarze Abgaswolken ausstossend, zwischen Ziegen und Dorfbewohner:innen die Strasse hochächzen. Ein Laster bleibt im Schlamm stecken, spult, spuckt schwarz, bis er von einem herbeiratternden Trax aus dem Schlamassel geschoben wird. Der nächste Laster wartet bereits. Am weissen Sandstrand der Malediven, im Hintergrund Palmen und ein Luxusresort auf Stelzen, fischen Hotelangestellte angeschwemmten Plastikmüll aus dem türkisblauen Wasser. Auch das: Sisyphusarbeit.
Nachdenken über Verantwortung
Absurd muten solche Szenen nicht zuletzt in der Gegenüberstellung mit der Abfallentsorgung in reichen Ländern wie der Schweiz und Österreich an, wo in hochtechnisierten KVAs fast wie von Geisterhand gekippt, sortiert, geschreddert und verbrannt wird. Geyrhalters Kamera dringt dafür in die unmöglichsten Positionen zwischen Förderbändern und in Trommelgehäuse vor, hängt über tanzenden Matratzen und Möbelteilen, auf der Tonspur ein albtraumhaftes Knirschen, bis nach Minuten endlich die stählernen Zähne des Mahlwerks aufblitzen.
Nein, auch für die Ohren gibt es kein Entkommen – im Gegenteil. Geyrhalter verzichtet auf Musik und setzt stattdessen auf eine sorgfältig komponierte Tonspur mit übereinandergelagerten Originalaufnahmen. Der daraus entstehende Hyperrealismus unterfüttert und verstärkt die Absurdität des Gezeigten noch. Auf der gigantischen Deponie in Nepal, wo die Kamera Müllberge in harmonischer Symmetrie zu den grünen Hügeln rundum rahmt, lenkt erst ein Blubbern, das klingt, als brutzelten Spiegeleier in einer Pfanne, den Blick auf eine bräunliche Lache am unteren Bildrand, die Blasen wirft. Eine Heisswasserquelle? Wohl kaum.
Man könnte Nikolaus Geyrhalter auch als einen apokalyptischen Archivar des Anthropozäns bezeichnen. In «Pripyat» (1999) beschäftigte er sich mit der verbotenen Zone rund um Tschernobyl, in «Homo sapiens» mit den Ruinen, die wir hinterlassen, in «Unser täglich Brot» (2005) lag der Fokus auf der industriellen Nahrungsmittelproduktion und ihren Auswirkungen auf Tier und Umwelt, und in «Erde» (2019) stand der Raubbau durch Bergbau im Zentrum. «Matter out of Place» reiht sich nahtlos in dieses Werk, das den zerstörerischen Fussabdruck der Menschen auf der Erde zum Thema hat. Geyrhalter kommt dabei ohne moralischen Zeigefinger aus – er setzt ganz auf die Wirkung seiner langatmigen Tableaus, über die wir beim Betrachten ins Grübeln geraten.
«Matter out of Place». Regie: Nikolaus Geyrhalter. Österreich 2022. Jetzt im Kino.