Koloniale Währung: Eine Münze, die sich nicht festlegen lässt
Die Durchsetzungskraft des Kaptitalismus speist sich nicht unwesentlich aus seinen Schwächen und Widersprüchen. Das veranschaulicht die Geschichte der deutschen Rupieim heutigen Tansania.

In den sechziger Jahren wurde John Yogelo, ein hochbetagter Mann, von einem Studenten der Universität Daressalam interviewt. Die Forschung im dekolonialen Staat – Tansania hatte soeben seine Unabhängigkeit errungen – galt dem grossen Aufstand gegen den deutschen Kolonialismus, dem Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1907. Der Zeitzeuge erinnerte sich lebhaft an die Gewalt, mit der die Deutschen um 1900 die Steuern eingetrieben hatten. Noch stärker aber war ihm das Problem im Gedächtnis geblieben, was denn als Steuern gezahlt werden sollte: zuerst Hirse, dann Ziegen und schliesslich Bargeld. Um an Geld zu kommen, mussten Männer aber weit entfernt auf Plantagen arbeiten, deren Aufseher für ihre Gewalt berüchtigt waren.
Das Geld, von dem John Yogelo sprach, waren deutsche Rupien. Von 1890 bis zum Ersten Weltkrieg prägte das deutsche Kolonialreich eine eigene Währung für Ostafrika, die im heutigen Tansania, in Burundi und Ruanda gültig war. Diese Währung bestand aus einer Silbermünze mit dem Konterfei von Kaiser Wilhelm, die zunächst punkto Gewicht und Reingehalt exakt der indischen Rupie entsprach, die durch das British Empire im Indischen Ozean bereits verbreitet war. Wie John Yogelo war vielen interviewten Personen das koloniale Bargeld als ein Problem in Erinnerung: seine Materialität, seine Umwechslung und besonders der zeitliche Aufwand, den es bereitete, das Geld überhaupt erst zu behändigen.
Die Geschichte der deutschen Rupie ist eine politische Geschichte der Koordination und der Konkurrenz zwischen Imperien; eine Sozialgeschichte des gesellschaftlichen Mediums Geld, das heisst seiner Verbreitung und seiner Grenzen in den Gesellschaften Tansanias. Und es ist eine Geschichte der kulturellen Übersetzungsprozesse zwischen verschiedenen Wirtschaftsweisen, für die diese Währung das Interface darstellte. Anhand der deutschen Rupie lassen sich Strukturen und Assemblagen im globalen Kapitalismus studieren. Warum Strukturen? Die deutsche Rupie war nicht nur ein Medium kommerziellen Austauschs in Handelsnetzen, sondern als Währung auch eine versachlichte Sozialbeziehung, die durch Steuersysteme und das Regime der Lohnarbeit im kolonialen Herrschaftsverhältnis verankert war. Warum Assemblagen? Weil die Rupie ein heterogenes Ensemble aus Metallstücken und Abstraktionen, Messweisen und Zeitlichkeiten darstellte.
Meta-Erzählungen von Kapitalismus
«Kapitalismus» ist in der Geschichtswissenschaft erneut zum Schlüsselbegriff avanciert. Häufig wird darunter eine Wirtschaftsgeschichte in kulturhistorisch erneuertem Gewand verstanden. Und unter dem Mantelbegriff «Kapitalismus» halten rasch Meta-Erzählungen Einzug, die von Modernisierung, globaler Integration oder Konvergenz handeln. Kapital erscheint darin als Kraft, die auf der Jagd nach Märkten sämtliche Weltregionen umpflügt und unter dem Signum des Tauschwerts jede Sozialbeziehung einebnet. «Dampfwalzentheorien» des Kapitalismus hat der Historiker Timo Luks diese Meta-Erzählungen einmal genannt.
Geld und Konflikte
In seinem Buch «Geld an der Grenze» untersucht der Historiker Mischa Suter kapitalistische Konstellationen um 1900, die immer auch gesellschaftliche Konflikte spiegeln. Da wir im Zuge der Digitalisierung an der Schwelle zu einem neuen monetären Zeitalter stehen, ist diese Studie zur vermeintlichen politischen Neutralität des Geldes auch für die Gegenwart brisant.
Der vorliegende Text ist ein erweiterter Auszug aus dem Buch und eine gekürzte Version der Habilitationsvorlesung, die Mischa Suter letzten Herbst an der Universität Basel hielt. Suter hält eine Förderungsprofessur des Schweizerischen Nationalfonds am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf und ist Privatdozent am Departement Geschichte der Universität Basel.
Mischa Suter: «Geld an der Grenze. Souveränität und Wertmassstäbe im Zeitalter des Imperialismus 1871–1923». Verlag Matthes & Seitz. Berlin 2024. 446 Seiten. 40 Franken.
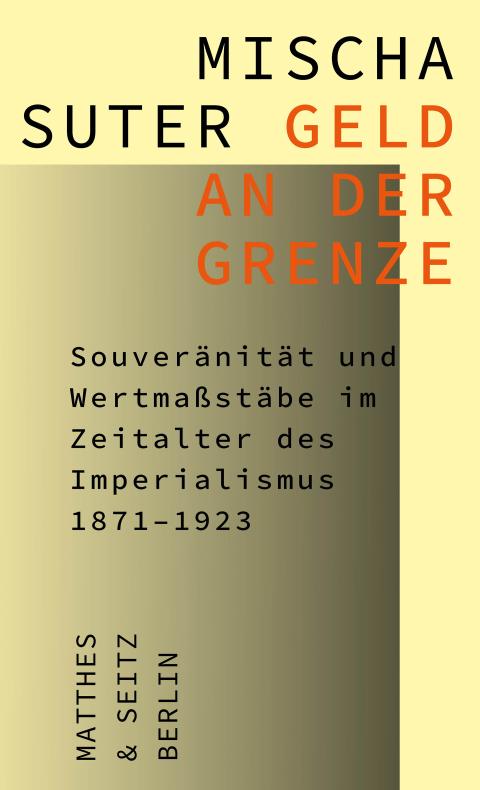
Doch die Geschichte des Kapitalismus geht weder in Wirtschaftsgeschichte noch in Globalgeschichte auf. Vielmehr kommt es darauf an, Kapitalismus historisch als widersprüchliche Gesellschaftsformation zu verstehen. In einer solchen Geschichte erscheint Kapital nicht als erhabene Macht wie in den Dampfwalzentheorien: Als Gesellschaftsformation betrachtet, reproduziert sich Kapitalismus nicht trotz Widersprüchen oder mit Widersprüchen, sondern genau durch seine Widersprüche. Von Rosa Luxemburg bis Kalyan Sanyal, von Theodor W. Adorno bis Melinda Cooper haben Sozialtheoretiker:innen mit ganz unterschiedlichen Programmen Kapitalismus in seinen gesellschaftlichen Bedingtheiten untersucht. Eine These zieht sich durch diese variantenreichen Theorien: Das Kapital stelle nicht einfach eine ökonomische Grösse dar, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis. Kapitalistische und nichtkapitalistische Beziehungen sind somit auf jeder Ebene verschränkt. Nicht nur steht Kapital in einem heterogenen Milieu, sondern Heterogenität ist in jeden einzelnen Moment eingelassen. Das zeigt auch die von Widersprüchen durchzogene Geschichte der deutschen Rupie in Tansania.
Goldwährung statt Silberwert
Als die Deutschen in Tansania das Geld einführen wollten, mussten sie feststellen, dass es bereits vorhanden war. Seit über tausend Jahren sind an der Suaheliküste Münzformen verbreitet. Sogenannte Warenwährungen wie Glasperlen, Kaurischnecken oder Baumwolltuch bildeten die am stärksten verbreiteten Tauschmedien. Träger in Karawanen, begehrte Arbeitskräfte, konnten es noch lange durchsetzen, ihre Löhne in amerikanischem Baumwolltuch, «merikani» genannt, ausbezahlt zu bekommen. Die Insel Sansibar war der kommerzielle Knotenpunkt der Suaheliküste. Dort verbreitete sich in den 1870er Jahren die indische Rupie, als der Einfluss des British Empire auf das Sultanat Sansibar zunahm.
Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck hatte zuerst eine Kolonisierung mittels privater Firmen im Sinn, die nach dem Vorbild der East India Company das Geschäft der Unterwerfung und Erschliessung betreiben sollten. Eine eigens gegründete Aktiengesellschaft, die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, übernahm diese Aufgabe und wurde mit Hoheitsrechten ausgestattet. Doch wenig später, 1888, bereitete ein Aufstand an der Küste der privaten Kolonisierung ein Ende. Das Münzrecht blieb trotzdem weiterhin bei der Firma. Ab 1890 emittierte die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft nun die deutsche Rupie in Silber und die Pesas, eine kleinere Kupfermünze. Die Anlehnung an die indische Währung entsprach den Interessen der hamburgischen Handelshäuser, die in der Region tätig waren. Sie unterhielten engere Beziehungen zu Indien als zu Deutschland, fungierten als Vertreter angloindischer Unternehmen und Banken und wollten, dass die Austauschbedingungen einheitlich blieben.
Weil die indische Rupie zunächst zu ihrem Silberwert getauscht wurde, störte ein deutsches Äquivalent nicht: Ob Wilhelm oder Victoria draufstand, war einerlei, solange beide Münzen gleich viel Silber enthielten. Die kleineren Kupferpesas aber kursierten als sogenannte Scheidemünzen: Ihr Kurswert lag höher als ihr Metallwert. Mit dieser Spanne zwischen Kurs- und Metallwert machte die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft Gewinn. Seigniorage nennt man diesen Profit, der aus der Souveränität der Geldausgabe entsteht, den Gewinn also, der von der Definitionsmacht über das Geld selbst herrührt. Auf der Jagd nach der Seigniorage prägte die Firma zeitweise so viele Kupfermünzen, dass sie die Küstenmärkte damit überschwemmte. Dieses Überangebot an Kleinmünzen erodierte die fundamentalste Geldfunktion überhaupt, nämlich die Funktion des Geldes als Wertmassstab.
Normalerweise erga ben 64 Pesas eine Rupie, so wie 100 Rappen einen Franken ergeben. Aber die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft warf so viele Pesas in Umlauf, dass dieses Verhältnis zu 76, manchmal gar 84 Pesas pro Rupie verrutschte. Bildeten also Pesas und Rupien eigentlich die kleinere und grössere Einheit derselben Währung (wie Rappen und Franken), so kippte dies bei der forcierten Pesa-Emission in ein bewegliches Verhältnis wie zwischen zwei verschiedenen Währungen mit einem Wechselkurs. Dadurch geriet der Wertmassstab selbst in Bewegung, als wären auf einmal 110 Rappen ein Franken. Die Seigniorage zeitigte paradoxe Effekte – die Definitionsmacht über das Geld untergrub den Massstab an sich.
Dann geschah im Jahr 1893 etwas Unerwartetes, das die Spielräume und Risiken der Geldemission in Tansania vergrösserte: Das British Empire löste die indische Rupie schrittweise vom Silberwert und koppelte sie an das Pfund Sterling, eine Goldwährung. Der Grund dafür lag im weltweit sinkenden Silberpreis, der wiederum mit der Verbreitung des Goldstandards zusammenhing. Verschiedene Imperien begannen, mit Goldwährungsstandards zu experimentieren: Das koloniale Geld wurde nicht an Gold direkt, sondern an die metropolitane Goldwährung gekoppelt.
Medium der Unterwerfung
Rassistische Vorstellungen standen bei zahllosen kolonialpolitischen Massnahmen Pate. Aber Geldpolitik wird meist nicht in diesem Kontext und als rein technokratische Angelegenheit betrachtet. Überhaupt erweckt Geld den Anschein einer farblosen Macht, übersetzt doch das allgemeine Äquivalent «Geld» unterschiedliche Partikularitäten in austauschbare, abstrakte Werte. Doch das Beispiel der deutschen Rupie steht quer zu solchen Vorstellungen, die Geld als generalisierende Instanz auffassen. Denn die Währung sollte aktiv eine rassistische Hierarchie setzen. Die Neuausrichtung der Währung zielte darauf ab, die «farbigen Zwischenhändler in stärkerem Masse als bisher unter die Kontrolle der in Deutsch-Ostafrika und Zanzi bar interessierten deutschen Firmen zu bringen». So formulierte es der Architekt dieser Währungsreform, Karl Helfferich, ein deutscher Ökonom, Bankier, zeitweise Reichsvizekanzler und nach dem Ersten Weltkrieg ein Wortführer der ultranationalistischen Rechten. Osmanische und indische Händler mussten sich nun an deutsche Instanzen wenden, wenn sie Rupien eintauschen wollten. Denn die deutsche Rupie zirkulierte nun nicht mehr gleichwertig mit der indischen Rupie, sondern das Wertverhältnis in der Markbindung der Währung, wonach vier Mark drei Rupien entsprachen, war leicht tiefer angesetzt worden als das Verhältnis zwischen Sterling und indischer Rupie.
Vollends ein Medium der Unterwerfung stellte die Währung für die afrikanische Bevölkerung dar. Letztere kam über den Steuerzwang überhaupt erst mit dem kolonialen Geld in Kontakt. 1898 führte der Kolonialstaat die sogenannte Haus- und Hüttensteuer ein. Besteuert wurden zunächst Bauten, nicht die einzelnen Menschen. Menschen konnten abtauchen und waren schwer zu zählen, Behausungen verschwanden weniger schnell. Trotzdem beobachteten Beamte, wie Bauten abgebrochen wurden und ganze Dörfer abwanderten. Die Form der Besteuerung hatte nichts mit Familienstrukturen, Siedlungsformen oder Vermögenslagen zu tun. Der Vorstellung, dass ein Mann als Familienoberhaupt einer Unterkunft jährlich drei Rupien zu bezahlen habe, stand die Tatsache entgegen, dass verschiedene Frauen einer Familie in eigenen Behausungen lebten. Das Bezirksamt Tanga meldete etwa 1898: «Jede verheirathete Frau wohnt in einer Hütte für sich allein, höchstens mit ihren ganz kleinen Kindern; etwas grössere Kinder wohnen nach dem Geschlechte getrennt in besonderen Hütten – ‹mbweni› genannt. Selbst unter Hinzurechnung aller Kinder dürfte die Durchschnittszahl pro Hütte im Dorf kaum 4 Köpfe […] ergeben.»
Die Steuer galt in mancher Hinsicht als Erfolg, die Erträge verdoppelten sich alle fünf Jahre. Dennoch blieb die Durchsetzung sehr flickenhaft. In den ersten Jahren machte der Kolonialstaat immer noch mehr Einnahmen mit der Seigniorage, dem Münzgewinn zwischen Kurs- und Metallwert der Währung, als mit den Steuern. Ein Gouverneur nannte die Steuern denn auch ein Erziehungsmittel, das die Lohnarbeit auf Plantagen erzwingen sollte. Steuern stellten den Hebel für das koloniale Geld, das wiederum den Hebel für die Lohnarbeit stellen sollte.
Vier Varianten wurden dazu erprobt. Erstens hatten Steuerzahler:innen Bargeld in die Hände zu bekommen. Zweitens wurde Zwangsarbeit für Strassenbau oder Plantagenarbeit durchgesetzt. Drittens sollte die Landwirtschaft in bestimmte «cash crops» gelenkt werden, indem beispielsweise Sesam als Naturalzahlung angenommen wurde. Viertens wurden Arbeiter:innen auf den – insgesamt wenig verbreiteten – Plantagen im Nordosten vom Steuerzwang befreit, was einen Anreiz schaffen sollte, sich auf den Plantagen zu verdingen. Historiker:innen der ostafrikanischen Arbeitsgeschichte sind zum Schluss gekommen, dass der Steuerzwang die Lohnarbeit kaum durchzusetzen vermochte. Wer immer konnte, suchte sich der Gewalt der Plantage zu entziehen. Das Hauptproblem blieb aber bestehen – nämlich das koloniale Geld überhaupt in die Hände zu bekommen. Aus dem Umland der Stadt Tabora wurde berichtet, dass man zehn Tage gehen müsse, um Kleiderstoffe gegen Rupien einzutauschen.
Politik der Erschöpfung
Die dingliche Materialität des Geldes bereitete aber nicht nur den Kolonisierten, sondern auch dem Kolonialstaat Probleme. Weil die Steuern nahezu ausschliesslich in den kleinsten Kupfermünzen bezahlt wurden, ein Träger aber nur etwa sechzig bis achtzig Rupien in Kleingeld schultern konnte, schleppten Karawanen von bis zu hundert Trägern für bis zu vierzehn Tage das Steuergeld über Land, bis es auf der Bezirksstation in Kisten verpackt werden konnte. Die Materialität des Bargelds belastete die Steuererhebung. Statt fliessende Zirkulation brachte das Steuergeld Langsamkeit mit sich: Bargeld betrieb eine Politik der Erschöpfung. Hinter der Mühsal stand nicht einfach Absicht; ebenso muss daran erinnert werden, dass afrikanische Warenwährungen nicht weniger, sondern noch mehr Transportaufwand mit sich brachten als das koloniale Bargeld. Trotzdem wäre es ein Irrtum, in der Beschwernis des Bargelds nur einen Misserfolg zu sehen. Belastung und Langsamkeit trugen zum Druck bei, den koloniale Herrschaft ausüben sollte. In einem Runderlass von 1899 heisst es, der Bevölkerung müsse «endlich klar gemacht werden, dass sie Steuern zahlen muss und dass der Mangel an Geld oder geldwerthem beweglichen Eigenthum keine Steuerfreiheit begründet […]».
Das Bargeld versagte weniger an seiner eigenen Materialität, vielmehr entfalteten genau diese Friktionen die Wirkung, Druck auszuüben und Überschüsse aus der Kolonie zu pressen. Herrschaft wirkte hier gerade via ihr Scheitern. Mit dem Steuerzwang als Hebel zur Bargeldökonomie entwickelte sich der koloniale Kapitalismus nicht trotz, sondern vermittels seiner Widersprüche.
Die wichtigste Kraft, die auf die koloniale Währung einwirkte und deren Gestalt formte, waren die Praktiken kolonisierter Afrikaner:innen selbst. Sie überführten die Währung in eigene Wertregimes, indem sie die Silbermünzen horteten und in Schmuck umwandelten. Der Hauptgrund, warum bei der Verstaatlichung der Währung 1903 nicht die Mark eingeführt wurde, lag darin, dass das Markstück kleiner war und weniger Silber enthielt. Die deutschen Währungsarchitekten mutmassten, dass die Mark in Ostafrika schlicht nicht akzeptiert würde. Weil Münzen häufig auf Schnüren aufgezogen wurden (die dabei entstehende Kette stellte dann eine Masseinheit und ästhetisches Artefakt zugleich dar), führten in British East Africa die Autoritäten offiziell gelochte Münzen ein. Dem vorangegangen waren längere Designdiskussionen, wie zu vermeiden sei, dass King Edwards Kopf gelocht werde. Auch in Deutsch-Ostafrika wurde wenig später mit gelochten Münzen experimentiert.
In vielen Imperien wurde koloniales Geld in Schmuck umgeschmiedet. Durch Aneignung und Adaption wurde die Kolonialwährung in ein eigenes Wertregime übersetzt. Das Horten führte dazu, dass das koloniale Geld nicht zirkulierte, sondern versickerte. Das belastete die koloniale Ökonomie. Je weiter sich das Bargeld verbreitete, umso mehr wurde es von lokalen Märkten aufgesogen und kehrte nicht mehr in die Küstenstationen zurück, wo es hätte reguliert werden können. Eine paradoxe Situation: Genau seine forcierte Diffusion trug zum Verschwinden des kolonialen Geldes bei.
Schneeballsystem an Geschichten
Seine dramatischste Aneignung und Adaption fand das koloniale Bargeld aber im Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1907. Der Aufstand erfasste Gemeinschaften mit über 25 verschiedenen Sprachen und ein Gebiet, das drei Vierteln der Fläche des heutigen Deutschland entsprach; an manchen Schlachten nahmen Tausende von Kriegern teil. Die Zahl der Todesopfer ist bis heute nicht bekannt, manche Schätzungen sprechen von 200 000, wenn die Opfer der Hungersnot, die auf die Taktik der verbrannten Erde folgte, miteinberechnet werden.
Einen Ausgangspunkt der Mobilisierung zum Aufstand stellten Prophezeiungen dar, die mit einer Kriegs- und Schutzmedizin verbunden waren. Dieses «maji» (Suaheli für «Wasser») genannte geweihte Wasser wurde an die Kämpfenden verteilt. Eine erste Historiker:innengeneration der Nationalismusforschung in den sechziger Jahren sah im Ritual des geweihten Wassers ein Element der Vergemeinschaftung, das über Sprach- und Raumgrenzen hinweg eine «imagined community» schuf, wie es Benedict Anderson in den 1980er Jahren dann auf den Begriff brachte. Spätere Sozial- und Geschlechtergeschichten des Maji-Maji-Krieges haben diese Interpretation des Aufstands als protonationalistische Erhebung kritisiert, aber ohne die Bedeutung der Schutz- und Kriegsmedizin in Abrede zu stellen.
Münzen wiederum spielten eine Rolle in der Verbreitung des geweihten Wassers und noch mehr in der Verbreitung von Geschichten über den Aufstand. Viele Zeitzeug:innen erinnerten sich, wie zeremoniell Münzen gegen die Medizin getauscht wurden. Besonders interessant ist der nachträgliche Bericht eines britischen Kolonialbeamten, der darauf hinwies, dass man einen Pesa hergeben musste, um die Nachricht vom Aufstand zu hören. Weil nun, so der Beamte, derjenige, der einen Pesa für die News hergegeben hatte, wieder einen Pesa einnehmen wollte, erzählte er die Geschichte, für einen neuen Pesa, jemand anderem weiter. Das Resultat war ein Schneeballsystem an Geschichten.
Münzen bereiteten die materielle Unterlage für die Kettenbriefdynamik der News über den Aufstand. Geld, auf der einen Seite ein Medium der Unterwerfung und Extraktion, scheint diesem Bericht zufolge für die Rebellion nutzbar gemacht worden zu sein. Zeigte sich das koloniale Bargeld langsam, stets auf neuen Anschub angewiesen und beschwerlich, so stellte es hier ein Medium für die beschleunigte Proliferation von Geschichten dar – wiederum bewegte es sich nicht trotz, sondern durch seine Widersprüche.
Widersprüchliche Strukturen
Das Beispiel der deutschen Rupie zeigt, wie Meta-Erzählungen von Integration und Konvergenz auf Grund laufen. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen ziehen, wie Kapitalismus als historische Problemstellung zu behandeln sei. Die Vorstellung, dass der Aufstieg des Weltmarkts vermittelt ist durch ein expandierendes Medium, Geld, das als universelle Sprache fungiert, hat viel Suggestivkraft. Doch hier wurde eine andere Geschichte vorgestellt: eine Geschichte, die zwei Umstände betont, die die Dampfwalzendimension der Kapitalismusgeschichte zurückweisen. Erstens: Was aus der Ferne nach Struktur aussieht, ist in vergrösserter Auflösung Assemblage, ein von Grund auf heterogenes Ensemble. Verstehen wir die Wirkungsweisen der deutschen Rupie als Assemblage, dann treten Muster unbeabsichtigter Koordination hervor, ein Zusammenspiel von Rhythmen und Massstäben in den verschiedenen Wirtschafts- und Lebensweisen mit der deutsche Rupie als Interface.
Die Begriffe «Struktur» und «Assemblage» markieren verschiedene theoretische Orientierungen, sie bedeuten aber auch verschiedene Optiken, verschiedene Weisen also, etwas sichtbar zu machen. Und als solche, als Optiken, können Strukturen und Assemblagen in einer Untersuchung nacheinandergeschaltet werden. Folglich muss ein Fokus auf das heterogene Ensemble der Assemblage nicht einfach bedeuten, bei der Betrachtung einer wimmelnden Ökologie der Praktiken stehen zu bleiben. Es geht nicht darum, die Kapitalismusgeschichte in eine Pluralität der Kapitalismen aufzulösen. Die Hypothese «Kapitalismus» eröffnet dann neue Denkräume für die Geschichtswissenschaft, wenn Kapitalismus eben nicht als Ansammlung von Subgeschichten aufgefächert, sondern als Gesellschaftsformation erforscht wird.
Die Geschichtswissenschaft sollte deshalb stärker abstrakte gegenseitige Abhängigkeiten berücksichtigen, die über die handfesten Reisen von Leuten, Dingen und Ideen hinausgehen. Sie sollte komplexere Kausalerklärungen erproben, die sich nicht nur auf einzelne, beobachtbare Interaktionen beschränken. Es geht um Strukturen, aber um dezentrierte Strukturen, die weder einen einzelnen Kern noch ein klares Ziel aufweisen. Zweitens hilft es, Strukturen in ihrer Widersprüchlichkeit zu sehen, wie anhand der deutschen Rupie zwischen 1890 und 1914 gezeigt wurde. Wenn in der deutschen Kolonialwährung Stärke und Fragilität in Erscheinung treten, so schreibt dieses Spannungsverhältnis die Währung in eine Geschichte des Kapitalismus ein – einer Gesellschaftsformation, die sich historisch nicht mit oder trotz, sondern gerade durch ihre Widersprüche bewegt.
