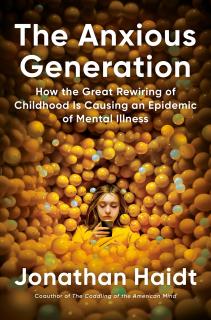Generation Angst?: Emotionen in Endlosschlaufe
Psychische Erkrankungen unter Jugendlichen nehmen stark zu. Daran seien die sozialen Medien schuld, sagt der US-Sozialpsychologe Jonathan Haidt. Doch seine monokausale Begründung führt in die Irre.
Selten hat ein Buch den Nerv der Zeit so getroffen: Vor zwei Monaten ist es in den USA erschienen, nun überschlagen sich die Besprechungen auch hierzulande. Die Rede ist von «The Anxious Generation» (deutsch: «Generation Angst»): Autor und Sozialpsychologe Jonathan Haidt verweist bereits im Untertitel auf die «Epidemie psychischer Erkrankungen» in der Altersgruppe der 12- bis 29-Jährigen.
Zwei von drei US-Collegestudierenden gaben in einer Umfrage zu Protokoll, sie würden regelmässig von Angstzuständen heimgesucht, zwei von fünf litten quasi permanent darunter. Auch in der Schweiz herrscht Notstand in der Jugendpsychiatrie, aktuell warten Betroffene über ein Jahr auf einen Behandlungsplatz. Haidt hat für diese psychische Gesundheitskrise eine simple Diagnose zur Hand: Die sozialen Medien sind schuld.
Er nennt es «the great rewiring». Die Neuvernetzung im Hirn der Generation Z habe zwischen 2010 und 2015 stattgefunden, wie Haidt in einer Serie von Grafiken darlegt. Sie alle zeigen einen rasch verlaufenden Anstieg psychischer Probleme in dieser kurzen Periode. Ihr ging, so Haidts Argument, eine Reihe technischer Entwicklungen voraus, die den Konsum sozialer Medien immens anwachsen liessen: das Smartphone – 2016 besassen in den USA vier von fünf Jugendlichen und jedes dritte Kind zwischen acht und zwölf Jahren eins –, die Einführung von «Like»- und «Share»-Buttons sowie eine Kamera, die Selfies möglich machte.
Haidt führt ein Arsenal an Daten für seine These ins Feld. Rund ein Viertel des Buchs besteht aus einem wissenschaftlichen Referenz- und Anmerkungsapparat; online stellt Haidt weiteres Material bereit. Er präsentiert seine Sache überzeugend, relativiert, wo nötig, nimmt Einwände geschickt vorweg. Das funktioniert nicht zuletzt, weil man sich als Lesende immer wieder selbst ertappt fühlt. Ja, das Smartphone ist eine Zerstreuungsmaschine, ein Zeitfresser, die sozialen Medien triggern Emotionen in Endlosschlaufe. Als Eltern sind wir oft kein gutes Vorbild.
In die Sucht getrieben?
Und so folgt man Jonathan Haidt bereitwillig, wenn er die Techkonzerne hinter Facebook und Instagram, Snapchat oder Tiktok mit der Tabakindustrie vergleicht. Weil auch sie Produkte schaffen, die abhängig machen, und diese gezielt und unter Umgehung des Gesetzes an Minderjährige vermarkten. Wo doch deren präfrontaler Kortex, zuständig für Planung und Selbstkontrolle, erst mit weit über zwanzig Jahren ausgereift ist und in der Pubertät einer hochsensiblen Grossbaustelle gleicht, die Jugendliche emotional besonders verletzlich macht.
Ein «Rewiring» findet im Gehirn also sowieso statt – bloss entwickelt es, und das ist der Kern von Haidts These, unter dem Einfluss von sozialen Medien eine negative Dynamik und treibt Jugendliche in ein Suchtverhalten. Die Plattformen seien analog zu Glücksspielautomaten konzipiert: Jeder Post triggert nicht nur den Griff zum Smartphone, sondern auf der Suche nach sozialer Anerkennung aus der Peergruppe auch das Bedürfnis, auf den Post mit einem eigenen zu reagieren, der erneut mit Likes belohnt wird. Und weil das nicht immer geschieht und Jugendliche nichts mehr fürchten, als viral blossgestellt zu werden, investieren sie immer mehr Zeit in die Kuratierung und Optimierung des eigenen Profils.
Heute sind in den USA die Hälfte aller Teenager fast konstant online, Schweizer Jugendliche verbringen täglich über dreieinhalb Stunden auf Instagram, Snapchat und Tiktok. Die Folgen, so Haidt, seien gravierend: Schlafmangel, totale Unkonzentriertheit, kaum noch Freundschaften in der realen Welt. Und als Konsequenz davon: Angstzustände, Depressionen, weitere psychische Störungen. Selbst wenn das Smartphone in der Tasche steckt oder stumm vor ihnen auf dem Tisch liegt, driften Jugendliche gedanklich in die virtuelle Welt ab, so eines seiner Mantras. Er belegt es mit einer Studie – dass sich ihre Resultate nicht bestätigen liessen, erfährt aber nur, wer die entsprechende Fussnote im Anhang konsultiert.
Dennoch insistiert Haidt auf dem ursächlichen Zusammenhang zwischen sozialen Medien und psychischen Erkrankungen, will dies dutzendfach mit sogenannt randomisierten kontrollierten Studien nachgewiesen haben. Dabei extrapoliert er immer weiter von zitierten Untersuchungen. So gibt er zwar zu, dass auch jahrelange Forschung keine schlüssigen Beweise dafür habe liefern können, dass Videogames schädlich seien. Und sieht Buben und junge Männer dann doch in Online-Multiplayer-Gamingwelten verschwinden oder in «endlosen Playlists von Hardcore-Pornovideos» versinken, während Mädchen von den Algorithmen der Plattformen mit «Hungerbildern» und Abnehmchallenges geflutet würden, die sie am eigenen Körper verzweifeln liessen. Als dramatischer Endpunkt am Horizont: der Sohn, der sein Kinderzimmer nicht mehr verlässt, und die Tochter, die sich zu Tode hungert.
Irgendwann ist es eine Binsenwahrheit: «Die grosse Ironie sozialer Medien ist: Je tiefer man in sie eintaucht, umso einsamer und depressiver wird man.» Aber stimmt das auch?
Ursachen ausgeblendet
Fachleute aus Pädiatrie und Psychologie relativieren. Oskar Jenni, leitender Arzt am Kinderspital Zürich, kritisierte jüngst in einem Interview mit dem «Blick», Haidts These sei zu monokausal und werde der Komplexität des Umfelds, in dem Kinder psychische Probleme entwickeln, nicht gerecht. Candice L. Odgers geht in der Fachzeitschrift «Nature» noch einen Schritt weiter und verneint rundweg, dass soziale Medien für die Epidemie psychischer Erkrankungen von Jugendlichen verantwortlich gemacht werden können. Odgers forscht in Kalifornien und an der Jacobs Foundation in Zürich zur Entwicklung sozial benachteiligter Kinder und untersucht dabei auch die Rolle digitaler Medien. Die Resultate aus ihrer eigenen und der Forschung von Hunderten anderer Wissenschaftler:innen, so schreibt sie, würden vielmehr darauf hinweisen, dass junge Menschen, die bereits an psychischen Problemen litten, soziale Medien häufiger oder anders nutzten als gesunde Teenager. Haidt lenke mit seiner steilen These nur von der Frage ab, wie man den tatsächlichen Ursachen der psychischen Gesundheitskrise begegnen könne.
Fast jedes sechste Kind wächst in den USA in Armut auf, viele erfahren in ihrem Alltag Gewalt, Diskriminierung, Vernachlässigung, Missbrauch. Amokläufe an Schulen? Opioidepidemie? Klimakrise? Krieg in Europa und im Nahen Osten? Covid-Pandemie? Nichts davon vermag laut Haidt die Psyche einer ganzen Generation zu schädigen.
Nur einen Faktor lässt er gelten: «Helikoptereltern», die ihre Kinder zu Hause edukativ beschäftigen, statt sie draussen mit andern spielen zu lassen, und sie auf Schritt und Tritt via GPS tracken, sobald sie das Haus dennoch verlassen. Das hat in den USA auch juristische Gründe. Eltern machen sich strafbar, wenn sie ihren Nachwuchs unbeaufsichtigt im Freien herumziehen lassen, bevor dieser die Schwelle zum Teenageralter überschritten hat. Bloss versagten sie ihren Kindern so das Ausleben ihres natürlichen «Entdeckungsdrangs», der sie gegen Angst «impfe», sagt Haidt, weshalb sie sich zu ängstlichen Wesen mit einem übertriebenen Schutzbedürfnis entwickelten. Intuitiv gibt man ihm recht, aber in der Verkürzung nervt es dann doch. Umso mehr, als er sich primär an ein ökonomisch, sozial und kulturell privilegiertes Publikum richtet.
Zu simple Rezepte
Mit seiner simplifizierten These machte der Sozialpsychologe bereits in «The Coddling of the American Mind» (2018) Furore – vor allem in rechtskonservativen Milieus. Mit Ko-Autor Greg Lukianoff arbeitet er sich darin an Studierenden ab, die an Universitäten mit ihren Klagen über «Mikroaggressionen» und den Forderungen nach «Triggerwarnungen» und «Safe Spaces» die Cancel Culture begründet hätten.
Applaus aus der rechten Ecke ist Haidt auch für «Generation Angst» sicher. Vor allem wenn er den Verlust «männlicher Werte» und Vorbilder beklagt und das Belohnen «weiblicher» Verhaltensweisen schmäht. Kein Wunder, verabschiedeten sich Buben, je älter sie würden, zunehmend aus dem realen Leben ins virtuelle: Frauen liefen Männern auf sämtlichen Bildungsstufen den Rang ab – «Mädchen lassen Jungs im Dreck zurück.»
Solche verbalen Entgleisungen halten den Schweizer Populärphilosophen Rolf Dobelli nicht davon ab, an vorderster Front im Team Haidt zu lobbyieren. Dobelli predigte bereits in «Die Kunst des digitalen Lebens» einen radikalen Newsverzicht, um geistig gesund zu bleiben. Jetzt will er die zerstörerische Gewalt sozialer Medien entschärfen – er nennt sie «Atombomben fürs Gehirn». Zusammen mit Haidt, den er für die NZZ interviewt hat, verordnet er der Generation Z eine radikale Detoxkur: Kein Smartphone vor dem 14. Geburtstag, keinen Zugang zu Instagram, Tiktok und Co. vor dem 16. Geburtstag.
Zu Haidts Reformvorschlägen in «Generation Angst» gehört auch ein striktes Handyverbot an Schulen. Tatsächlich berichten eine Reihe von Schulen, in denen Kinder und Jugendliche ihre Handys wegsperren müssen, von positiven Veränderungen: Die Schüler:innen seien aufmerksamer, brächten bessere Leistungen und redeten wieder miteinander, Konflikte würden seltener. Tönt eigentlich nach einem guten Rezept – zumindest solange der Nachwuchs in der Schule ist.
Doch allzu oft sind Verbote einfach die simpelste Lösung. Sie bekämpfen Symptome, um den tiefer liegenden Ursachen von Problemen aus dem Weg zu gehen. Die Epidemie psychischer Erkrankungen unter Jugendlichen dürfte mit solchen Rezepten jedenfalls kaum überwunden werden.