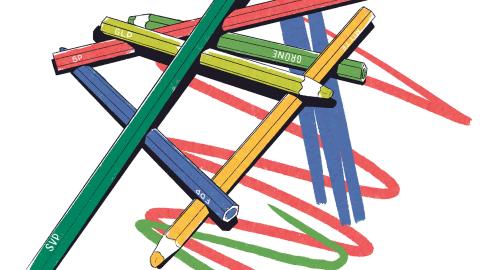Sozialpolitik: Linke Schocktherapie
Die Schweizer Bevölkerung ist bei sozialpolitischen Abstimmungen nach links gerückt. Wäre das Nein zur Prämieninitiative da nicht vermeidbar gewesen?

An Rose Zschokke lag es nicht, dass die Prämien-Initiative am Sonntag an der Urne durchfiel, so viel ist festzuhalten. Die 83-Jährige flyerte vor der Station der Seilbahn Rigiblick in Zürich, sie flyerte am Lindenplatz. «Ich war auf der Gasse», resümiert die Rentnerin, die bei Avivo aktiv ist. Avivo und andere Altersverbände hatten nach dem sensationellen Abstimmungsergebnis zur 13. AHV-Rente versprochen, sich mit vollem Elan für eine Deckelung der Krankenkassenprämien auf zehn Prozent des Einkommens einzusetzen. Entlastung erst für die Senior:innen, dann für die Familien, lautete die Losung.
Zschokke brachte ihre Flyer an die Leute. Aber sie sagt, sie habe schnell gemerkt, dass die Initiative kein Selbstläufer werde: «Es lief harzig, als hätten die Leute nicht verstanden, was ihnen das bringt.» Die 13. AHV dagegen hätten die Passant:innen sofort erfasst: «Noch einmal 2450 Franken im Jahr. Super!»
Dass die individuellen Auswirkungen der Vorlage unklar geblieben seien, ist eine der Erklärungen, die nach dem Abstimmungssonntag herumgereicht werden. Eine andere: Die SP habe einen defensiven Abstimmungskampf geführt. Eine kopflastige Kampagne der Parteizentrale, die bei der Basis, in den Regionen und bei zivilgesellschaftlichen Organisationen kaum Resonanz ausgelöst habe. Das Grundrauschen jedenfalls fehlte, das bei der AHV-Abstimmung zur hohen Mobilisierung geführt hatte. Und zum Grosserfolg an der Urne: 58 Prozent sagten im März Ja – während der Ja-Anteil bei der Prämien-Initiative bei nur 44,5 Prozent lag.
Knausrige Gewerkschaften
Geld setzte die SP viel ein. 700 000 Franken meldete sie der Eidgenössischen Finanzkontrolle, die seit kurzem über die Abstimmungsbudgets wacht. Bescheiden war dagegen der Beitrag des Gewerkschaftsbunds (SGB): Lediglich 80 000 Franken steuerte dieser bei – bei der 13. AHV hatte der finanzielle Einsatz des SGB noch 2,2 Millionen betragen. Eine riesige Diskrepanz. Beim SGB weist man darauf hin, dass der Spendeneingang vor der AHV-Abstimmung einmalig gross gewesen sei.
SGB-Chefökonom Daniel Lampart sagt: «Die 13. AHV hat die politischen Gravitationsgesetze vorübergehend ausser Kraft gesetzt – sie hat die Grenzen des Möglichen verschoben.» Das habe zunächst für die Energie gegolten, die nötig gewesen sei, damit sich die Kampagne voll habe entfalten können. «Es brauchte enorme Kräfte», so Lampart, der diesmal eine gewisse Erschöpfung feststellte.
Ähnliches gilt auch mit Blick auf das Momentum, das sich mit Kampagnen erzeugen lässt. Bei der 13. AHV sei es gelungen, eine Bewegung auszulösen, meint Lampart. Spontan gebildete Nachbarschaftskollektive nahmen auf, was vom SGB aufbereitet worden war. «Aber das ist nicht etwas, was du von Bern aus anordnen kannst.» Gerade Familien sind kaum politisch organisiert. Für alles und jede:n finden sich Interessensvertreter:innen; doch wer einen «Familienverband» sucht, landet bei einer Organisation, die Vermögensverwaltung und Rechtsberatung an ihre Mitglieder verscherbeln will.
Der neue Gravitationszustand umfasst nicht nur die Erwartungen an eine Abstimmungskampagne, sondern auch die Bewertung des Erreichten. Was früher mitleidig als linker Achtungserfolg gewertet worden wäre, ist plötzlich ein «deutliches Nein» (SRF). Und doch gibt es auch auf linker Seite unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie der Volksentscheid nun einzuordnen sei.
Nah dran an der Mehrheit
Am Abstimmungssonntag steht Lampart in einer Ecke des Berner Restaurants Fabrique28, wo sich das Ja-Komitee versammelt hat, und verfolgt die TV-Interviews, in denen die SP-Spitze unisono von einer grossen Enttäuschung spricht. «Die Stimmung ist mir hier zu depressiv», murmelt er. Fragen ihn Journalist:innen nach seiner Einschätzung, hebt er die Ja-Mehrheiten in acht Kantonen hervor, wo die Zehn-Prozent-Grenze nun realisiert werden soll. Oder den indirekten Gegenvorschlag, der nun in Kraft tritt.
Auch Samira Marti, Fraktionschefin der SP im Nationalrat, konstatiert am Sonntag eine «grosse Enttäuschung». Alles andere, glaubt sie, wäre die falsche Reaktion auf den Ausgang der Abstimmung. Der Achtungserfolg ist kein erstrebenswertes Ziel mehr für die SP. Man ist nicht mehr bloss ein Störenfried in der Bundespolitik, ein Korrektiv zur rechten Hegemonie, das an guten Tagen mit Referenden die schlimmsten Ideen der Parlamentsmehrheit stoppen kann. Man versteht sich als Gestaltungskraft, ganz nah dran an einer Mehrheit in der Bevölkerung.
Marti empfiehlt, den Blick zu weiten: «Wir müssen in grösseren Zeiträumen denken. Und da sehen wir eine nachhaltige Verschiebung der Bevölkerung hin zu einer sozialeren Schweiz. Was Economiesuisse sagt, ist Jahr für Jahr mehr Leuten schlicht und einfach egal.» Eine Emanzipation sei im Gang, glaubt sie, nach bleiernen Jahrzehnten, in denen die Wirtschaftsverbände vorsagen konnten, was gut und richtig ist. Marti sagt: «Was wir gerade erleben, ist das Ende des Neoliberalismus in der Schweiz.»
In der Sozialpolitik hätten die rechten Kräfte bereits die Deutungshoheit verloren. Rentenaltererhöhungen oder ein Abbau im Gesundheitswesen sind auf längere Zeit vom Tisch; dazu hat die Stimmbevölkerung den Ausbau der AHV und mit der Pflegeinitiative eine Stärkung der Pflege durchgedrückt. In diese Entwicklung lässt sich durchaus auch die Prämien-Initiative einordnen, auch wenn die Sozialdemokrat:innen damit gescheitert sind. Keine SP-Initiative zur Krankenkasse hat jemals eine derart hohe Zustimmung erfahren.
Für Marti ist die Ursache für diese Veränderungen auch in der Coronapandemie und den staatlichen Massnahmen gegen deren Verwerfungen zu suchen. Die Rechten hätten gedacht, man könne Milliardenhilfen für Firmen sprechen und danach die Uhr wieder zurückdrehen. «Aber damals hat sich das Verhältnis zum Staat für viele nachhaltig verändert.» Daniel Lampart vom SGB führt die Veränderungen noch etwas weiter, bis ins Jahr 2017, zurück. Damals scheiterte die Unternehmenssteuerreform III deutlich an der Urne. «Das war der erste Schock für die Wirtschaftsliberalen», sagt er. Der zweite Schock sei die 13. AHV gewesen. «Eine Initiative, die gegen das ganze Establishment gerichtet war.»
«Zusammen auf die Barrikaden»
Ob die linke Schocktherapie weitergeht, zeigt sich im Herbst. Im November geht es für die linken Kräfte darum, eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Mieter:innen zu verhindern. Und damit nach den Krankenkassenprämien um ein weiteres Topthema auf dem Sorgenbarometer der Bevölkerung. Doch zunächst wollen SP und Gewerkschaften im September eine Leistungskürzung bei den Pensionskassen abwehren. Marti spricht von einer «Schicksalsabstimmung» für die bürgerliche Seite. «Sie können sich keinen weiteren Fehlschlag leisten. Wir rechnen mit einer millionenschweren Abstimmungskampagne.» Auch Lampart erwartet, dass die Wirtschaftsverbände riesige Summen ausgeben werden.
Um da dagegenzuhalten zu können, wollen Gewerkschaften und SP eine Kampagne aufgleisen, die an jene zur 13. AHV anknüpft. Mit Leidenschaft an der Basis und einer breiten Abstützung in der Zivilgesellschaft. Fehler können sich nicht nur die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände nicht mehr leisten, die gerade die Gunst der Bevölkerung verlieren.
Auf Rose Zschokke wird dann wieder Verlass sein. Die Pensionärin wird im Frühherbst wieder auf der Strasse sein und Flyer verteilen. Sie sammelte schon Unterschriften fürs BVG-Referendum und sagt rückblickend, das sei ihr «spielend leicht gefallen». Sie will vor allem auf jüngere Passant:innen zugehen, damit diese nicht meinten, Rentenpolitik gehe sie nichts an. Zschokke sagt: «Wir müssen alle zusammen auf die Barrikaden gehen!» Und klingt dabei so gar nicht wie eine 83-Jährige.
Perspektiven nach der Niederlage: Reif für eine öffentliche Krankenkasse?
Nach dem Nein zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP wird der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats zum Zug kommen: Die Initiative hatte die privaten Ausgaben für die Krankenkasse auf zehn Prozent des Einkommens begrenzen wollen; stattdessen soll nun der Beitrag der Kantone an die Prämienvergünstigungen erhöht werden – um gerade einmal 360 Millionen Franken pro Jahr.
Die SP geht indes davon aus, dass die Prämien weiter steigen werden, und setzt ihren Kampf gegen die ungerechte Finanzierung der Gesundheitskosten auf mehreren Ebenen fort. So sind in den acht Kantonen, deren Stimmbürger:innen der Initiative zugestimmt haben, entsprechende kantonale Initiativen angedacht. Zudem kündigte die SP die Lancierung einer Initiative für eine öffentliche Krankenkasse an. 2007 hatten auf nationaler Ebene bloss 29 Prozent der Stimmberechtigten einer ähnlichen Vorlage zugestimmt, 2014 waren es bereits 38. Laut einer repräsentativen Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte von dieser Woche würden inzwischen 65 Prozent die Einführung einer öffentlichen Krankenkasse begrüssen. Was die Chancen an der Urne zusätzlich erhöhen könnte: Anders als vor zehn Jahren soll es diesmal nicht mehr um eine Einheitskasse mit einkommensabhängigen Prämien gehen, sondern um eine öffentliche Kasse mit Prämien, die je nach Region unterschiedlich ausfallen.
Mit dem Ende des Pseudowettbewerbs zwischen 44 privaten Kassen könnte ein beachtlicher Teil der Kosten wegfallen: in den Verwaltungen und bei Managementlöhnen, in Werbung und Marketing. Inwieweit es der SP gelingen wird, Mitstreiter:innen im bürgerlichen Lager zu finden, ist indes fraglich. Eine entscheidende Rolle dürfte die Mitte-Partei spielen. Deren Präsident Gerhard Pfister liess zumindest durchblicken, dass es inzwischen auch im bürgerlichen Lager Stimmen gebe, die der Idee offen gegenüberstehen würden. Sollte es die SP gar schaffen, die Initiative zusammen mit einer bürgerlichen Partei zur Abstimmung zu bringen, würde das deren Chancen noch einmal erhöhen.
Im Bundeshaus wird es für die Linke darum gehen, Angriffe auf den Leistungskatalog in der Grundversicherung abzuwehren, etwa Ideen aus der FDP von einer «Budgetkrankenkasse», in der Versicherte auf einzelne Leistungen verzichten könnten und dafür weniger für die Grundversicherung zahlen müssten. Zudem wird sie Mehrheiten für eine zügige Umsetzung der Pflegeinitiative und für jene Kostensenkungsmassnahmen (wie etwa bei den Medikamentenpreisen) finden müssen, die sozial tatsächlich sinnvoll wären.