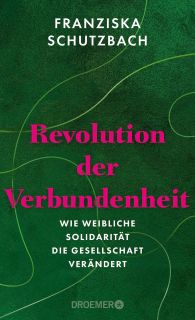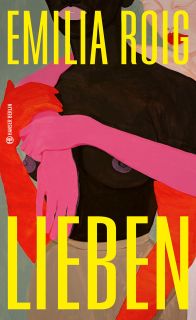Feminismus: Ein neues Zuhause jenseits des Patriarchats
Solidarisch in der Abgrenzung? Franziska Schutzbach und Emilia Roig zeigen, wie Liebe und Verbundenheit feministisch zu denken wären.
Die Situation ist wohl vielen vertraut: Zwei Frauen sitzen in einer Bar, sprechen über feministische Themen, etwa über unbezahlte Sorgearbeit. Ein Mann gesellt sich dazu, kommt mit den Frauen ins Gespräch – und beginnt, ihre Perspektive infrage zu stellen.
Eine solche Szene schildert die Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach in ihrem neuen Buch. Sie hat das nach einer gemeinsamen Lesung mit der Autorin Mareike Fallwickl so erlebt. Während Schutzbach dem Mann gegenüber geduldig bleibt, sich noch einmal erklärt, unterbricht ihn Fallwickl und kritisiert seine Anspruchshaltung: dass Frauen ihm – in diesem Fall mit Erklärungen und erarbeitetem Wissen – zur Verfügung zu stehen hätten. «Ich war beeindruckt», schreibt Schutzbach. «Niemals hätte ich mich das getraut. Ich sass mit einer Kriegerin am Tisch!»
Das Buch «Revolution der Verbundenheit» lebt von persönlichen Erfahrungen wie dieser. Schutzbach schildert sie in Briefen – an eine Freundin, an ihre Tante oder eben an Fallwickl – und nimmt sie als Ausgangspunkt, um sie mit geschlechtertheoretischen und politischen Analysen zu verknüpfen. Was immer wieder zur Sprache kommt, ist der Spagat zwischen Separatismus und Gleichstellungsfeminismus: Soll man sich patriarchalen Lebensmodellen anpassen – und Frauenquoten oder bezahlbare Kitaplätze fordern – oder sich ebendiesen Modellen entziehen? Schutzbach vertritt hier eine klare Haltung, sie schreibt: «Frauen, die sich entziehen, zurückziehen, Nein sagen, kontrollieren ihre eigene Verfügbarkeit.» Ein Ansatz, der eine logische Weiterführung ihres ersten Buches darstellt, in dem sie eine «Erschöpfung der Frauen» konstatiert. Diese Erschöpfung ergibt sich aus der Last unbezahlter Sorgearbeit und dem männlichen Anspruch, sie hätten bedingungslos verfügbar zu sein.
Die Grenzen der Sisterhood
In «Revolution der Verbundenheit» untersucht Franziska Schutzbach auch das Konzept der weiblichen Solidarität – gewissermassen die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie ein feministischer Separatismus überhaupt denkbar ist. Sie erläutert, wie diese Solidarität nicht nur durch Verbundenheit geprägt ist, sondern auch durch Spaltung. Schliesslich wirken sich Diskriminierungsformen unterschiedlich aus, «die» Frauen als homogene Gruppe gibt es nicht. Schutzbach geht es um die Zerreissprobe, die antipatriarchale Kämpfe zu bewältigen haben: «Sie können sich nicht nur auf die eigenen Unterdrückungserfahrungen und Interessen begrenzen, sondern müssen auch die Kämpfe anderer im Blick haben», schreibt sie in Anlehnung an die Schwarze Autorin Audre Lorde.
Diese Zerreissprobe kommt in einem Brief an die afroamerikanische Dichterin Fork Burke zum Ausdruck. «Unsere Schwesterlichkeit hat Grenzen», schreibt Schutzbach und verweist auf die rassistischen Strukturen, von denen sie als weisse Frau profitiert. «Diese Unterschiede unter Frauen machen Schwesterlichkeit kompliziert und nicht selten unmöglich.» Doch inmitten aller Unterschiede findet Schutzbach immer wieder verbindende Elemente: «Mit dir verbunden zu sein bedeutet, nicht mehr die Wahl zu haben, mich nicht mit Rassismus zu beschäftigen, bloss weil ich davon nicht betroffen bin.» Hier klingt das an, was Schutzbach als «Politisierung durch Frauenbeziehungen» bezeichnet: wie eben durch diese Beziehungen politisches Bewusstsein entsteht.
Immer wieder stellt Franziska Schutzbach klar, dass sie «weibliche» Solidarität nicht als essenzialisierende Kategorie versteht, sondern als Verbundenheit, die patriarchale Gewalt über Unterschiede hinweg bekämpft. Nicht vertieft wird jedoch, wie sich die Ambivalenz von Verbundenheit und Spaltung im Verhältnis zu Frauen auswirkt, die nicht cis sind. Damit wirkt die im Buch verwendete Formulierung «Frauen beziehungsweise FLINTA*-Personen» etwas vorgeschoben: Explizit gemeint scheinen doch meistens cis Frauen.
Liebe als politisches Regime
Schutzbach unterwandert in ihrem Buch immer wieder das Konzept «der» Liebe. Das ergibt insofern Sinn, als sich solidarische Beziehungen nicht selten ausserhalb romantischer Zweierbeziehungen ereignen (müssen). Ähnlich plädiert auch die Politologin Emilia Roig in ihrem Buch «Lieben» dafür, das Konzept der Liebe radikal zu erweitern: von der Kernfamilie und der romantischen Zweierbeziehung hin zur Freundschaft zu Natur, Tieren und Kosmos. In diesem Essay klingen auch die Konzepte der Wahlfamilie oder der «More than human»-Ökologie an, die anthropozentrische Vorstellungen infrage stellt. Wie Schutzbach versteht auch Roig Liebe nicht als «natürliches» Ereignis, sondern als ökonomisches und politisches Regime: Ein Beispiel dafür ist die reproduktive Arbeit, die Frauen in Familien «aus Liebe» leisten und die deshalb nicht bezahlt wird.
Die Erweiterung von Liebe, die Enthierarchisierung verschiedener Beziehungsformen – all dem verleiht Roig nicht nur politische, sondern auch existenzielle Dringlichkeit: Familien und romantische Zweierbeziehungen sind Schauplätze patriarchaler Gewalt. «Nicht alle Kernfamilien sind gewaltvoll, aber im Fall von Gewalt sind sie unglaublich schädlich und isolierend», schreibt Roig. Und wenn die eigene Kernfamilie zum Ort der bedingungslosen Liebe stilisiert werde, wirke diese Gewalt umso erschütternder.
So bringt Roig eigene Vergewaltigungserfahrungen zur Sprache und die Unmöglichkeit, diese mit ihrem Vater oder ihren Schwestern aufzuarbeiten. Hier gewinnt ihr Buch gleichsam spirituellen Charakter: Aufgrund der Gewalt, die sie in und ausserhalb der Familie erlebt hat, habe sie einen «kosmischen Zufluchtsort» gefunden. «Ich verliess das Zelt, in das mich die Männer, ein Messer an meinem Hals gedrückt, gezerrt hatten, verliess den Campingplatz und flüchtete in den Kosmos, der schon als Kind so oft meine Rettung war. Mein Körper blieb reglos zurück.» Für das, was in der Psychiatrie als dissoziative Amnesie bezeichnet wird, versucht Roig eine andere Sprache zu finden. Damit stellt sie die Wissensproduktion jener Institutionen infrage, die wiederum die Gewalterfahrung von Frauen immer wieder infrage stellen.
Umso dringlicher wirkt dadurch ihr Aufruf, ein breiteres, unterstützendes Beziehungsnetz anzulegen: «Lasst uns Häuser mit Freund:innen kaufen, Kinder zusammen aufziehen, gemeinsame Bankkonten eröffnen.» Hier klingt Schutzbachs Plädoyer für mehr Separatismus in der feministischen Politik an. Obwohl mit diesem Vorschlag jeweils die Frage einhergeht, wer tatsächlich in der Position ist, sich zu entziehen, kann er hilfreich sein, um «weibliche» Beziehungen wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken; um eigene Räume zu gründen, eigene Utopien zu entwickeln. Denn Utopien entstehen nicht in der Abgrenzung vom Status quo, sondern in der Etablierung ganz neuer Bezugssysteme. «Aufgebaut wird nicht nur eine antipatriarchale Gesellschaft», schreibt Schutzbach in einem Brief an Mareike Fallwickl, «sondern ein neues Zuhause.»