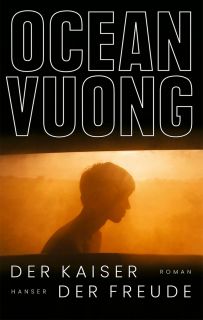Literatur: Grauzone zwischen Träumen und Lügen
Ocean Vuongs zweiter Roman führt wieder in ein kaputtes Amerika, zu einem ungleichen Paar – und zur liebenswerten Crew einer Fastfoodkette.

Schon ein merkwürdiges Duo, diese zwei: die 82-jährige Grazina und der 19-jährige Hai, die auf den ersten Seiten von «Der Kaiser der Freude» zueinanderfinden. Hai hat seiner Mutter vorgelogen, er lasse sich in Boston zum Arzt ausbilden, und zieht nun nach ein paar Wochen Entzugsklinik durch East Gladness, eine trostlose imaginäre Kleinstadt irgendwo in Connecticut. Grazina lernt er kennen, weil sie ihn davon abhält, von einer Brücke in den Fluss zu springen: «Du darfst nicht hier vor meinem Haus sterben, okay? Ich kann hier nicht noch mehr Geister gebrauchen.»
Grazina, litauische Immigrantin, lebt mit sehr wenig Geld und trotz zunehmender Demenz allein. Hai zieht am nächsten Morgen kurzerhand bei ihr ein. Ihre Beziehung ist eine Mischform aus gegenseitiger Freundschaft und Care, die höfliche Distanz wird bald aufgegeben. Familie eigentlich, so unterschiedlich sind die beiden denn auch nicht. Sie teilen die Einsamkeit, ihre Pillenabhängigkeit – sie vierzehn verschiedene Pillen am Tag, er alle Opioide, die er kriegen kann, und, so finden sie bald heraus, den Drang, einander Geschichten zu erzählen.
So traurig und so stolz
Ocean Vuongs zweiter Roman ist an einem ähnlichen Ort angesiedelt wie sein erster, «Auf Erden sind wir kurz grandios» (2019), der als Brief an die Mutter formuliert war und starke autobiografische Züge hatte. Auch das Personal in «Der Kaiser der Freude» kommt einem zum Teil schon bekannt vor: Da ist wieder ein junger, schwuler Sohn vietnamesischer Einwander:innen, der gerne schreiben möchte und oft nicht weiss, wie überleben, der einen ebenso jungen, nahen Menschen viel zu früh hat sterben sehen. Da ist auch wieder eine Mutter, die sich den Körper im Nagelstudio kaputt arbeitet, und die geliebte, schizophrene Grossmutter, hier nur als manchmal aufleuchtende Erinnerung.
Zu ihnen gesellen sich weitere Charaktere, als Hai in einer Fastfoodkette zu arbeiten beginnt – auch das ist inspiriert von Vuongs eigener Biografie. Die Dinercrew ist das eigentliche Herz des Romans, alle so traurig und alle so stolz: die Verschwörungstheoretikerin Maureen mit den kaputten Knien, Grillchef Wayne, der von seinem Sohn viel zu lange nichts mehr gehört hat, Hais autistischer Cousin Sony, Russki, der eigentlich aus Tadschikistan kommt, und Managerin BJ, die die Truppe gern militärisch führen würde, dafür aber viel zu gutmütig ist. Sowieso träumt sie vor allem von ihrem Durchbruch im Amateurwrestling.
Vuong gibt ihnen viel Platz, ihrem Alltag und ihren sehr witzigen Dialogen, schliesslich verbringen die Leute der Crew den grössten Teil ihrer Wachzeit miteinander. Sie arbeiten hart für wenig Geld, trotz chronischer Schmerzen, versehrter Körper, Trauer, Traumata, sie trinken wie Maureen schon am frühen Morgen Schnaps oder bringen sich wie Hai mit Opioiden durch, legen sich, wenn die Schmerzen zu gross werden, nach Schichtende eine Packung tiefgefrorenes Mac and Cheese aufs Knie. Reich werden sie nicht. Der American Dream bleibt als Erzählung trotzdem höhnisch erhalten.
Man will es gerne glauben
Ocean Vuong wurde durch seinen Gedichtband «Nachthimmel mit Austrittswunden» (2020, auf Englisch 2016), spätestens aber durch seinen Debütroman schnell international berühmt. Seine bildhafte, manchmal blumige Sprache wird dazu beigetragen haben, handelt ihm aber auch Kritik ein. Tatsächlich hat er den Hang, sich in allzu vielen Metaphern und manchmal pathetischen Sätzen zu verlieren, vor allem jeweils zum Kapitelende. Man kann darüber hinweglesen, weil es sowieso schöner ist, wo Vuong nah an seinen Figuren bleibt – und bei ihren Strategien, sich durchs Leben zu schlagen. Denn «Der Kaiser der Freude» ist auch ein Roman darüber, wie man sich und einander Geschichten erzählt, um durchzukommen, übers Träumen und Lügen und die grosse Grauzone dazwischen. Am klarsten dann, wenn Hai seiner Mutter am Telefon von seinem angeblichen Collegealltag berichtet. Oder wenn Grazina in eine frühere Zeit fällt, meistens in den Zweiten Weltkrieg, und er sich für sie als US-amerikanischen Sergeant imaginiert und so lange mit ihr spricht, bis sie wieder aus der Erinnerung zurück ist.
In einer Szene finden sich Hai, Maureen und Russki mit Wayne in einem Schlachthaus wieder. Einen Tag lang töten sie im Minutentakt Schweine, während aus den Boxen ohrenbetäubend die Metalband Slipknot dröhnt: Tiere, die mit Mastfutter aufgezogen wurden und in einer Halle so zusammengepfercht sind, dass sie sich kaum bewegen können. «Murphys Fleisch von freilaufenden Schweinen, Familienbetrieb seit 1921», heisst es auf dem Etikett, das am Schluss auf der Packung klebt, bio und aus Weideschlachtung. Auch so eine Erzählung, die man gerne glauben würde.
In solchen Beschreibungen ist Vuong stark, man fühlt sich in diese furchtbare Halle hineinversetzt, in den Lärm, die Hitze, die von den geschlachteten Tieren aufsteigt. Oder wenn er sehr genau und gnadenlos ausführt, wie BJs Traum vom Amateurwrestling platzt: Da fühlt man die Scham und die Demütigung fast körperlich mit. Nur ein bisschen bekannt wollte sie werden. Nun muss sie sich damit abfinden, immerhin für einen kurzen Moment jemand anderes gewesen zu sein.