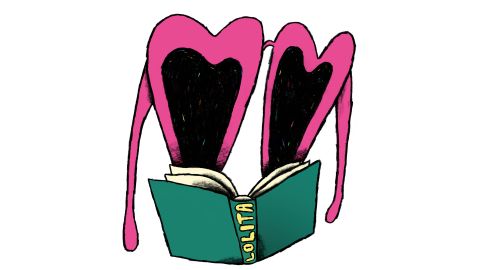Buchverfilmung: Der westliche Kanon soll euch befreien
Für ihren feministischen Bestseller «Reading Lolita in Tehran» wurde Azar Nafisi gefeiert, aber auch heftig attackiert. In der Verfilmung wird jetzt klar: Die Kritik von damals war nicht nur schief.

Sind wir alle Lolita? Für eine Studentin in der Lesegruppe ist das gar keine Frage: «Natürlich sind wir Lolita. Alles, was wir tun, wird kontrolliert von dreckigen alten Männern.»
Die Szene spielt 1995 in Teheran. Die Literaturdozentin Azar Nafisi wurde einst von der staatlichen Universität ausgeschlossen, weil sie sich geweigert hatte, einen Hidschab zu tragen. Jetzt unterrichtet sie bei sich zu Hause einen exklusiven Kreis von Studentinnen: In klandestiner Runde diskutieren sie Klassiker aus dem englischsprachigen Kanon, die unter dem islamischen Regime aus dem Lehrplan verbannt wurden, von Jane Austens «Stolz und Vorurteil» bis eben Vladimir Nabokovs «Lolita». Zwei Jahre später wird Azar Nafisi auswandern, zurück in die USA, wo sie einst studiert hatte. Dort schreibt sie über ihre heimliche Lesegruppe ein Buch, das zum Bestseller avanciert: «Reading Lolita in Tehran» (2003).
Und da wirds nun kompliziert. Denn einerseits wird das Buch von feministischen Galionsfiguren wie Susan Sontag oder Margaret Atwood gefeiert, weil Azar Nafisi darin die Literatur als geheimes Bollwerk gegen die Unterdrückung der Frau in Stellung bringt und die gemeinsame Lektüre zum Akt des Widerstands macht. Zugleich aber gerät das Buch ins Visier einer antiimperialistischen Kritik, die Azar Nafisi zum Sprachrohr der US-Propaganda nach 9/11 stempelt. Der Vorwurf von linken Historiker:innen wie John Carlos Rowe: Mit ihrem Buch trage die Autorin dazu bei, die öffentliche Meinung gegen den Iran aufzubringen. Ganz im Interesse der damaligen US-Regierung unter George W. Bush befördere sie so deren imperiale Agenda im Namen des «War on Terror» – gerade auch im Hinblick auf einen potenziellen Einmarsch in den Iran.
An der Kaderschmiede
Auch wenn sich die Autorin gegen solche ideologischen Zuschreibungen stets verwahrt hat: Aus der Luft gegriffen sind sie nicht. Ab 1997, nach ihrer Rückkehr in die USA, arbeitet Azar Nafisi an der Johns Hopkins University in Washington – aber nicht etwa bei den Literaturwissenschaften, sondern an einer Kaderschmiede für Aussenpolitiker:innen. Dekan dieser Schule damals: Paul Wolfowitz, ab 2001 dann stellvertretender Verteidigungsminister unter George W. Bush – und als solcher einer der Architekten der «Bush-Doktrin», die die Grundlage für «Präventivkriege» wie den US-Einmarsch im Irak im Jahr 2003 schuf.
Und jetzt, mit der Verfilmung von «Reading Lolita in Tehran» über zwanzig Jahre später, wird es nochmals komplizierter. Denn verfilmt hat das Buch ein Israeli: Regisseur Eran Riklis («Lemon Tree») hat in Italien gedreht, mit lauter iranischen Schauspieler:innen, die entweder im Exil leben oder nicht im Iran aufgewachsen sind. Schade für Azar Nafisi, die es offenbar gern gesehen hätte, wenn sie von Angelina Jolie gespielt worden wäre, wie Riklis im Zoom-Gespräch erzählt.
Womöglich macht dieser Film aber auch alles wieder etwas einfacher. Denn Riklis hat nur das Buch verfilmt, nicht die politischen Kontroversen, die es damals begleitet haben: «Ich wollte, dass dieser Film von allen verstanden wird, auch wenn man noch nie ein Buch gelesen hat.» Bloss kein Literaturseminar also; sein Film sollte möglichst zugänglich sein.
Ironischerweise wird dadurch deutlich, dass die Kritik an Azar Nafisis Buch damals nicht nur falsch war. In ihrem Literaturverständnis und in ihren Methoden wirkt diese Dozentin im Film (gespielt von Golshifteh Farahani) ziemlich aus der Zeit gefallen. Selbst wenn sie sich dagegen ausspricht, Literatur als Interpretation des Lebens (im Iran oder anderswo) zu sehen, bedient der Film doch immer wieder krude Analogien: Alle Frauen im Iran sind Lolita (kontrolliert und von vergangenheitsbesessenen Männern ihrer Autonomie beraubt), und die arrangierten Ehen bei Jane Austen kennen sie auch aus eigener Erfahrung.
Koloniale Muster
Die antiimperialistische Kritik am Buch mochte übersteuert gewesen sein – namentlich eine Attacke von Columbia-Professor Hamid Dabashi, der sich seinerzeit in einem langen Essay zum grotesken Vorwurf verstieg, das Buchcover mit zwei jungen Frauen im Hidschab bediene orientalistisch verbrämte pädophile Fantasien. Doch in einem zentralen Punkt war die damalige Kritik ziemlich präzise.
Denn so, wie sich Azar Nafisi zur Ermächtigung ihrer Studentinnen auf altgediente Klassiker eines eurozentrischen Kanons stützt, reaktiviert sie tatsächlich alte koloniale Muster – und zementiert so den Gegensatz zwischen liberalem «Westen» und islamischer Welt. Westliche Kultur als vorgeblich ideologiefreies Instrument der Emanzipation? Als Programm ist das seinerseits hochgradig ideologisch – und angesichts der Bestrebungen, den Kanon der englischsprachigen Literatur zu erweitern und diverser zu machen, auch seltsam rückständig.
Allerdings: Rund zwanzig Jahre nach dem Buch erweitert die Verfilmung von «Reading Lolita in Tehran» nochmals den Assoziationsraum. Bücherverbote? Gibts ja auch heute wieder, nicht nur in Gottesstaaten – man denkt jetzt unweigerlich auch an die USA unter Trump, wo Bibliotheken gesäubert und Bücher von Lehrplänen verbannt werden.
«Reading Lolita in Tehran». Regie: Eran Riklis. Italien/Israel 2024. Jetzt im Kino. Das Buch von Azar Nafisi ist unter dem Titel «Lolita lesen in Teheran» auf Deutsch als Taschenbuch bei btb erschienen.