Fanon damals: Prophet mit vielen Facetten
Am 20. Juli jährt sich der Geburtstag des wohl bedeutendsten Vordenkers kolonialer Befreiungsbewegungen zum 100. Mal. Zwei Neuerscheinungen blicken auf dessen Leben zurück.

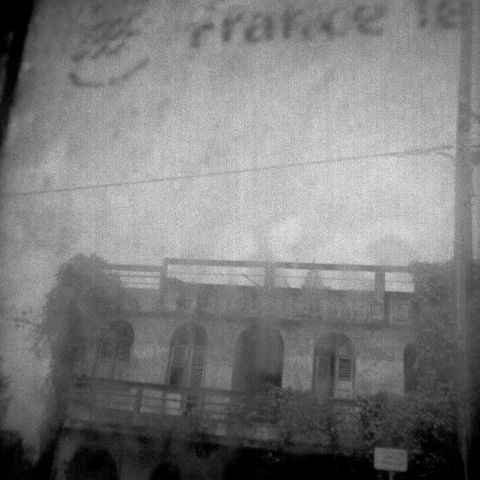
Im November 1960 reist ein Mann mit tunesischem Pass unter falschem Namen, einem «nom de guerre», in Mali ein, um im Auftrag der algerischen Befreiungsfront FLN einen Schmuggelpfad für Waffen durch die Wüste zu organisieren. So beginnt die Biografie «The Rebel’s Clinic», in der Adam Shatz so ausführlich wie differenziert darlegt, wie dieser Mann, der eigentlich ein französischer Arzt war und kaum ein Wort Arabisch sprach, mit seiner Arbeit in Nordafrika die Psychiatrie revolutionierte. Und so ganz nebenbei zum Vordenker des antikolonialen Befreiungskampfs werden sollte, aus dessen Schrift «Die Verdammten dieser Erde» (1961) Ende der sechziger Jahre Rebell:innen überall auf der Welt zitieren konnten.
Pünktlich zum 100. Geburtstag erscheint «The Rebel’s Clinic» jetzt unter dem Titel «Arzt, Rebell, Vordenker» in deutscher Übersetzung, mit dem bezeichnenden Untertitel «Die vielen Leben des Frantz Fanon». Dass es über 600 Seiten braucht, um dem Wirken eines Menschen, der nur 36 Jahre alt wurde, gerecht zu werden, verrät bereits viel – auch über den Anspruch des Biografen. Shatz, US-Journalist und Redaktor der «London Review of Books», hat aus den hintersten Archivwinkeln Schriften von Fanon zusammengetragen, Quellen zu Weggefährt:innen ausgewertet, seine einstige Sekretärin, «Vertraute und Muse» Marie-Jeanne Manuellan befragt sowie eine Vielzahl an Werken zeitgenössischer Intellektueller eingearbeitet.
Aus dieser Materialfülle meisselt er gleich mehrere multidimensionale Porträts von Frantz Fanon: Da ist der «native son» aus Martinique; der Algerier, der in seiner Wahlheimat von den Einheimischen nie als einer der ihren anerkannt wurde; der Exilant in Tunis; der Panafrikanist und schliesslich der Prophet der Befreiung. Dabei arbeitet Shatz auch Ambivalenzen und Widersprüche heraus und setzt sich so wohltuend von all den historischen Vereinnahmungsversuchen ab. Letztlich wird Fanon aber doch nicht wirklich fassbar.
Auf Fanons Spuren
Der französische Fotograf Bruno Boudjelal hat sich 1993 aufgemacht, seine algerischen Wurzeln zu erkunden – eine verstörende Erfahrung, die ihn auf Fanons Spuren führte: von Martinique über Algerien und Tunesien bis nach Ghana. Die Suche geriet zum fortgesetzten «Prozess des Scheiterns», klagte Boudjelal in einem Interview: Nie habe er gefunden, was er erwartet habe. Beim Versuch etwa, die psychiatrische Klinik im algerischen Blida zu besuchen, sei ihm Fanons letzter noch lebender Patient begegnet. Doch der wollte nicht mit ihm sprechen. Er habe nur drei Fotos von ihm machen können, dann sei der Mann verschwunden.
Algerien, Fanon, die eigene Herkunft und Identität als letztlich unzugänglicher, nicht fassbarer Ort: Diese Erfahrung aus über zehn Jahren Spurensuche visualisierte Boudjelal 2013 in einer Serie von Bildern. Scheinbar flüchtige Aufnahmen, geisterhaft, beunruhigend. Und vielleicht gerade darin Fanon nah.
Das passt zu einem, der in «Schwarze Haut, weisse Masken» 1952 so eindrücklich auf den Punkt gebracht hat, was es bedeutet, als Schwarzer in einer von Rassismus und Kolonialismus geprägten Welt zu existieren: vom weissen Blick fixiert als das Andere, auf die Haut reduziert und negiert in der eigenen Individualität und Identität.
Zwiespältiger Gewaltbegriff
Auf Resonanz stiess Fanon mit dieser frühen Schrift, die eigentlich sein abgelehntes Dissertationsprojekt war, erst posthum, insbesondere bei zentralen Exponent:innen der Critical Race Theory. Ja, man könnte behaupten, er lieferte damit, zusammen mit «Die Verdammten dieser Erde», das Fundament für diese transdisziplinäre Theorieströmung, die in den neunziger Jahren neue Perspektiven auf Rassismus und Kolonialismus eröffnete – ein Aspekt, der bei Shatz seltsam unterbelichtet bleibt .
Ähnliches gilt auch für das jüngst publizierte Buch von Philipp Dorestal über Fanon als «Denker der Dekolonisation»: Über weite Strecken erörtert der Historiker darin politphilosophische Fragen rund um die Schwarze Existenz, mit einer Vielzahl an Referenzen und Zitaten, die in den Klassikern der Critical Race Theory längst kanonisiert worden sind. Der verdienstvolle Versuch, Fanons Aktualität aufzuzeigen, gerät so zur Rückwärtsvolte, die in der Erkenntnis gipfelt, wie erschreckend aktuell Fanons Beschreibungen von gedankenlosem Alltagsrassismus noch immer sind.
Fanon sah diesen Rassismus – und das sollte sich zum Kern der Critical Race Theory verdichten – in den Strukturen des politischen Systems begründet und durch dessen zentrale Institutionen reproduziert. Und zwar mit Gewalt. Daher lasse sich das Kolonialsystem, so folgerte er, nur mit Gewalt überwinden. Dass er dabei von der «reinigenden Kraft» der Gewalt sprach, mit der die Unterdrückten sich vom Joch des Rassismus befreien und ihre Würde als Mensch wiedererlangen würden, liess ihn als Apologeten der Gewalt in die Annalen eingehen.
Shatz und Dorestal stemmen sich klar gegen diese verkürzte Sichtweise, was angesichts aktueller Versuche der Vereinnahmung Fanons nicht genug betont werden kann (vgl. «Die strukturelle Natur der Gewalt»). Und wer «Die Verdammten dieser Erde» tatsächlich zu Ende liest (und nicht nur das erste Kapitel), merkt schnell, wie ambivalent Fanon Gewalt grundsätzlich gegenüberstand: Die letzten Kapitel mit Fallanalysen seiner Patient:innen machen nur allzu deutlich, wie selbstdestruktiv Gewalt letztlich ist, und zwar genauso für die Folterer und Schlächter der Kolonialmacht wie für jene, die im Namen des Befreiungskampfs mordeten.
Dazu war Fanon, wie Shatz herausarbeitet, auch viel zu verstrickt in die Wirren des Algerienkriegs, ein Gefangener letztlich seines Wissens um Massaker und Gräueltaten, die auch von der FLN und rivalisierenden Splittergruppen begangen wurden und zu denen er als Repräsentant und Sprachrohr der Befreiungsbewegung doch schweigen musste. «The Rebel’s Clinic» taucht tief in die komplexen Geflechte des algerischen Unabhängigkeitskampfs ein, um das zu verdeutlichen.
Überhaupt ist «Die Verdammten dieser Erde» weniger theoretische Analyse denn Manifest, ein «Pamphlet», wie Fanons Vertraute Manuellan gegenüber Shatz betonte: Der Todkranke hatte es ihr in den letzten Wochen seines Lebens mit fiebriger Dringlichkeit in die Schreibmaschine diktiert. Shatz selbst spricht von einer verschriftlichten Spoken-Word-Performance, sieht den «native son» aus Martinique in der Tradition westindischer Geschichtenerzähler.

Fanon und die Black Panthers
Heutige Leser:innen muten der appellartige Tonfall, das vereinnahmende «wir» und die eingestreuten «Brüder» und «Kameraden» mitunter seltsam an. Die englische Übersetzung, die 1965 in den USA herauskam, schlug dort indes wie eine Bombe ein: Im August brachen im Stadtviertel Watts von Los Angeles Unruhen aus, die den Auftakt einer Serie urbaner Ghettorevolten in den folgenden Jahren bildeten. Im Sommer 1966 spaltete Stokely Carmichael mit seinem Ruf nach «Black Power» die Bürgerrechtsbewegung und berief sich in seiner Rede explizit auf Fanon. Nur Wochen später gründeten Huey Newton und Bobby Seale in Kalifornien die Black Panther Party – mit einem Parteiprogramm, in dem sie sich in Anlehnung an Fanon als «schwarze koloniale Subjekte» bezeichneten und zum Teil des internationalen Befreiungskampfes erklärten.
Dass bei Shatz ausgerechnet die Panthers, die Frantz Fanon und seinem Werk zu globaler Resonanz verhalfen, nur als Randnotiz auftauchen (und das vor allem am Beispiel einer Person, die gar nie in der Partei aktiv war), ist eine grosse Leerstelle in diesem lesenswerten Buch. Denn die Panthers setzten sich intensiv mit Fanon auseinander – «Die Verdammten dieser Erde» galt als Pflichtlektüre für alle Mitglieder. Sie übertrugen Fanons Analyse des Kolonialsystems auf die USA, zeichneten die urbanen Ghettos als «interne Kolonien», in denen die Polizei als «Besatzungsarmee» auftrat, und sahen die fortgesetzte Unterdrückung von Schwarzen im strukturellen Rassismus zentraler Institutionen wie Polizei, Justiz, Schule, Wohlfahrt, Gesundheitswesen und Arbeitsmarkt begründet.

Als Partei versuchten sich die Panthers, eng an Fanon angelehnt, als jene disziplinierte, hierarchisch aufgebaute intellektuelle «Speerspitze» zu formieren, die das «Lumpenproletariat» der Besitzlosen organisieren und zur Revolution führen sollte. Sosehr sie dabei rhetorisch die Keule der Gewalt schwangen und sich in der Öffentlichkeit als Guerillakämpfer:innen inszenierten: Im Alltag organisierten sie bald in jeder grösseren US-amerikanischen Stadt die lokale Ghettobevölkerung und riefen konkrete Aufbauprojekte in der Schwarzen Community ins Leben – es gab Frühstücksprogramme für Kinder, «Freedom Schools», gratis Essens- und Kleiderverteilung, kostenlose Gesundheitsversorgung in eigenen Kliniken und vieles mehr. Wie sehr die Black Panthers damit auch ohne Gewalt zu ebenjener individuellen wie kollektiven Selbstermächtigung beitrugen, auf die Fanon abzielte, ist seither in zahlreichen Oral-History-Projekten bezeugt worden.
Die wohl wichtigste Lektion, die die Panthers von Fanon mitnahmen, zeigte sich in einer Ablehnung jeglicher Essenzialisierung von Schwarzsein und der damit verbundenen rückwärtsgewandten Mystifizierung Afrikas. «Meine schwarze Haut ist nicht der Hort bestimmter Werte», schrieb Fanon. Bei den Black Panthers hiess das dann lakonisch: «Aus dem Ärmel eines Dashiki entsteht keine Macht.» Stattdessen schmiedeten sie Allianzen mit anderen diskriminierten Minderheiten und formten diese zu einer «Regenbogenkoalition» aller Hautfarben und sexuellen Orientierungen, die im Versuch gipfelte, eine neue, diskriminierungsfreie US-Verfassung zu schreiben.
Von einer solchen inklusiven Revolution, die sich gegen alle Formen von Privilegierung richten würde, träumte auch Fanon, wie Shatz herausstreicht. Eine solidarische Utopie, die nichts an Aktualität verloren hat.
Adam Shatz: «Arzt, Rebell, Vordenker. Die vielen Leben des Frantz Fanon». Aus dem Englischen von Marlene Fleissig und Franka Reinhart. Propyläen Verlag. Berlin 2025. 640 Seiten.
Philipp Dorestal: «Denker der Dekolonisation. Zur Aktualität von Frantz Fanon». Karl Dietz Verlag. Berlin 2025. 184 Seiten.