Beirut Rund 1,5 Millionen Syrer:innen leben im Libanon – die meisten in prekären Verhältnissen, als nicht anerkannte Flüchtlinge und in steter Angst, verhaftet und ausgeschafft zu werden.

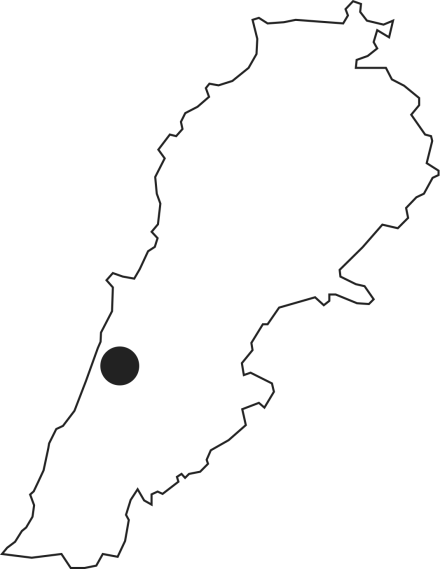
Die Fahrt von der Bekaa-Ebene runter an die Küste nach Beirut dauert rund eine Stunde. Von weit oben schon erkennt man durch den Dunst das Wimmelbild der Hochhäuser, bis die Autobahn ins Häusermeer eintaucht, in die gedrängte libanesische Hauptstadt, deren Alltag an der Oberfläche von Stromausfällen und Verkehrsstaus geprägt ist – und darunter von den ungelösten Konflikten, die bis heute den Rändern der Stadtviertel entlang die Gesellschaft spalten.
Im Süden Beiruts führt eine Strasse ins palästinensische Flüchtlingslager Burdsch al-Baradschneh. Kleine Gassen zweigen ab, manche werden so eng, dass Autos nicht mehr durchkommen und die Sonne zwischen den hohen Steinbauten kaum bis zum Boden dringt. In einer dieser Gassen führt Fatima Chalife eine schmale Treppe hoch.
Ganz oben schliesst sie eine Tür auf. «Jana Studio» steht auf einer Plakette drinnen an der Wand. In einem Regal sind sorgsam bestickte Kissen aufgereiht. Seit drei Jahren betreibt Chalife hier ihr Nähstudio: Zusammen mit knapp zwanzig anderen Frauen im Lager entwirft sie Stickmuster, wählt Farben aus, bestickt auf Bestellung Kissen und Kleider, ein traditionelles palästinensisches Handwerk.

Fatima Chalifes Geschichte ist die einer Frau, die bei ihrer Flucht aus Syrien alles zurücklassen musste, im Libanon bei null anfing – und gegen alle Widrigkeiten ein eigenes Geschäft aufbaute. Doch je länger sie erzählt, desto deutlicher werden die Einschränkungen, die ihren Alltag bestimmen: Das Geld reicht kaum, um die Miete und die Schule ihrer siebenjährigen Tochter Jana zu bezahlen, nach der ihr Studio benannt ist. Sie leben im Libanon ohne Aufenthaltspapiere – ohne Perspektive.
Als sie hierhergekommen sei, habe sie gedacht, sich ein neues Leben aufbauen zu können, sagt Chalife. «Heute wünsche ich mir nur noch, dass wir das Land verlassen können, irgendwohin, ausser nach Syrien.»
Ständige Angst, getrennt zu werden
Fatima Chalife ist eine von rund anderthalb Millionen Syrer:innen im Libanon. Sie verliess ihr Land 2013, zwei Jahre nach den ersten Protesten und dem Ausbruch des Kriegs in Syrien. Damals eskalierte die Gewalt. Das Regime von Präsident Baschar al-Assad liess nicht mehr «nur» schiessen auf Demonstrierende – es schickte die Luftwaffe, um bewaffnete Rebellengruppen und Zivilist:innen gleichermassen zu bombardieren. Zehntausende flohen, bald Hunderttausende: aus ihren Dörfern, belagerten Stadtteilen und Städten, über die Landesgrenzen – in den Libanon, die Türkei, nach Jordanien, in den Irak.
In Syrien liess Chalife ein erfolgreiches Leben zurück. Obwohl erst Mitte zwanzig, betrieb sie bereits ihr eigenes Kleider- und Kosmetikgeschäft. Als sie ging, nahm sie nichts mit ausser ihrem Pass. «Ich dachte, ich würde bald wieder zurückkehren.» Doch als sie Burdsch al-Baradschneh in Beirut erreichte, traf sie dort auf Geflüchtete aus ganz Syrien, aus Deir Ezzor, Aleppo, Homs, Daraa. «Da habe ich realisiert, dass diese Krise in Syrien grösser ist, als ich dachte.»
2013 konnten Syrer:innen visumsfrei in den Libanon einreisen und ihren Aufenthalt unbürokratisch verlängern. Als Flüchtlinge anerkannt wurden sie jedoch nicht. Der Libanon hat die Genfer Flüchtlingskonvention nie unterzeichnet. Das zentrale Prinzip der Regierung im Umgang mit den syrischen Geflüchteten war, zu verhindern, dass diese dauerhaft im Land bleiben würden. Ende 2014 begann die Regierung, die Regeln zu verschärfen: Wer einreisen wollte, brauchte nun ein Visum, die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung kostete alle sechs Monate 200 US-Dollar. Wer nicht beim Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) registriert war, brauchte einen libanesischen Sponsor, um sich anzumelden. Ab 2015 untersagte die Regierung dem UNHCR, neue Geflüchtete zu registrieren. Als Folge davon leben heute über achtzig Prozent der Syrer:innen im Libanon illegal im Land.

In den ersten Jahren im Libanon arbeitete Fatima Chalife für verschiedene NGOs. 2019 aber machte sie sich selbstständig. Sie hatte genug von der Arbeit bei Hilfsorganisationen. «Du lebst ständig mit der Unsicherheit, ob sie das nächste Jahr noch eine Finanzierung finden – und du noch Arbeit hast.» Ihre Entscheidung fiel in dem Jahr, in dem ein Finanzkollaps den Libanon in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte stürzte.
Heute arbeitet Chalife jeden Tag über zwölf Stunden. Dennoch reicht das Geld nur knapp. Ihre Tochter kann die Schule nur bis zur sechsten Klasse besuchen – ohne Abschluss, da sie keine legalen Papiere hat. Wenn Chalife Termine ausser Haus hat, schliesst sie ihre Tochter in der Wohnung ein. Auf die Strasse runter lasse sie sie nie allein. «Kinder werden ständig belästigt», sagt sie. Wenn Chalife allein unterwegs ist, begleitet sie die Angst: Was, wenn sie einen Autounfall hätte, während Jana allein in der abgeschlossenen Wohnung ist?
Ihr Leben ist in einer Sackgasse angelangt. Wie die meisten Syrer:innen im Libanon ist sie in einem rechtlosen Schwebezustand gefangen. Eine Rückkehr nach Syrien ist für viele der Geflüchteten undenkbar: In den Gebieten, die das Regime Assads kontrolliert, drohen Verhaftung, Folter, Tod. Auch die Migration aus dem Libanon in andere Länder ist schwierig bis unmöglich geworden. Es gibt kaum noch welche, die Syrer:innen aufnehmen. Eine Flucht nach Europa führt entweder über das Mittelmeer – oder über Syrien.
Als die libanesische Armee im Mai dieses Jahres anfing, Syrer:innen zu verhaften und zu deportieren, habe sie die Wohnung nicht mehr verlassen, sagt Chalife. Einen Monat lang sei sie nicht von Janas Seite gewichen, aus Angst, sie könnten getrennt werden. «Jana gegenüber versuche ich, immer fröhlich zu sein. Aber eigentlich geht es mir überhaupt nicht gut.»
Keine Aussicht, je dazuzugehören
Chalil Abbas will sich nicht damit abfinden, dass er zur Perspektivlosigkeit verdammt sein soll. Auch er floh 2013 in den Libanon. Doch als Palästinenser, der in Syrien geboren wurde, ist seine Lage noch komplizierter: Während sich Syrer:innen beim UNHCR für eine Umsiedlung in ein anderes Land anmelden können und damit wenigstens eine kleine Chance haben, den Libanon nach Jahren des Wartens zu verlassen, haben Palästinenser:innen diese Möglichkeit nicht. Umsiedlungen gehören nicht zum Mandat des Uno-Hilfswerks für Palästinenser:innen (UNRWA), bei dem Abbas, der seinen richtigen Namen für sich behalten will, registriert ist. Weil die Türkei den Palästinenser:innen kein Visum ausstellt, konnte Abbas 2015 auch nicht in die Türkei einreisen, um von dort Richtung Griechenland zu fliehen – so, wie es zahlreiche Syrer:innen aus dem Libanon taten. Stattdessen versuchte er drei Mal, von der libanesischen Küste aus mit einem Schlepperboot in die Türkei zu gelangen. Erfolglos.
Abbas’ Wohnung liegt mitten im Flüchtlingslager Schatila, das wie Burdsch al-Baradschneh einst als Flüchtlingslager für jene Palästinenser:innen entstand, die im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 aus Palästina vertrieben worden waren. Schatila ist noch trostloser als Burdsch al-Baradschneh, die Gassen noch enger und düsterer – zwischen den nackten Backsteinwänden hängen die Stromkabel tief über den Köpfen. «Die Flüchtlingslager in Syrien dagegen waren ganz normale Stadtviertel», sagt Abbas.

Sein Grossvater war während der Nakba, der «Katastrophe», wie die Flucht und Vertreibung aus Palästina auf Arabisch genannt wird, in den späten 1940er Jahren aus Palästina nach Damaskus geflohen. Abbas selbst wuchs in Syrien auf und arbeitete später als Taxifahrer. Im Libanon ist ihm das als Palästinenser verboten. Jetzt schlägt er sich mit Maleraufträgen durch.
Die Lage der Palästinenser:innen im Libanon ist miserabel. Sie sind staatenlos, dürfen ausserhalb der Flüchtlingslager keine Häuser besitzen, nur in ganz wenigen Berufen arbeiten. Die Gründe dafür sind vielschichtig, ein wichtiger jedoch ist das politische System im Libanon, das das Land in vielem paralysiert: Rechtlich verbrieft, teilen sich hier verschiedene Konfessionen die Macht. Der Kampf um Einfluss unter ihnen ist immer auch einer um die Demografie – wie gross darf welche Gruppe werden? So wollen etwa die christlichen Gruppen verhindern, dass die Präsenz der mehrheitlich muslimischen Palästinenser:innen dauerhaft wird.
Die gleiche Überlegung trifft auch die Syrer:innen: «Für den libanesischen Staat sind die Syrer:innen einfach Sunnit:innen, keine Geflüchteten», sagt der libanesische Forscher Joey Ayoub, Autor und Produzent der Podcasts «The Fire These Times». Der Staat perpetuiere die prekäre Existenz der Syrer:innen und schaffe damit eine Unterklasse, die in ständiger Angst lebe. «Das ist beabsichtigt: Sie wollen, dass die Syrer:innen freiwillig zurückkehren.»
Chalil Abbas kann nicht verstehen, warum er als Palästinenser, der zuvor in Syrien lebte, nun im Libanon dieses prekäre Dasein fristen soll. Ende 2014 gründete er ein Netzwerk mit, das sich für die Belange der syrischen Palästinenser:innen im Libanon einsetzt. Es organisierte Proteste vor Botschaften, forderte, den syrischen Palästinenser:innen Asyl zu gewähren. Sie schrieben einen Brief an den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in Ramallah, Mahmud Abbas, mit der Bitte, sie aufzunehmen. Sie organisierten eine Demonstration vor dem Büro der Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (ESCWA) in Beirut, damit sie Druck auf die israelische Regierung ausübe, ihnen die Rückkehr in die Gebiete der PA zu erlauben. Ihre Rufe bleiben ungehört.
Die teilweise mehrfache Vertreibung, der Ausnahmezustand des Exils, der mit den Jahren und Jahrzehnten zu einer prekären Normalität wird: Diese Erfahrungen prägen die palästinensische Diaspora seit Jahrzehnten. Seit der Nakba sind die Palästinenser:innen ein zersplittertes Volk, verteilt auf zahlreiche Länder, mit unterschiedlichen rechtlichen Status und Lebensrealitäten. «Selbst in der dritten oder vierten Generation fühlst du dich, als ob du an keinen Ort richtig gehörst», sagt Joey Ayoub, dessen Grossvater ebenfalls aus Palästina geflohen war.
Manche dieser Erfahrungen müssen mehr und mehr auch die Syrer:innen machen: Der Krieg hat sie über die ganze Welt verteilt, selbst innerhalb Syriens leben Millionen Binnenvertriebene in Lagern. Das Leben im Exil, von dem am Anfang alle dachten, es würde vielleicht ein paar Monate dauern, zieht sich seit Jahren hin, ohne dass ein Ende absehbar ist. Aus Bürger:innen eines Landes wurden Geflüchtete, Migrant:innen, Geduldete und nicht Geduldete. Je nachdem, wo sie hinkommen, erleben sie «verschiedene Schattierungen der Instabilität», wie es Ayoub formuliert: ein Leben, in dem sich ihre prekäre Existenz ohne Aussicht auf Stabilität in die Zukunft erstreckt.
«Du kannst nicht sagen: ‹Geh nicht!›»
Am anderen Ende der Stadt, im christlichen Achrafieh-Viertel im Norden Beiruts, durchlebt Dalin Nachleh den Abschiedsschmerz der Migration in Zeitlupe. Der Bewerbungsprozess für das humanitäre Visum für Australien hat Jahre gedauert, bis sie, ihre Mutter und ihre Geschwister endlich den Entscheid erhielten, dass sie aufgenommen seien. Nachleh kam 2016 in den Libanon. Zuerst lebte sie mit ihrer Familie in der Bekaa-Ebene. Später zog sie allein nach Beirut. Und obwohl sie immer wusste, dass sie hier nicht bleiben wolle, sei es eine wichtige Station gewesen für sie: «Ich bin reifer geworden in dieser Stadt», sagt sie. «Was ich heute über mich weiss, weiss ich wegen all dem Schönen und Schlechten, das ich hier erlebt habe.»
Beirut im Juni. Seit Wochen wartet Nachleh darauf, dass die Botschaft ihnen die Visa schickt. Das Warten zermürbt sie. Bereits hat sie angefangen, ihr Leben hier aufzulösen: Sie hat ihre Wohnung aufgegeben, schläft bei Freund:innen oder in der winzigen Einzimmerwohnung einer Bekannten, von deren Dachterrasse sie ins Häusermosaik am Hügel gegenüber sehen kann, manchmal bei ihrer Familie ausserhalb Beiruts. Die Abreise steht bevor. Doch die Zeit bis dahin zieht sich in die Länge, ohne dass Nachleh mit ihrem Leben einen Schritt weiterkäme.

Sie denkt viel darüber nach, was die Migration mit ihr machen wird. «Wenn ich mit Freunden telefoniere, die gegangen sind, fällt mir auf, dass sich ihre Gesichter mit der Zeit verändern», sagt Nachleh mit ihrer ruhigen, tiefen Stimme. «Sie sehen plötzlich gesünder aus», nachdem der tägliche Stress weggefallen sei, den der Alltag in Beirut bedeutet. Die Stromunterbrüche, die Staus und die tägliche Frage, wie viel das libanesische Pfund gerade an Wert verloren hat; die Nachrichten zu Spannungen an der Grenze zu Israel, über neue Restriktionen und Massnahmen gegen die Syrer:innen; die Angst vor einem Krieg: All das lässt die Bewohner:innen Beiruts mit der Zeit erschöpft oder gestresst zurück, häufig beides.
Derweil bereiten sich Nachlehs Freund:innen auf die Leere vor, die sie hinterlassen wird. Es sei wie bei einer Trennung, sagt Wael Kays: «Man braucht ein paar Tage, bis man akzeptiert: Die Person ist nicht mehr hier. Jene, die wir jeden Tag gesehen haben, sehen wir nur noch über Whatsapp. Aber ich möchte nicht, dass auch unsere sozialen Beziehungen nur noch online sind.» Sein Problem, das Problem der syrischen Gesellschaft überhaupt, so Kays, sei die Instabilität. «Aber wenn jemand plötzlich die Chance erhält, auszureisen, kannst du nicht sagen: ‹Geh nicht!› Du kannst niemanden abhalten davon, seine Situation zu verbessern. Das wäre egoistisch.»
Das ständige Abschiednehmen erschöpft ihn. An einem Abend nach einer Filmvorstellung, in einer Runde im warmen Licht auf der Terrasse eines Restaurants, bricht es aus ihm heraus. Kays erzählt, wie es ihn getroffen habe, als einer seiner besten Freunde plötzlich Bescheid erhielt, dass er nach Italien reisen könne. «Einige Tage später war er weg.» Darum habe er bereits angefangen, sich von Nachleh innerlich zu verabschieden. Dabei ist sie noch hier.

Dalin Nachleh kennt diese Gefühle – sie war selbst jahrelang diejenige, die zurückblieb und ihre Freund:innen, die Beirut verliessen, verabschiedete. «Wenn jemand abreist, gibt es dieses Verdrängen bei den Freunden. Sie wollen nicht glauben, dass jemand abreist. Wenn mir jetzt aber jemand sagt: ‹Ich glaube nicht, dass du gehst›, macht es das schwerer für mich.»
Der Krieg und die Flucht Hunderttausender haben Familien auseinandergerissen; Dörfer, Nachbarschaften und Freundeskreise in alle Welt zersprengt. «Es gibt keine syrische Gesellschaft mehr», sagt Kays. Das Abschiednehmen ist zu einer zentralen Erfahrung der Syrer:innen geworden. Selbst jene, die in Syrien zurückgeblieben sind, wurden entwurzelt: Weil so viele jener, die sie einst umgaben, nicht mehr da sind.
Der Abschied aber ist auch ein Teil der Identität Beiruts. Viele Syrer:innen sahen im Libanon von Anfang an eine «Station», die temporär sein wird, weil es so schwer ist, sich hier legal niederzulassen. Menschen kommen und gehen, das Dasein vieler hier ist flüchtig, Freundschaften bilden und verlieren sich wieder. Doch viele, die gegangen sind, denken mit Wehmut an Beirut zurück: an diesen Ort, an dem so vieles hätte möglich sein können.
Denn einst – in den sechziger und siebziger Jahren, bevor der Libanon selbst in einem jahrelangen Krieg versank – war Beirut ein Zentrum für das arabische Exil. Zahlreiche Oppositionelle, die vor der Repression in den umliegenden Ländern flohen, fanden hier Zuflucht. Das Hamra-Viertel war das pulsierende Herz dieser Gemeinschaft: Hier trafen sich Intellektuelle, Schriftstellerinnen und Aktivisten. «Beirut wurde zum Besitz all jener, die von einer anderen politischen Ordnung träumten», schrieb der palästinensische Poet Mahmud Darwisch, der in jener Zeit in Beirut weilte, in seinem Buch «Memory of Forgetfulness». Die Stadt beherbergte das Chaos, «das eine Antwort war für alle Exilant:innen auf die komplexe Existenz im Exil. Zu Beirut zu gehören, wurde zu einer legitimen Opposition gegen die arabische Unterdrückung.»
Rückzug und Resignation
Heute ist das kosmopolitische Beirut von damals ein Schatten seiner selbst. Es gibt sie noch, die Restaurants und Bars in Hamra, in denen sich Intellektuelle treffen und über Politik diskutieren, und von 2013 bis 2015 spielte Beirut auch für die syrische Zivilgesellschaft die Rolle einer Hauptstadt im Exil. Doch mit der zunehmenden Repression gegen die Geflüchteten, spätestens seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise 2019, verliessen die meisten, die konnten, den Libanon.
Wael Kays ist einer jener wenigen, die in Beirut bleiben wollen. Vor ein paar Jahren hätte er die Möglichkeit gehabt, von Istanbul aus per Botschaftsasyl nach Frankreich auszuwandern. Er entschied sich dagegen, als Flüchtling in Europa bei null anzufangen. Stattdessen ging er in den Libanon.
Aufgewachsen ist er in der syrischen Hauptstadt Damaskus, im Stadtviertel Rukn al-Din. Auch hier gingen 2011 Tausende auf die Strasse. Es bildeten sich zivilgesellschaftliche Gruppen wie die Revolutionäre Syrische Jugend, die in dem religiös und ethnisch gemischten Viertel für die Vision eines Syrien einstand, das allen Menschen Platz bietet, unabhängig von deren politischer Orientierung oder Religion. Doch Rukn al-Din wurde zum Schauplatz besonders brutaler Repression durch das Regime, nicht nur gegen die bewaffnete Opposition, sondern auch gegen friedliche Aktivist:innen. Für das Regime war es von zentraler Bedeutung, dieses Viertel unter seiner Kontrolle zu halten: Rukn al-Din liegt am Fuss des Kassiun-Bergs, von wo aus man über die Stadt hinweg bis zum Präsidentenpalast auf der anderen Seite sehen kann.
Wael Kays war damals schon seit Jahren politisch aktiv gewesen. Kurze Zeit war er Mitglied bei einer der kommunistischen Parteien – bis er resigniert feststellte, wie weit deren politische Arbeit von der Realität in Syrien entfernt war. Als 2011 die Revolution ausbrach, nahm er an Demonstrationen in anderen Quartieren teil. In Rukn al-Din war er, der Kommunist, zu bekannt. Gleichzeitig schrieb er als Journalist für verschiedene arabische Zeitungen und TV-Sender.
2013, nachdem das Regime in seinem Viertel Dutzende Aktivist:innen inhaftiert hatte, beschloss Kays zu fliehen. Er ging in die Türkei. Und wie viele geflüchtete Aktivist:innen arbeitete er weiter für verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, bis 2016 das Regime Aleppo, die zweitgrösste Stadt des Landes, zurückeroberte: «Für mich war das der Moment, in dem ich wusste: Wir haben verloren», sagt Kays. Da beschloss er, nicht mehr über Syrien zu berichten.
Damals lebte er in Istanbul. Als die Repression gegen die Syrer:innen dort ab 2019 zunahm, beschloss er, nach Beirut zu ziehen. Dank seiner libanesischen Mutter war es für ihn einfach, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Hier arbeitet er als Kulturjournalist. Über Syrien hingegen spricht er kaum. Mehr noch: Er versucht, dem Thema aus dem Weg zu gehen. Wenn Freunde über aktuelle Geschehnisse in seinem Heimatland zu sprechen beginnen, antwortet er nur knapp, um eine Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Damit ist er nicht allein. 2011 waren die meisten, die bei den Demonstrationen ihr Leben riskierten, Anfang bis Mitte zwanzig. Sie hatten grosse Hoffnungen, dass das Regime gestürzt und eine bessere Zukunft für ihr Land folgen würde. Heute sind sie erschöpft, enttäuscht, traumatisiert. Viele sehen keinen Sinn mehr darin, sich politisch für Syrien zu engagieren. Manche zogen sich vollständig ins Privatleben zurück, andere brachen den Kontakt zu jenen, die noch immer aktiv sind, ab. Weil sie nicht einmal mehr an Syrien erinnert werden wollen – an dieses Land, in dem das Regime trotz all seiner Verbrechen, trotz der Fassbomben und der Giftgasangriffe noch immer an der Macht ist. Die Aktivist:innen mussten zusehen, wie die Rebellengruppen in den Gebieten, die sie noch kontrollierten, dem Befehl anderer Länder wie der Türkei folgten und ihre eigenen kleinen autoritären Regimes aufbauten; wie das Land gespalten wurde und heute von unterschiedlichen Gruppen kontrolliert wird; wie die Wirtschaft am Boden ist und das Regime Häfen am Mittelmeer und Häuser in Damaskus an Russland und den Iran verschachert.
Sie wissen, dass sie, zusammen mit der ganzen syrischen Bevölkerung, die grossen Verlierer:innen der letzten Jahre sind: die syrische Zivilgesellschaft, die es 2011 wagte, von einem politischen Wandel zu träumen.

