Schikanen in der Provinz Im autobiografisch grundierten Roman «Das Ende ist nah» erzählt Amir Gudarzi von Gewalt, Rassismus und den Wirren des Asylverfahrens in Österreich.

Amir Gudarzi ist 2009 aus dem Iran geflohen und hat in Österreich Asyl beantragt – wie sein Protagonist A. Aber A. habe mit Amir nicht so viel zu tun, sagte Gudarzi in einem Interview, sondern stehe generell für «Antragsteller» in Asylverfahren. Mit diesem Kürzel werden Asylsuchende in offiziellen Dokumenten benannt.
Gudarzi, der bei seiner Ankunft neben Farsi auch Englisch sprach, setzte sich schon bald für seine Leidensgenoss:innen ein und begleitete sie als Übersetzer zu den Behörden. Später machte er als Sozialarbeiter einen Beruf daraus, und so flossen die Erfahrungen vieler anderer Asylsuchender in seinen Roman «Das Ende ist nah» ein.
«Alles bewahren»
Die österreichischen Behörden kommen nicht gut weg im Prosadebüt von Gudarzi, der als Theaterautor schon einige Erfolge vorweisen kann. Minutiös schildert er aus wechselnder Perspektive – als Ich-Erzähler oder als A. in der dritten Person – den Leidensweg eines Asylsuchenden, die Schikanen im Erstaufnahmelager Traiskirchen, die «Verbannung» in die Provinz, wo er mit anderen Iranern und einigen Afghanen in einer kleinen Dorfschule untergebracht war.
Der Heimleiter kam nur frühmorgens, brachte das Essen und war dann weg, weil er sich um seine Restaurants kümmern musste, die er im Hauptberuf betrieb. Die Männer (und eine Frau) waren sich selbst überlassen. Es gab keinen Deutschunterricht, keine Beratung. Wenn sie etwas einkaufen wollten, mussten sie stundenlang ins nächste Dorf wandern. Autostopp war keine Option, niemand nahm die fremd aussehenden Männer mit. Erst in Wien trifft A. auf freundliche und zugewandte Personen.
«Alles, was ich erlebt habe, alles, was ich gesehen habe, will ich bewahren: wie oft ich geweint habe und alle Bösartigkeiten, die ich erdulden musste.» Das schreibt der Ich-Erzähler in sein Notizbuch direkt nach einer Anhörung, in der A. deutlich gemacht wird, dass man ihm nichts glaubt und ihn hier nicht haben will.
Aber die Gewalterfahrungen begannen schon in A.s Kindheit im Iran. Amir Gudarzi ist 1986 geboren, er kennt also nur den «Gottesstaat» der Ajatollahs. In seinem Buch schildert er eine brutale patriarchale Gesellschaft, in der fast jeder versucht, den anderen zu betrügen, in der geprügelt und vergewaltigt wird. Erschütternd die Analyse des Autors, wie Knaben sexuelles Freiwild für die Männer sind, weil strenge Regeln diesen Kontakte zu Frauen derart erschweren.
Die Rolle der Frauen sieht Amir Gudarzi ebenfalls kritisch: In den iranischen Familien üben sie Zwang auf ihre Kinder aus, vor allem, wenn es um Heiraten geht. Das war auch ein ewiges leidiges Thema zwischen A. und seiner Freundin Ana in Teheran, die ihn zur Hochzeit drängte. Aber A. wollte nicht nur ein anderes Regime im Iran, weswegen er schon als Achtzehnjähriger auf die Strasse ging, sondern er strebte auch ein freies Leben als Künstler an, ohne Religion und ohne Zwänge. Er sei nicht die Hauptfigur, betont Gudarzi in einem Interview, da sein Roman immer wieder als «autobiografisch» bezeichnet wird. Natürlich gebe es Parallelen zu seiner eigenen Biografie – darüber zu schreiben, habe ihn schon Überwindung gekostet.
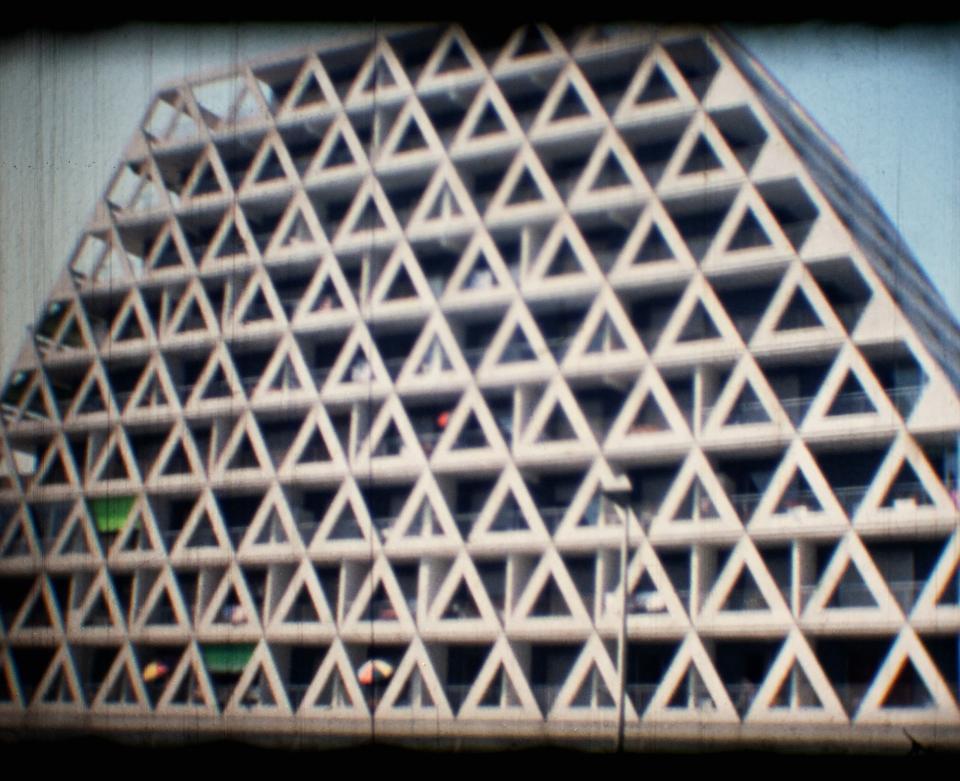
Die Liebe als Überforderung
Als A. seinen positiven Bescheid bekommt, freuen sich alle um ihn herum. Nur er selbst ist zu erschöpft, um das Glück fühlen zu können. Lange hatte er illegal in einer Pizzeria gearbeitet, musste schlecht bezahlt schuften bis zum Umfallen. Er rutschte in eine Depression, verursacht auch durch die lang andauernde Unsicherheit und das Heimweh. Dazu kam noch eine unheilvolle Beziehung zu einer Frau, die ihm zuerst wie ein hilfreicher Engel erschien. Die Studentin Sarah ist aus ungenannten Gründen auf die Widerstandsbewegung im Iran fixiert. Sie verfolgt ständig die entsprechenden Nachrichten im Internet und hat sich dafür sogar selbst Farsi beigebracht.
Als sie A. kennenlernt, verliebt sie sich in ihn. Sie hilft ihm mit Geld, vermittelt ihm Wohnmöglichkeiten und übersetzt sein Theaterstück ins Deutsche. Aber ihre Liebe ist für A. eine Überforderung. Als er sich zurückzieht, überhäuft Sarah ihn in langatmigen Mails mit Vorwürfen und mit tiefenpsychologischen Analysen seines angeblichen Geburtstraumas. Dass der Ich-Erzähler davon genervt ist, lässt sich durchaus nachvollziehen. Doch nach einem tragischen Ereignis quälen ihn Schuldgefühle.
Amir Gudarzi hat mit seinem Roman den Geflüchteten in Europa ein individuelles Gesicht gegeben und den Leser:innen damit die Chance, anders auf die «Fremden» zu reagieren als jene Dorfbewohner:innen, die auf dem Weg zur Kirche mit abgewandtem Blick an den Asylsuchenden vorbeieilen, die vor ihrem Heim in der alten Dorfschule stehen.
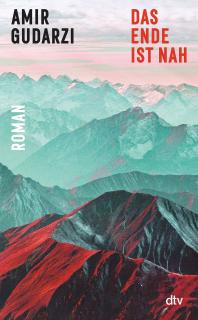
Amir Gudarzi liest in Solothurn am Fr, 10. Mai 2024, um 17.30 Uhr; Sa, 11. Mai 2024, um 14 Uhr und um 17.30 Uhr.