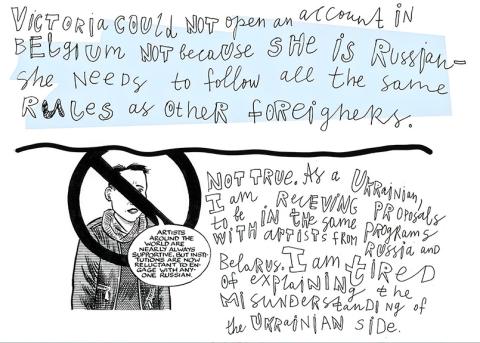In dieser Welt zwischen Ost und West

«Oberst Wasin fuhr an die Front
mit seiner jungen Frau,
Oberst Wasin trommelte sein Regiment zusammen
und sagte: Fahren wir nach Hause.
Seit siebzig Jahren schon führen wir Krieg,
man hat uns gelehrt, dass das Leben ein Kampf ist.
Doch nach neuen Erkenntnissen des Geheimdienstes
haben wir uns selbst bekämpft.»
Aquarium: «Pojesd w Ogne» (Zug in Flammen), 1988
«Putin greift die Ukraine an»: Die Pushmeldung auf dem Handy reisst mich aus dem Schlaf. Nachrichten trudeln ein, von Bekannten in Kyjiw, meinen Eltern in Deutschland, von Freund:innen in Moskau. Ich starre ungläubig auf das Display. Dass es Ereignisse gibt, die die Welt in ein Vorher und ein Nachher teilen, ist eine ebenso banale wie wahre Erkenntnis. Ein solches Ereignis nimmt am frühen Morgen des 24. Februar seinen Anfang, als das russische Regime das Nachbarland überfällt.
Die Worte, die europäische Staatschef:innen anschliessend bemühen, könnten hochtrabender nicht sein. Von einer «Zeitenwende» ist die Rede, von «europäischen Werten», die die tapferen Ukrainer:innen unter Einsatz ihres Lebens verteidigten, «für uns alle und im Namen der Demokratie». Heute, neun Monate später, sind die grossen Worte verklungen. Energiekrise und Inflation machen den Europäer:innen zu schaffen, lenken ihre Aufmerksamkeit wieder nach innen.
Derweil lässt das russische Regime weiter ukrainische Städte, Stromleitungen und Heizwerke, Wohnhäuser und Spielplätze beschiessen, mehrmals täglich dröhnt in den Metropolen des Landes der Luftalarm. Während die Menschen dort ums Überleben kämpfen, wird auch in meinem politisch aktiven Umfeld immer weniger vom Krieg geredet. Viele scheinen sich in der Illusion eingerichtet zu haben, dass ein «Weiter so» noch immer möglich ist, dass die Welt, in der sie gross geworden sind, weiterhin existiert, auch viele Linke. Doch es gibt auch einen Raum dazwischen – einen, den Millionen Menschen bewohnen. Ich zähle mich auch dazu.
Zu den Bildern
Die Fotoarbeit in diesem Heft stammt von Lisa Bukreyeva, die in und um ihre Heimatstadt Kyjiw Spuren des Krieges dokumentiert.
www.bukreyeva.com
1. Das Exil als Zwischenraum
Meine Kindheit habe ich in einem Imperium im Niedergang verbracht, geboren in Moskau, nur wenige Jahre bevor die Sowjetunion Geschichte sein sollte. Besonders viele Erinnerungen habe ich nicht an diese Zeit, nur manchmal leuchten Episoden auf, von denen ich nicht mehr weiss, ob ich sie selbst durchlebte oder sie mir erzählt wurden. In solchen Momenten sehe ich die Schlange bei der Eröffnung der ersten russischen McDonald’s-Filiale, höre die Schüsse im Hof vor unserem Haus, Mafiakämpfe, die Anfang der Neunziger zum Alltag der Hauptstadt gehörten, denke an den Austauschschüler aus den USA, der sich – nachdem er einmal die leeren Supermarktregale gesehen hatte – nicht mehr traute, bei uns zu essen.
1992, im tiefen Winter, stiegen meine Eltern, mein Bruder und ich in den Zug, auf der Suche nach Perspektiven, auf der Flucht vor dem Antisemitismus, um einige Tage später im Asylheim einer süddeutschen Kleinstadt anzukommen. «Kontingentflüchtlinge» wurden wir in Deutschland genannt, über 200 000 Menschen mit jüdischen Vorfahren kamen in diesen Jahren aus den Überresten der Sowjetunion.
Dreissig Jahre sind seither vergangen, Jahre, in denen ich versucht habe, mit meinen Identitäten zu jonglieren, Flüchtlingskind und «Fremde», Russin, Deutsche oder Jüdin, Anpassung und Selbstermächtigung – bis der Angriff auf die Ukraine mich über Nacht zur Russin machte, Scham darüber in mir aufkommen liess, dass es «mein» Land ist, das diesen sinnlosen, verbrecherischen Krieg vom Zaun bricht. Einen Krieg, den auch ich nicht für möglich gehalten hatte, weil ein solcher Abgrund schlicht die Vorstellungskraft übersteigt.
Summiert man die Zahlen aus der Statistik, leben zurzeit knapp 100 000 Menschen aus Russland, der Ukraine und Belarus in der Schweiz, der weitaus grösste Teil von ihnen ist vor Putins Bomben geflohen. Viele scannen minütlich die Nachrichtenfeeds, schreiben dem Sohn an der Front, der Grossmutter, die, zu alt zum Fliehen, unter Dauerbeschuss ausharrt, dem Bruder, der Putins Mobilisierung zu entgehen versucht. Ähnliches erleben auch in anderen Ländern Europas all jene, die sich einem Raum zugehörig fühlen, der gemeinhin «postsowjetisch» genannt wird, so untauglich der Begriff auch ist, weil er alle Unterschiede verwischt.
Diese Stimmen sind nur selten in der Öffentlichkeit zu hören. Stattdessen überall Expertinnen und Politiker, von denen nur wenige den Raum auch wirklich kennen. Je länger der Krieg dauert, desto weniger ertrage ich ihre Arroganz. Auch weil sie nicht auf jene gehört haben, die seit Jahren vor der Gefährlichkeit des russischen Regimes warnen.


Leute wie Anna Politkowskaja. Nur wenige haben das Regime so präzise vermessen wie die Moskauer Reporterin, kaum jemand hat so sorgfältig die Kriege in Tschetschenien dokumentiert, die erst Präsident Boris Jelzin und dann sein Nachfolger Wladimir Putin führten – und die in ihrer grausamen Kriegstaktik die russischen Verbrechen in der Ukraine vorwegnahmen.
In einem ihrer Bücher beschrieb Politkowskaja Russland als «Sowjetunion nach neuer Façon, ein bisschen angetüncht, ein bisschen modernisiert, aber eben Sowjetunion. Mit einem bürokratischen Kapitalismus, in dem die Diener der Staatsmacht die obersten Oligarchen sind, unvergleichlich mächtiger und reicher als Privateigentümer und Kapitalisten.» 2006, am Tag von Putins 54. Geburtstag, wurde Politkowskaja vor ihrer Haustür erschossen.
Ihre Texte muten aus heutiger Sicht prophetisch an – oder vielleicht war damals einfach schon alles klar ersichtlich. Dass ihr niemand zuhörte, liess sie verzweifeln, stets geisselte sie das Wegschauen, die Doppelmoral. «Europa gewährt uns das Recht, unter Putin allein vor uns hin zu sterben», befand sie.
Dieser Text ist ein Versuch, anderen Stimmen zuzuhören: Ukrainerinnen, die die grausamen Folgen imperialen Wahns am eigenen Leib erfahren, Russen, die das Regime seit Jahren bekämpfen, dafür inhaftiert und gefoltert wurden, Belarus:innen, die den Aufstand gegen die Diktatur wagen. So unterschiedlich die Positionen sind, eines eint sie: ihr Blick aus der Distanz, ihre Rolle als Brücke zwischen zwei Welten. Das Exil, in dem sie sich aufhalten.
In Riga traf ich Journalist:innen, die gegen die russische Propagandamaschinerie ankämpfen. In Berlin sprach ich mit einem Aktivisten, der an der westlichen Heuchelei verzweifelt, hörte einem Theatermacher zu, der seine Kräfte sammelt, um der Ukraine mit seiner Kunst eine Stimme zu geben. In Zürich begegnete ich einer Netzpartisanin, die von New York aus den belarusischen Widerstand organisiert, in Genf einem Gewerkschafter, der sich auf die eigenen Fehler einen Reim zu machen versucht. Ich telefonierte mit einer Bloggerin, die die Verwerfungen in Belarus sichtbar machen will, mit einer Ikone der russischen Zivilgesellschaft, deren Engagement bis weit in die Sowjetzeit zurückreicht, mit einer Menschenrechtlerin, in deren Leben der Krieg schon 2014 trat, und mit einer Historikerin, die sich um die ukrainische Zukunft sorgt.
Das Exil hatte in der russischen Geschichte schon immer eine grosse Bedeutung – ob nach der Oktoberrevolution, als auf Lenins persönliches Geheiss die Intelligenzija auf dem «Philosophenschiff» deportiert wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg oder in den siebziger Jahren, ob nach dem Ende der Sowjetunion oder seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Auch die Menschen in Belarus und der Ukraine teilen eine Historie von Deportation und Vertreibung.
Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel beschreibt das Berlin der zwanziger Jahre als Zentrum des Exils. Er nennt die Stadt einen «dritten Ort», an dem Menschen Gespräche fortführen konnten, die in der Sowjetunion längst nicht mehr möglich waren. Auch heute ist die deutsche Hauptstadt Zuflucht für ukrainische Geflüchtete wie die russische Intelligenzija, doch auch die baltischen Staaten fungieren längst als Exilorte, oder Warschau, von wo aus die belarusische Opposition am Sturz des Regimes arbeitet, ebenso Städte wie Tiflis, Istanbul oder Jerewan. Daneben ist auch das Internet ein Ort der Zusammenkunft: für den Austausch mit anderen Geflüchteten oder mit jenen, die geblieben sind.

Der westliche Blick auf Osteuropa bleibt derweil diffus. Um ihn zu beschreiben, kann ein kürzlich erschienenes Buch helfen. Unter dem Titel «Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg» besichtigen vier Autor:innen aus Deutschland und der Schweiz eine Epoche, die mit Russlands Angriff auf sein Nachbarland womöglich ihr Ende findet. Der westliche Teil Europas habe sich als «Sieger der Systemauseinandersetzung» gefühlt, heisst es in dem Band. Berater:innen seien ausgeschwärmt, um «die ‹nachholende Modernisierung› und Zivilisierung des Ostens voranzutreiben». Die Verwerfungen aber habe kaum einer der Zugereisten verstanden. Erkannt habe der Westen im Osten vor allem billige Produktionsstätten und Exportmärkte. «Verlustängste und Gefühle der Bedrohung, die jene empfanden, die in einem von allen äusseren Einflüssen abgeschirmten sowjetisch dominierten Riesenreich gelebt hatten, waren im Westen niemandem vermittelbar.»
Fragt man Ulrich Schmid, Mitherausgeber des Buches und profunder Russlandkenner, welche westlichen Zuschreibungen das Bild vom Osten prägen, beginnt er mit einer Abgrenzung: «Kein Land will Osteuropa sein, da es immer den Beigeschmack des rückständigen, armen Verwandten des Westeuropäers hat. Osteuropa ist demnach dort, wo alles etwas schmutzig und chaotisch ist.» Seit dem 24. Februar habe sich mit Russland allerdings ein «neues Osteuropa» gebildet – aus westlicher Sicht «das komplett Andere» –, das einen Territorialkrieg führe, «der eigentlich schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Anachronismus gewesen wäre».
Doch Schmid ist auch überzeugt, dass der neue «Eiserne Vorhang», der das europäische Europa und das neosowjetische Russland trennt, keinen Bestand haben wird. «Der Westen ist in den Köpfen des Ostens schon längst angekommen, die Situation nicht mit jener in der Sowjetunion vergleichbar, als das Regime Kapital daraus schlagen konnte, dass die Menschen nicht reisen konnten und kein Internet hatten», sagt er. Unter den medialen Bedingungen des 21. Jahrhunderts lasse sich die komplette Isolation Russlands nicht aufrechterhalten.
2. Der Krieg als Zäsur
Als Erstes will ich wissen, was der Krieg mit den Ukrainer:innen gemacht hat, in Kyjiw wie im Donbas. Draussen vor dem «Berliner Ensemble» wartet an diesem sonnigen Dienstagnachmittag Anfang Oktober eine Heerschar schwarz gekleideter Depeche-Mode-Fans auf ihre Idole, die eben ein neues Album inklusive Tour angekündigt haben. In der Cafeteria jener Bühne, die Bertolt Brecht nach seiner Rückkehr aus dem Schweizer Exil 1949 in der deutschen Hauptstadt gründete, berichtet derweil Pavlo Arie davon, wie es sich anfühlte, eines Morgens im Krieg aufzuwachen.

Arie, schwarzes Cap, schwarzer Hoodie mit gelber «Fuck off»-Aufschrift, ist im westukrainischen Lwiw aufgewachsen. Seine Theaterstücke, Kunstinstallationen und Texte hatten ihn in die Welt hinausgebracht, bevor er nach Kyjiw zog und im Left Bank Theatre als Chefdramaturg anfing. Nun lebt er in Berlin, in einem «ewigen Warteraum», wie er es nennt.
Am Morgen des 24. Februar wacht Arie vom Geräusch der Explosionen auf. Kurz darauf ist seine Mutter am Telefon, die ihn bittet, zu ihr nach Lwiw oder – besser noch – direkt nach Deutschland zu fahren. «Ich wollte das alles nicht wahrhaben, dachte, ich schlafe noch eine halbe Stunde, und wenn ich aufwache, ist vielleicht alles vorbei.» Arie sucht nach Zugverbindungen in den Westen. Als er die Nachrichten anmacht, sieht er die Bilder vom überfüllten Bahnhof, die damals weltweit die Runde machten. «Ich entschied mich zu bleiben, weil ich den fliehenden Frauen und Kindern nicht den Platz im Zug wegnehmen wollte.»
Um nicht durchzudrehen, denkt sich Arie Rituale aus. Schon am zweiten Kriegstag geht er in sein Theater, um dort nach dem Rechten zu sehen. Beim Eingang sei er von der Feuerwehr, die das Gebäude bewachte, nach dem Ausweis gefragt worden, erzählt der Dramaturg lachend. «Ich sagte ihnen, dass wir gar keine eigenen Ausweise hätten, sie aber mein Gesicht mit dem grossen Bild an der Wand vergleichen könnten. Dann haben wir laut gelacht.»
Ins Theater zu gehen, beruhigt Arie, stiftet Sinn in all dem Wahnsinn. Von da an ist der 47-Jährige jeden Tag dort, postet auf Facebook regelmässig Fotos vom Haus – für die geflohenen Mitarbeiter:innen wird er zur Brücke in eine frühere Normalität. Hier das Theater, in dem die Zeit wie eingefroren scheint, dort die Aussenwelt, in der sich alles verändert hat, die Ampeln nicht mehr funktionieren, sich in den Strassen der Müll auftürmt, leere Supermärkte, Panzer und Barrikaden. Dieser Gegensatz sei für ihn schlimm gewesen. In den ersten Tagen rückt der Krieg sehr nahe an die Hauptstadt heran, nicht nur Explosionen sind zu hören, auch die Kämpfe.
Neben seinen täglichen Ausflügen ins Theater führt Arie Tagebuch, hält den Horror fest, aber auch die kleinen Freuden, wenn etwa die Ampeln plötzlich wieder funktionieren, sucht Ruhe und Sicherheit im geschriebenen Wort, findet auch Hoffnung. «Vielleicht hat mich das gerettet», sagt er rückblickend. Später wird Aries «Tagebuch des Überlebens» in Theatern von Berlin und Tiflis über Mailand bis nach Los Angeles inszeniert.
Manchmal liegen Schrecken und Schönheit nah beieinander, auch im Krieg. Zu den guten Momenten zählt Arie die Selbstorganisation der Hauptstädter:innen, in einem Moment, in dem der Staat nicht mehr in der Lage ist, Grundbedürfnisse zu decken. In den ersten Kriegstagen versucht er, Medikamente zu besorgen, doch vor der einzigen offenen Apotheke warten zu viele Menschen, als dass alle bis zur Sperrstunde drankommen würden. Die Stimmung in der Schlange sei offen feindselig gewesen; wer weiter vorne war, wurde beschimpft. «Ich dachte, wir hätten es verdient, von einer Rakete getroffen zu werden, so schlecht haben wir uns gegenseitig behandelt», sagt Arie.
Dann passiert etwas, das der Theatermacher bis heute unglaublich findet. Zwei Angestellte der Apotheke seien zu den Wartenden herausgekommen und hätten versprochen, dass niemand mit leeren Händen nach Hause gehen müsse. «Das hat alles verändert: Eine Minute zuvor waren wir noch die schlimmsten Menschen im Universum, nun begannen wir, uns zu organisieren.» Sie schreiben die jeweils benötigten Präparate auf eine Liste und reichen sie den Apotheker:innen. Kurz vor der Ausgangssperre erhält auch Arie seine Medikamente.
Drei Wochen nach Kriegsbeginn, zur eigenen Sicherheit, verlässt Arie die Stadt. Eindrücklich beschreibt er die Fahrt nach Lwiw. Sobald der Zug Kyjiw verlassen habe, seien die Lichter ausgegangen. «Du fährst in voller Dunkelheit durchs Land, niemand spricht, alle sind total ruhig, auch die Kinder, viele schluchzen ganz still vor sich hin, trauern um ihr einstiges Leben. Ich habe verstanden, dass es nie wieder so sein wird wie früher, wir alle verändern uns – und nicht zum Besseren.» Von Lwiw aus fährt Arie mit seiner Familie weiter nach Köln, dann nach Berlin.
Und wie ergeht es ihm in der deutschen Hauptstadt, in seinem Leben im Provisorium? Während er erzählt, bricht Arie immer wieder ab, sein Tee ist längst kalt geworden. Bis spät in die Nacht habe er am Vorabend die Nachrichten geschaut, entschuldigt er sich. Ihn plagt das schlechte Gewissen, weil er sich dagegen entschieden hat, eine Waffe in die Hand zu nehmen, weil er glaubt, Leute im Stich gelassen zu haben, weil er Ohnmacht verspürt, den Kriegsverlauf nicht beeinflussen zu können. In Berlin macht Arie weiter Theater, eine Reihe über das Exil, bald ein Stück über geflüchtete Ukrainerinnen. «Meine Kunst handelt jetzt ausschliesslich vom Krieg, und vielleicht ist das meine Waffe, die Entschuldigung dafür, nicht Soldat geworden zu sein.»
Marina Asejewa hat ihr ganzes Leben im Donbas verbracht, sie ging in der Oblast Donezk zur Schule, hat dort studiert und gearbeitet. «Ich wollte nie weg», erzählt sie, als wir Mitte Oktober telefonieren. Die Mutter ist Russin, der Vater Ukrainer, «eine typisch sowjetische Familie», zu Hause sei das nie Thema gewesen. Vielschichtige Identitäten, wie sie gerade im Osten der Ukraine alltäglich sind.
Asejewa ist in ihren Fünfzigern und heisst eigentlich anders. Weil es ihre Arbeit als Menschenrechtlerin im Donbas gefährden würde, möchte sie nicht, dass ihr richtiger Name, ihr exakter Wohnort oder sonstige Details hier stehen. Nur so viel: 2010 ging sie in die Politik, war in einer kleineren Stadt für humanitäre Fragen und Bildung, das Renten- und Gesundheitswesen zuständig – bis ihr Leben 2014 zum ersten Mal auf den Kopf gestellt wurde. In ihrer Biografie spiegelt sich die neuere ukrainische Geschichte. Zurzeit weilt sie in Berlin, pendelt zwischen dem Donbas und der deutschen Hauptstadt.
Für Leute wie Asejewa trat der Krieg nicht erst am 24. Februar, sondern schon vor acht Jahren in ihr Leben. Seither sind in der Ostukraine mehr als 13 000 Menschen getötet, unzählige Existenzen zerstört worden. Am Anfang jener Entwicklung steht eine verhängnisvolle Absage.
Im November 2013 findet im litauischen Vilnius ein EU-Gipfel statt, bei dem ein «Assoziierungsabkommen» mit der Ukraine unterzeichnet werden soll. Den Inhalt des Vertrags beschreibt die ukrainische Ökonomin Julia Jurtschenko in ihrem Buch über die Verwerfungen im Land so: «Es wurde verkauft, als brächte es der Ukraine beträchtliche wirtschaftliche und soziale Vorteile, als würde es die Löhne und den Lebensstandard erhöhen und Rechtsstaatlichkeit garantieren. Tatsächlich ging es um die einseitige Liberalisierung des Handels mit der EU. Das Abkommen würde die letzten Gemeingüter der Privatisierung und Kommerzialisierung preisgeben und dem ausländischen Kapital eine vorteilhafte Position verschaffen – was die Ungleichheit bloss weiter verschlimmert und die Reste des staatlichen Sozialhilfesystems zerstört.»
Eigentlich ist der Deal beschlossene Sache, doch wenige Tage vor dem Gipfel stoppt die ukrainische Seite die Vorbereitungen für die Unterzeichnung. Wie später bekannt wird, ist der Entscheid auf Druck aus Moskau zurückzuführen. So lässt der Kreml Kyjiw spüren, was eine engere Anbindung an die EU bedeuten würde, indem er die Importe aus der Ukraine vorübergehend stoppt. Später droht er mit der Einführung eines Visaregimes, falls die Ukraine nicht einer Zollunion mit Russland beitrete. Gleichzeitig gewähren russische Banken Kredite, der staatliche Energiekonzern Gazprom stellt einen Rabatt in Aussicht.
Nachdem Präsident Wiktor Janukowitsch der EU eine Absage erteilt, beginnen Proteste, aus denen sich der nach dem zentralen Platz in Kyjiw benannte Euromaidan-Aufstand entwickelt. Wie die Ökonomin Jurtschenko schreibt, sei der Entscheid Janukowitschs zwar der Auslöser gewesen, doch verfestigt habe sich der Widerstand erst mit der brutalen Reaktion des Sicherheitsapparats.
Ende November räumt die Sondereinheit Berkut den Unabhängigkeitsplatz in Kyjiw mit Gewalt, einen Tag später kommen Hunderttausende zurück, auch in vielen anderen Städten gehen die Menschen wütend auf die Strasse. Bei den Protesten geht es nicht länger um die EU, sie richten sich gegen den Präsidenten und die grassierende Korruption.
Es finden auch «Anti-Maidans» statt, Gegenkundgebungen zu Janukowitschs Gunsten, die aber deutlich kleiner ausfallen und überwiegend in der Süd- und der Ostukraine stattfinden, die sich ökonomisch stärker nach Russland orientieren. Der Schweizer Historiker Andreas Kappeler, einer der besten Kenner der Verhältnisse zwischen Russland und seinem Nachbarland, beschreibt in seinem Buch über die ukrainische Geschichte, wie sich die Überwindung der Gegensätze zwischen Ost und West, Nord und Süd seit der Jahrtausendwende abgezeichnet hatte, bis der Euromaidan erneut Gräben aufriss. «Sie wurden in der Folge von Russland instrumentalisiert, um die Ukraine zu destabilisieren.»
Auch die Politikerin und Menschenrechtlerin Marina Asejewa beobachtet eine gespaltene Gesellschaft. «Statt die Gemeinsamkeiten zu betonen, wurde viel von Unterschieden zwischen Ost und West gesprochen.» In der von Industrie und konkurrierenden Oligarchen geprägten Ostukraine, in der die Wirtschaft nach Russland ausgerichtet ist, sei die Sorge gross gewesen, eine Annäherung an die EU würde zu hoher Arbeitslosigkeit führen. «Es war ein Fehler, dass die ukrainische Regierung zu wenig den Dialog mit den Menschen im Osten gesucht hat», sagt sie rückblickend.
Nach monatelangen Protesten, einer Zeltstadt auf dem Maidan und nach über hundert Toten setzt das Parlament Janukowitsch im Februar 2014 ab. Ende März unterzeichnet die Übergangsregierung das Abkommen mit der EU. Kurz zuvor nutzt der Kreml die Gunst der Stunde und annektiert die Krimhalbinsel, im Osten des Landes eskaliert die Situation. «Russland führte keinen offenen Krieg, sondern unterstützte separatistische Gruppen im Donbas mit Kriegsgerät aller Art, schleuste Spezialtruppen samt Offizieren des Auslandsgeheimdiensts sowie ganze Bataillone von Söldnern ein und liess über die staatlich kontrollierten Medien mit einer Propagandaflut Desinformationen über die Kyjiwer Regierung verbreiten», schreibt Kappeler.
Im April rufen die Separatistenführer die beiden «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk aus und inszenieren Referenden. Im Herbst wird Asejewa von der neuen Führung ihres Amtes enthoben. Der Kriegsbeginn 2014 sei für die Bevölkerung – und für sie selbst – ein «riesiger Schock» gewesen, sagt sie. Die Regierung in Kyjiw habe von einer «Antiterroroperation» gesprochen, «aber wir nannten es schon damals Krieg». Geschätzte 2,5 Millionen Menschen flüchten in den folgenden Jahren aus dem Donbas. Marina Asejewa ist eine von denen, die bleiben. «Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, doch aus persönlichen Gründen konnte ich nicht weg.»
Irgendwann habe sie sich arrangiert. «Das Leben geht ja irgendwie weiter.» Asejewa kämpft fortan dafür, dass die Bevölkerung der «Volksrepubliken» nicht isoliert wird. «Ich habe den ukrainischen Behörden acht Jahre lang gesagt: Das sind eure Leute, macht es ihnen nicht so schwer.» Schwer sind für die Menschen in den besetzten Gebieten bereits alltägliche Erledigungen, wie einen ukrainischen Pass zu beantragen.
«Ich habe versucht, der mächtigen ideologischen Maschinerie von beiden Seiten durch persönliche Kontakte zu widerstehen», sagt Asejewa. Sie kümmert sich um Maturand:innen, die in Kyjiw studieren wollen, berät Lehrer:innen und Eltern, arbeitet mit ukrainischen Menschenrechtler:innen zusammen. Sie organisiert einen Austausch zwischen Kunstschulen, damit Kinder in andere Regionen reisen können, um traditionelle Maltechniken zu erlernen. «Es war doch schon immer so, dass Ost und West voneinander gelernt haben – das wollten wir bewahren.»
Ein Problem sei gewesen, dass man nie genau gewusst habe, ob es das Land, in dem man lebt, inskünftig überhaupt noch gibt. Wie führt man da ein Geschäft, was passiert mit Diplomen, die womöglich bald nicht mehr anerkannt werden? «Wir haben stets darauf gewartet, dass es vorbeigeht», erinnert sich Asejewa. Und dann kam der 24. Februar – und ihre Welt brach ein zweites Mal zusammen. «Ich hatte bis zum letzten Moment geglaubt, dass es nicht sein kann, dass die Soldaten eines fremden Landes in Charkiw stehen und die gleiche Sprache sprechen wie die Bewohner:innen. Irgendetwas in mir hat gespürt, dass es so weit kommen könnte, aber der Kopf wollte es nicht wahrhaben. Noch immer ist es surreal, erscheint wie ein Albtraum, aus dem ich bald aufzuwachen hoffe.»
Anfang Oktober war Asejewa zum letzten Mal im Donbas, auf dem Weg zurück wurde sie mehrere Stunden lang verhört. Sie erzählt von starkem Beschuss, aber auch davon, wie das Leben auch jetzt irgendwie weitergeht, von Menschen, die Geflüchtete aus Mariupol bei sich aufnehmen und Hilfsgüter dorthin bringen, von Hilfsbereitschaft, Solidarität und Pragmatismus und von jenen, denen nichts anderes übrig bleibt, als in die zerstörte Stadt zurückzukehren. Aber sie sagt auch: «Nach acht Jahren Krieg sind viele müde, sehnen den Frieden herbei und wollen nicht bis zum letzten Mann kämpfen. Wenn der Krieg noch Jahre dauert, wird es keine Sieger geben, bloss Überlebende in Trümmern und auf Gräbern.»
3. Imperialer Wahn
Fragt man Irina Scherbakowa nach der Vorgeschichte von Russlands Krieg gegen die Ukraine, geht sie weiter zurück als bis ins Jahr 2014. Angefangen habe alles zehn Jahre früher, mit dem ersten «Maidan», der auch Orange Revolution genannt wird, weil die Protestierenden orangefarbene Fahnen und Schals trugen. Damals sei es den «putinschen Technologen», wie die 73-Jährige die Vertreter des Regimes im Nachbarland nennt, nicht gelungen, die Wahl des westwärts orientierten Wiktor Juschtschenko zum Präsidenten zu verhindern. «Damit hat Putin die erste Niederlage in der Ukraine erlitten», befindet die Historikerin an einem grauen Herbstmorgen im Videocall.
2010 wird Wiktor Janukowitsch, der 2004 unterlegen war, doch noch zum Präsidenten gewählt – und Putin bekommt seine Marionettenregierung in Kyjiw. Dass sich der Kreml jahrelang in ukrainische Belange einmischt, ist nicht überraschend. Wie der russische Machthaber das Land sieht, hat er etwa im Sommer 2021 ausführlich dargelegt: In einem Essay mit dem Titel «Zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern» beschreibt er die Ukraine als «künstlichen Staat», der keine Existenzberechtigung ausserhalb der russischen Hegemonie haben dürfe – und schafft damit den ideologischen Überbau zum Krieg. Dass der Kreml die Ukraine als Satelliten betrachte, sagt auch Scherbakowa. «Er will ein russisch-sowjetisches Imperium wiederherstellen und dafür in die Geschichte eingehen.» Eine «schreckliche, wahnwitzige Idee», nennt sie das.
Scherbakowa hat die 22 Jahre, in denen Putin an der Macht ist, genau verfolgt – sie ist so etwas wie die Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung. In den späten achtziger Jahren gründete sie mit einigen anderen Aufrechten die Organisation Memorial, die seither die stalinistischen Verbrechen aufarbeitet. Memorial lässt sich ohne Übertreibung als Russlands historisches Gewissen bezeichnen. Umso verächtlicher reagiert sie, als ich Putin am Telefon scherzhaft als Hobbyhistoriker bezeichne.
«Es ist unser aller Unglück, dass ihn die Geschichte wirklich interessiert und alles andere eher langweilt», schnaubt Scherbakowa. Stalin habe sich für Literatur interessiert, später sogar für die Sprache. «Allerhand komische Dinge, die bei Diktatoren vorkommen!» Putins Ideologie sei eine giftige Mischung aus Narrativen, die er irgendwo aufgelesen habe: Vorstellungen von Staatenbildung aus dem 19. Jahrhundert, slawophile Ideen aus der gleichen Zeit, antiwestliche Stimmungen und Xenophobie, eurasische faschistoide Gedanken und Verschwörungsmythen. Fasse man das zusammen, so Scherbakowa, gehe es am Ende immer um einen starken, autoritären Staat.
Putins imperialer Wahn hat schliesslich auch sie aus dem Land vertrieben. Nicht aus Angst vor einer Verhaftung, denn Einschüchterungen und Repressionen gegen sie und ihre Organisation sind für Scherbakowa, die auch schon im Staatsfernsehen diffamiert wurde, seit Jahren Alltag. Zudem hätten sich andere in weit grösserer Gefahr befunden. «Was ich nicht ertragen konnte, war das Schweigen», sagt sie. Bei Memorial zuständig für Bildung und Aufklärung sowie für den Dialog mit der Öffentlichkeit, begriff Scherbakowa rasch, dass ihre Arbeit in einem Land, in dem der Krieg nicht einmal Krieg genannt werden darf, in dem Zensur inzwischen allgegenwärtig ist, nicht mehr möglich sein würde. Ende Dezember 2021, als letzter Akt vor dem Krieg, hatte das Oberste Gericht die Liquidierung von Memorial beschlossen.
Der andere Grund für die Emigration sei das Gefühl gewesen, dass viele Menschen selbst im kosmopolitischen Moskau nicht dezidiert gegen den Krieg seien oder zumindest wegschauen würden. «Ich fühlte Zorn und Hass, aber auch absolute Ohnmacht, weil in meinem Namen jetzt auch noch ein Krieg geführt wird», erklärt sie. Am 7. März, anderthalb Wochen nach den ersten Angriffen, verlässt Scherbakowa das Land in Richtung Deutschland.
4. Ukrainische Alternativen
Anders als die russische Propaganda und ihre rechten (und linken) Apologet:innen im Westen behaupten, führt Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht, weil es sich von der Nato bedroht, vom Westen gedemütigt sieht. Im Gegenteil: Viele Expert:innen sagen, der Kreml habe die Schwäche der Nato genutzt, um anzugreifen, erst recht nach deren überstürztem Abzug aus Afghanistan. Hinzu kommt aber noch ein anderer Umstand: dass der Kreml in den letzten Jahrzehnten gesehen hat, dass er sich alles erlauben kann – nicht zuletzt, weil seine früheren Verbrechen ohne Konsequenzen blieben.
Ob die Ermordung, die Vergiftung oder die Inhaftierung Andersdenkender, die Bomben gegen die tschetschenische und syrische Bevölkerung oder die Annexion der Krim und der Krieg im Donbas – den Wirtschaftsbeziehungen mit den Ländern des Westens tat das keinen Abbruch, dankbar nahmen sie Russland auch weiterhin Öl, Gas und Kohle ab. Es ist diese zynische Aussen- und Wirtschaftspolitik, die viele meiner Gesprächspartner:innen so wütend macht.
Kenner:innen der Moskauer Verhältnisse führen als Kriegsursache einen weiteren Faktor ins Feld: Wladimir Putins Angst vor einem Aufstand im eigenen Land, einem russischen Maidan. Auch deshalb darf die Ukraine aus seiner Sicht kein souveräner Staat sein, kein Gegenmodell zum Polizeistaat, den der Kreml in den letzten Jahren aufgebaut hat. Aber wie hat sich die Ukraine in den Jahrzehnten seit ihrer Unabhängigkeit herausgebildet? Ich frage Historikerin Irina Scherbakowa, was die beiden Länder unterscheide.
Natürlich sei das sowjetische Erbe auch in der Ukraine stark gewesen, gerade im Osten seien die Jahre des stalinistischen Terrors, die Anpassung und die Korruption nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen, sagt sie. Und doch habe das Land einen selbstständigen Weg eingeschlagen.
«Im Gegensatz zu Russland war die Ukraine nie ein Imperium mit Kolonien. Im Gegensatz zu Ländern wie Georgien hatte sie auch nie autonome Republiken, die ihr zum Verhängnis werden konnten», erklärt Scherbakowa. Zudem habe ein Teil des Landes lange Jahre westliche Traditionen gelebt: Die Westukraine sei erst 1939 von der Sowjetunion annektiert worden und damit eine Generation später als der Osten. Und auch die heutige junge Generation, die die Ukraine seit dem Maidan präge, habe sich stark international ausgerichtet. Scherbakowa hat seit zwanzig Jahren ein Ferienhaus in der Ukraine, in das sie jeden Sommer reist. «Sie haben keine Vorstellung davon, wie sich das Land in dieser Zeit modernisiert hat, wie motiviert die jungen Menschen sind!»
Olha Martynyuk nahm Anfang März an einem Podium teil, das die WOZ veranstaltete: Auf der Bühne des Zürcher Kulturlokals Kosmos versuchte sie, die Kriegswirklichkeit zu beschreiben. Die Historikerin kommt aus einer politischen Familie, ihre Vorfahren haben als ukrainische Partisanen gekämpft. Martynyuk ist in Lwiw bei ihrer Mutter aufgewachsen, nach der Schule zog sie in die ukrainische Hauptstadt, wo auch ihr Vater lebt, später dissertierte sie über den russischen Nationalismus in der Ukraine des frühen 20. Jahrhunderts, unterrichtete an der Nationalen Technischen Universität in Kyjiw Bachelorstudent:innen. Von ihr möchte ich wissen, wie sich die ukrainische Identität über die Jahre verändert hat.

Olha Martynyuk, Historikerin Foto: Anna Schmidt
«1991, als die Ukraine unabhängig wurde, war ich noch ein Kind, doch schon damals nahm mich meine Mutter zu Versammlungen mit», erzählt die 36-Jährige. 2004, da war Martynyuk achtzehn, gehörte sie zu den ersten Demonstrant:innen auf dem Maidan. «Der aktivistische Geist, die Fähigkeit, sich für das öffentliche Interesse und nicht bloss das eigene Wohl zu engagieren, ist noch immer Teil der ukrainischen Identität», sagt sie.
Der Krieg in der Ostukraine habe Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen gemacht – und die soziale Landschaft verändert. Historisch gesehen sei die Ukraine immer von sehr unterschiedlichen Einflüssen geprägt gewesen, die Kultur habe sich im Dialog mit anderen entwickelt. «Die Westukraine ähnelte stärker Westeuropa, war geprägt von einem kapitalistischen Geist, von kleinen und mittleren Unternehmen, Religion spielte dort immer eine grössere Rolle, während im Osten das Privateigentum nach der Machtübernahme der Bolschewiki abgeschafft wurde.» Hinzu komme, dass die Menschen im Westen das Wahlrecht schon viel länger gekannt hätten und es deshalb stärker gewohnt gewesen seien, sich politisch einzubringen. «Die lange Geschichte demokratischer Kämpfe hat einen Einfluss auf die Politik des Landes», folgert die Historikerin. Sie verweist aber auch auf grosse Arbeiter:innenproteste im Donbas in den achtziger Jahre, die für die sozialpolitische Entwicklung wegweisend gewesen seien.
Auch in Russland habe es zwar immer wieder grosse Protestwellen gegeben, doch hätten diese Stimmen nie eine kritische Masse erreichen können. Und im Gegensatz zur Ukraine sei das Protestieren in Russland und Belarus auch mit hohen persönlichen Risiken verbunden. Martynyuk sieht in Russland «ein Beispiel für ein Land, in dem die Elite mit den Erträgen aus den natürlichen Ressourcen Macht akkumulieren konnte, Kontrolle über die Medien erlangte und potenzielle Partner im Westen verdeckt unterstützte».
Martynyuk lebt seit Kriegsausbruch in Basel. Dass sie so schnell ausser Landes gelangte, ist einem Zufall zu verdanken. Eigentlich wollte sie am 23. Februar in die Schweiz fliegen, wo ihr Freund lebt, verpasste aber den Flug. Am nächsten Tag wachte auch sie vom Lärm der Explosionen auf – und stieg mit ihren bereits am Vortag gepackten Sachen in den Zug, der sie an die polnische Grenze brachte. Von dort aus reiste sie nach Basel. «Natürlich geht es mir viel besser als den meisten Ukrainer:innen, aber die mentale Belastung ist trotzdem enorm. Ich versuche ständig, nicht durchzudrehen und ein möglichst normales Leben zu führen», erzählt sie. Mindestens bis 2024 kann sie dank eines Stipendiums in der Schweiz bleiben.
Im Moment verbinde die Menschen in der Ukraine vor allem eins, sagt Martynyuk: «‹Putin, Hände weg von unserem Land›. Und dass wir kämpfen müssen.» Sie sei immer wieder über die Resilienz der Leute überrascht, ihren Widerstandsgeist, der sich auch im Versuch zeige, sich nicht unterkriegen zu lassen, ein möglichst normales Leben zu führen. «Die einen sind in der Armee, andere sammeln humanitäre Hilfe, alle haben ihren eigenen Weg, zu überleben. Doch der Spirit ist klar: die Dominanz dieses hässlichen Regimes nicht zuzulassen.»
5. Das Ende der Opposition
«Der Besitzer läuft lila an vor Wut,
doch er kann uns nicht vertreiben.
Auf unserer Flagge
prangen weisser Schnee und ein blauer Fluss.»
Oxxxymiron: «Oida», 2022
Kirill Buketow kommt gerade von einer Besprechung mit Mitgliedern der EU-Kommission. «Tut mir leid für die Verspätung, diese Kommissare haben versucht zu begreifen, wie es mit der Fischerei in Asien aussieht. Und das an so einem Tag. Wie kann man sich da auf Fische konzentrieren?» Buketow (53) ist Sekretär der Internationalen Gewerkschaft der Nahrungsmittelarbeiter:innen (IUF) in Genf. 2008 kam er in die Schweiz, weil ihm die Organisation einen Wechsel an den Hauptsitz vorschlug.

Wir treffen uns in Genf am Bahnhof, nur wenige Stunden nachdem über achtzig russische Raketen Städte in der gesamten Ukraine beschossen haben, darunter auch – zum ersten Mal in diesem Krieg – das Zentrum von Kyjiw. Der Terror ist nach Monaten relativer Ruhe zurück in der Hauptstadt.
Ich habe Buketow Anfang April kennengelernt, als ich auf einer Tagung der Schweizer Gewerkschaften über linke Irrtümer und Missverständnisse in Bezug auf Russland sprechen konnte, während er einen Vortrag über die russische Antikriegsbewegung hielt. Damals merkte man ihm den Schock über die Invasion noch gut an. «Wir haben es nicht verhindern können», sagte er immer wieder, ernst und traurig. Mit «wir» meinte er die Opposition in Moskau, von der er jahrzehntelang ein Teil war.
2014, als Putin die Krim annektierte und im Donbas der Krieg begann, hätten in Russland sehr viele protestiert, erinnert sich Buketow. «Verzeih, Ukraine!» stand damals auf ihren Plakaten. Das Regime – im Russischen wird das Wort «wlastj» verwendet, was sowohl Macht wie auch Herrschaft bedeutet – habe Leute foltern lassen und mit brutaler Polizeigewalt und Schauprozessen dafür zu sorgen versucht, den Widerstand gegen seinen kriegerischen Kurs zu brechen.
Im Februar 2015 erschossen Unbekannte in Sichtweite des Kreml aus einem fahrenden Auto heraus den Oppositionspolitiker Boris Nemzow, den prominentesten Kriegsgegner und Organisator mehrerer Protestmärsche. «Nemzow hat immer vor einem grossflächigen Krieg gewarnt. Für uns Antikriegsaktivisten war deshalb immer offensichtlich, dass auch er ein Opfer dieses Krieges ist», sagt Buketow.
Tatsächlich gab der Regimekritiker, in dem viele damals die einzige Alternative zu Putin sahen, nur wenige Stunden vor seiner Ermordung ein Interview. Darin forderte er den russischen Präsidenten auf, «den Krieg mit der Ukraine sofort einzustellen», und warnte vor einer «totalen Katastrophe». In den Monaten vor seinem Tod hatte Nemzow an einem Bericht gearbeitet, der posthum veröffentlicht wurde. Darin bewies er, dass Russland in den Krieg im Donbas verwickelt war, was der Kreml damals vehement bestritten hatte. «Ich weiss nicht, woher er gewusst hat, was uns noch droht, aber er hat es auf jeden Fall gewusst», sagt Buketow.
Der Gewerkschafter teilt die Zerstörung des Rechtsstaats in Etappen auf, eine davon betrifft die Justiz. «Als die Behörden gegen unabhängige Medien vorgingen und Journalisten verhafteten, haben das alle mitbekommen, aber die Säuberungen im Justizwesen hat kaum jemand bemerkt», konstatiert er. Ab 2015 habe man ohne viel Aufhebens die unabhängigen Richter durch regimetreue ersetzt, «danach fing die komplette Willkür an».
Einen Wendepunkt sieht Buketow im «Setj»-Fall (deutsch: Netzwerk), als junge Anarchisten und Antifaschisten der «Gründung einer terroristischen Vereinigung» bezichtigt und dafür teilweise für bis zu achtzehn Jahre inhaftiert wurden. «Vorher waren die Repressionen meistens gegen Einzelpersonen gerichtet, das war der erste Gruppenprozess. Offenbar hatte der Geheimdienst riesige Vollmachten bekommen: ‹Wenn ihr keine Extremisten findet, erfindet welche›, war die Weisung. Das haben sie dann gemacht.»
Dass Putin den Weg in die Diktatur nach der manipulierten Parlamentswahl im Jahr 2012 und den Protesten dagegen auf dem Moskauer Bolotnajaplatz endgültig einschlug, ist vielfach beschrieben worden. In der Folge entstand das System, das die Menschen in Russland heute unterdrückt: die Gesetze, die die queere Community entrechteten und unliebsame Personen und Gruppen zu «ausländischen Agenten» erklärten, die Festnahmen und Inhaftierungen, Angst und Willkür zur Folge hatten, die Menschen in die Emigration zwangen, die Arbeit von Menschenrechtlerinnen und Journalisten erschwerten und Organisationen wie Memorial gleich ganz verboten.
Zum ersten Mal seit Stalin sei in Russland wieder gefoltert worden, erzählte Memorial-Mitgründerin Irina Scherbakowa in unserem Videocall. In Strafkolonien, auf den Strassen und den Polizeiwachen. Alltag in Putins Russland. «Mich wundert leider überhaupt nicht, dass der Krieg in der Ukraine so brutal geführt wird – man hat diese Gewalt schliesslich im eigenen Land gegen sich selbst angewendet», sagte sie. Ja, es habe Proteste gegen die Verschärfungen gegeben, immer wieder. «Aber sie waren nicht stark genug, um etwas zu verändern.»
Die eigene Schwäche beschäftigt auch Kirill Buketow: «Waren wir vielleicht zu naiv, glaubten zu sehr an das Gute?» Von einem ist er heute überzeugt: dass die Zerstörung der Opposition ein Teil der Kriegsvorbereitung war. Und davon, dass viele Probleme aus der hartnäckigen Weigerung der «anständigen Leute» resultieren, sich aktiv an der Politik zu beteiligen und damit zivilgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. «Alle waren von der Politik als schmutzigem, unehrlichem Geschäft angeekelt.»
Doch je mehr Leute in die Politik gingen, desto mehr würden sie deren Funktionsweise verstehen, desto mehr entstünde ein Kontrollsystem, glaubt Buketow. «Wenn wir das nicht ändern, werden wir immer wieder das gleiche Problem haben: eine passive Mehrheit und eine Minderheit, die aggressiv die Macht an sich reisst, Führungsposten an irgendwelche Verrückte verteilt und einen Krieg anzettelt. Früher oder später wird Russland frei sein, davon bin ich überzeugt – die Frage ist, was dann passiert.»
Wie die meisten Menschen, mit denen ich für diesen Text spreche, lebt auch Buketow in einem Zwischenraum. Als er 2020 das letzte Mal in Russland war, hielten ihn die Behörden stundenlang am Flughafen fest – angeblich, weil er die Covid-Bestimmungen missachtet hatte. Da sei ihm klar geworden, dass er auf irgendeiner Liste des Regimes stehe, seither kann er nicht mehr einreisen. «Das Russland, das wir 2008 verlassen haben, gibt es ohnehin nicht mehr.»
6. Medien auf der Abschussliste
Ewgenij Feldman sitzt in einem Teehaus unweit des historischen Zentrums von Riga und klickt sich durch die Nachrichten auf seinem Handy. Ein Freund ist gerade auf der Flucht ins Ausland, um der Einberufung in die Armee zu entkommen, und Feldman verfolgt seine Reise aus der Ferne.
Der 31-Jährige ist in Russland einer der bekanntesten politischen Fotografen, jahrelang dokumentierte er, wie die Freiräume für die Opposition immer weiter schrumpften. Keine Demo, die er nicht mit seiner Kamera festgehalten hat. Hinzu kommen Arbeiten über den Kampf des Regimekritikers Alexei Nawalny, die Prozesse gegen Oppositionelle und die Proteste auf dem Maidan, die Besetzung der Krim und den Krieg im Donbas. «Es ist eine Spirale: Auf Twitter heisst es oft, dass niemand gegen den Krieg protestiert, weil wir keine Bilder von diesem Protest sehen – aber wir sehen darum keine Bilder, weil die Fotografen zu den ersten Zielen der Polizei gehören», sagt Feldman.

Ewgenij Feldman, Fotograf und Bildredaktor bei «Meduza» Foto: Alex Kulikov
Redet man mit ihm darüber, wie sich der Journalismus in den letzten Jahren verändert hat, realisiert man: Die Medien zum Schweigen zu bringen, heisst, den Widerstand zu brechen. «Vielleicht waren die Medien über die Jahre das Hauptziel des Regimes», sagt er nachdenklich. Feldman erzählt die Geschichte einer jungen Frau, deren Partner, ein politischer Aktivist, unschuldig im Gefängnis sass und die der Fotograf begleitete, während sie verzweifelte und den Mut doch nicht verlor. Solche Geschichten gibt es im heutigen Russland zuhauf. Er beklagt, dass sie die Öffentlichkeit kaum noch erreichen. Dass er selbst nicht mehr in der Lage ist, die Proteste zu dokumentieren, schmerzt ihn besonders.
Im März 2021 fängt Feldman an, von Moskau aus als Bildredaktor für das in Riga stationierte Exilmedium «Meduza» zu arbeiten. Die lettische Metropole ist in den letzten Jahren und vor allem Monaten zum Zentrum unabhängiger russischer Medien geworden. Ob TV Rain oder «Nowaja Gaseta Europe»: Von Riga aus versuchen Hunderte vom Regime ins Exil getriebene Journalist:innen, der übermächtigen russischen Propagandamaschinerie entgegenzuwirken.
Er habe schon während der Krimannexion über eine Ausreise nachgedacht, sagt Feldman, dann hätten sich die roten Linien immer weiter verschoben. «Zuerst meinte ich, dass ich ausreise, wenn sie das freie Internet ins Visier nehmen, doch dann taten sie das, und ich blieb, weil ich die Niederschlagung der Opposition so lange wie möglich fotografisch festhalten wollte.» Dann wurden die Gesetze über «ausländische Agenten» eingeführt, Kolleg:innen seien in den Fokus der Behörden geraten. «Mein Plan war: Wenn sie mich zum ‹ausländischen Agenten› erklären, verlasse ich das Land. Aber dazu kam es nie.»
Im September 2021 fängt der Kreml an, Nawalny und dessen Netzwerk als «extremistisch» zu verfolgen. Weil Feldman den Politiker monatelang fotografisch begleitet hat, geht er davon aus, dass auch er ins Visier gerät. Von da an bereitet er sich auf die Flucht vor – und als immer mehr Leute aus Nawalnys Umfeld verhaftet werden, flieht er im Januar über die Türkei nach Riga. Heute sieht er seine Aufgabe darin, den Krieg zu dokumentieren. Täglich erstellt er für «Meduza» eine Bildstrecke, ein Zeugnis des Schreckens, eigene Fotos macht er praktisch keine mehr. Rückblickend erscheine ihm der Entscheid zur Flucht als der vielleicht beste seines Lebens, sagt er. «Sonst wäre auch ich jetzt im Gefängnis.»
Gab es einen Punkt, an dem die Richtung hätte geändert werden können? Feldman, der im Gespräch zuvor lange Monologe hält, ringt um Worte. «Klar ist, dass wir alle versagt haben, weil wir es nicht schafften, das Regime zu stoppen und den Krieg abzuwenden», sagt er. «Also muss sich jeder überlegen, was er anders hätte machen können.» Feldman stellt sich diese Frage jeden Tag.
Die Journalistin Irina Scherbakowa, die zufällig genauso heisst wie die Memorial-Mitgründerin, ist ähnlich alt wie Fotograf Feldman. Und wie so viele Menschen dieser Generation hat auch sie eine Geschichte von Repression und unerfüllten Träumen zu erzählen. Am Tag, als ich sie in einem Café in Riga treffe, zelebriert der Kreml gerade die illegale Annexion von vier ukrainischen Gebieten. «Wir sollten die russische Propaganda nicht unterschätzen», sagt sie.

Wie funktioniert diese Propaganda genau? Scherbakowa holt weit aus. Es gebe unterschiedliche Techniken der Manipulation: simple Argumente, die sich in jeder Unterhaltung anwenden lassen, «Whataboutism», wenn eine Frage mit einer ausweichenden Gegenfrage beantwortet wird. Zu glauben, die USA hätten Russland provoziert und damit quasi zum Krieg «gezwungen», sei leichter, als sich einzugestehen, dass die eigene Regierung bewusst so viel Leid verursacht. Leugnen als Verteidigungsmechanismus.
Staatsnahe Journalist:innen arbeiteten nicht für bestimmte Ideen, sondern für ein Gefühl der Zugehörigkeit, sagt die junge Frau mit dem selbstgestrickten roten Béret. Die Kremlmedien hätten eine Art Mafiamentalität: «Wir lassen die unseren nicht im Stich.» Eine Mentalität, die deshalb so verführerisch sei, weil man sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen könne. Entsprechend gehe es nicht um Logik oder ehrliche Überzeugungen, sondern darum, das Team mit allen Mitteln zu verteidigen.
Dass viele Russ:innen der Propaganda Glauben schenken, führt Scherbakowa aber auch auf die Klassenverhältnisse zurück: Russland sei ein extrem armes Land, in dem die zahlreichen natürlichen Ressourcen statt der Peripherie bloss immer nur dem reichen Zentrum zugutekämen. «Es ist einfach, Leute zu manipulieren, die seit Jahren in Armut leben und wie Scheisse behandelt werden, die weniger Bildungschancen haben.» In den letzten dreissig Jahren sei Russland ein sozialdarwinistischer Staat gewesen, unter anderen materiellen Umständen hätten viele Leute anders gehandelt, ist sie überzeugt.
Dass Scherbakowa nun im Exil lebt, war eigentlich nicht vorgesehen. Begonnen hat sie ihre Journalismuskarriere als Lifestyleredaktorin. Irgendwann wechselte sie die Themen, schrieb für unabhängige Medien über Kinderhandel und chronische Krankheiten, über sexualisierte Gewalt und Verbrechen in der russischen Armee. «Ich führte ein komfortables Leben – und dann kam der 24. Februar.»

Wie Tausende andere Moskauer:innen geht sie an diesem Tag auf die Strasse, wie viele andere wird sie festgenommen und zu einer Busse verurteilt. Als sie einige Tage später östlich von Moskau Verwandte besucht, verabschiedet das Parlament neue Gesetze, die faktisch die Zensur einführen. Wer den Krieg beim Namen nennt, muss mit Haft rechnen. «Ich begriff rasch, dass meine Arbeit nun illegal war.» Über Istanbul flieht sie nach Jūrmala in der Nähe von Riga, wo sie ein von der Grossmutter vererbtes Haus hat. «Im Vergleich zu vielen anderen bin ich privilegiert.»
Auch Scherbakowa gehört zu einer Generation, die durch die Bolotnaja-Proteste 2012 politisiert wurde. Als damals die Ergebnisse der Parlamentswahl eintrudelten, sass sie in einer Univorlesung. «Ich begann zu rechnen, doch die Zahlen ergaben keinen Sinn, statt auf 100 kam ich auf 146 Prozent», sagt sie schmunzelnd. «Ich war siebzehn und völlig schockiert davon, so betrogen zu werden.» Damals habe sie noch gedacht, dass Proteste etwas bewirkten. Später arbeitete sie als Freiwillige für die Kampagne von Alexei Nawalny, der 2013 als Bürgermeister von Moskau kandidierte, immer wieder ging sie an Demos, einmal schrieb sie «Journalismus ist kein Verbrechen» mit goldenem Dolce-&-Gabbana-Eyeliner auf ein Plakat, weil gerade kein Stift zur Hand war.
Als Russland 2014 die Krim annektierte, verlor sie das Interesse am Studium und ihre Illusionen. In den folgenden Jahren beobachtete die Journalistin, wie die Stimmung unter den Kolleg:innen fatalistischer wurde. «Die Leute erwarteten das Schlimmste. Eine stille Depression machte sich breit, weil niemand mehr die Kraft hatte, über die zunehmenden Repressionen wütend zu sein.» Sie habe das Gefühl gehabt, von niemandem gehört zu werden, während sich die Situation immer weiter verschlechterte. «Heute sind unabhängige Medien in Russland verboten, aber dafür arbeiten sie im Ausland weiter und sind wichtiger als je zuvor.»
Ob sie sich nicht ohnmächtig fühlt? Die Journalistin, die wie ein Wasserfall redet, zwischendurch Puschkin-Gedichte rezitiert und auf Filme und Bücher über den Zweiten Weltkrieg verweist, wird nachdenklich. Sie versuche, wenigstens irgendetwas zu tun, sagt sie. Deshalb arbeitet sie in einem Zentrum für ukrainische Geflüchtete, kocht für ukrainische Soldaten, die in Lettland in der Reha sind, schreibt an einem Ratgeber für ethnische Minderheiten, wie diese der Mobilisierung entgehen können, von der sie überproportional stark betroffen sind.
Auf die Frage, ob sie manchmal bereue, nicht in Moskau zu sein, sagt Scherbakowa: «Ich bin ein Mittelschichtskind und wäre sehr schlecht darin, Molotowcocktails auf Einberufungsbüros zu werfen. Was weiss ich schon darüber, wie man Revolutionen anzettelt? Also setze ich lieber das Wissen ein, das ich aus meiner Arbeit als Journalistin habe.» Bei einer Rückkehr nach Russland würde sie rasch verhaftet werden, glaubt die Reporterin. «Bloss ein politischer Häftling mehr, und wir haben längst nicht mehr genug Ressourcen, um alle zu unterstützen.»
7. Westliche Versäumnisse
So wie Reporterin Anna Politkowskaja Anfang der nuller Jahre am ewigen Wegschauen verzweifelte, geht es heute Arschak Makitschjan. Der 28-Jährige sitzt im «Laidak», einer Bar in Berlin-Neukölln. Er hat seinen Kaffee noch gar nicht angerührt, da redet er sich schon in Rage.

Bevor der Angriff auf die Ukraine Makitschjan zum Antikriegsaktivisten machen sollte, war er das Gesicht der russischen Fridays-for-Future-Bewegung, und weil Medien Labels brauchen, nannte man ihn die «russische Greta». Nun lebt er im Berliner Exil und kämpft von dort aus gegen Putins Krieg. «Ich versuche, die Aufmerksamkeit der Leute auf das zu lenken, was mir wichtig ist: die humanitäre Lage in der Ukraine, aber auch die aktuelle Situation der russischen Zivilgesellschaft, die mit ihren Problemen im Stich gelassen wird.» Deshalb steht er alleine mit Plakaten vor der russischen Botschaft, wie er das auch in Moskau getan hat, wo solche Einzeldemos früher knapp noch toleriert wurden, twittert und verbreitet Fotos auf Instagram. 25 000 Menschen folgen dort seinem Aktivismus.
Geboren ist Makitschjan in Armenien. Als er ein Jahr alt war, flohen seine Eltern mit ihm vor dem Krieg in Bergkarabach nach Moskau. Dort ging er zur Schule und studierte am Konservatorium Geige. «Ich fühle mich russländisch, aber nicht russisch», sagt er. Im Russischen meint Ersteres die Staatsbürgerschaft, Zweiteres bezieht sich auf die Ethnie. Es ist die Realität von Millionen Menschen in einem multiethnischen Land.
Die Zeit des Politaktivismus beginnt für Makitschjan vor bald vier Jahren. Am 24. Februar 2019, da ist er noch in Russland, postet er das Bild einer Demo zum Andenken an den ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow, die jedes Jahr in Moskau stattfindet. Ab dann teilt er seine Anliegen mit der Welt, streikt fürs Klima, erhebt seine Stimme gegen die Repression. «Bekämpft die Klimakrise, nicht die Opposition», steht einmal auf seinem Plakat. «Natürlich hatte ich Angst», sagt er, «aber ich begriff schnell: Wenn ich aus Furcht nichts unternehme, kann ich mich nicht mehr als ehrlichen Menschen bezeichnen.» Wie andernorts auch macht die Pandemie der russischen Klimabewegung einen Strich durch die Rechnung.
Doch Gründe für Widerstand gibt es auch in dieser Zeit genug, Makitschjan geht auf die Strasse, als der Oppositionspolitiker Nawalny vergiftet wird; er protestiert, weil keine unabhängigen Kandidat:innen zur Wahl ins Moskauer Stadtparlament zugelassen werden. Er selbst will sich aufstellen lassen, die liberale Jabloko-Partei sagt ihm Unterstützung zu, bekommt nach Drohungen aber kalte Füsse. «Die Behörden sagten, sie würden mich ausbürgern, wenn ich kandidiere – ich zog mich zurück, und sie haben trotzdem ein solches Verfahren gegen mich aufgegleist.» Ende Oktober entzieht ein Moskauer Gericht Makitschjan, seinem Vater und den beiden Brüdern die russische Staatsbürgerschaft – und macht den Aktivisten damit staatenlos. Ende des Jahres läuft sein Visum für Deutschland aus, was er dann macht, weiss er nicht.
Als der Krieg beginnt, wird dem jungen Aktivisten rasch klar, dass Proteste in einer Diktatur wenig bringen, also kaufen sich er und seine Partnerin, auch sie Aktivistin, Bustickets und fliehen nach Deutschland. Vorher heiraten sie, damit sie sich im Fall einer Inhaftierung gegenseitig besuchen dürfen. Ein ganz normales Leben im Russland von heute.
Auf Fragen nach der aktuellen politischen Gemengelage haut der medial gewandte Aktivist einen druckreifen Satz nach dem anderen raus. Einer davon: «Beim Krieg gegen die Ukraine geht es nicht primär um Territorium, sondern um die Frage, was sich Diktatoren erlauben können.» Entsprechend ratlos ist er darüber, dass das Leben in Europa einfach so weiterläuft, als wäre nichts geschehen – und auch die Kritik an den Russ:innen, die fliehen, statt eine Revolution anzuzetteln, kann er nicht verstehen. «Ich finde diese Haltung irgendwelcher Leute, die nie in einer Diktatur gelebt haben, ziemlich dumm. Dazu haben sie kein Recht!»
Entscheidungsträger:innen im Westen wollten keine Verantwortung übernehmen, sagt er, ihren Bevölkerungen keine unangenehme Wahrheit zumuten. «Wir stecken nur deshalb in einer Energiekrise, diskutieren über die Möglichkeit eines Atomkriegs, weil sie in den ersten Monaten nicht zu radikalen Handlungen bereit waren.» Eine solche wäre aus seiner Sicht ein Boykott russischer Energieträger gewesen. «Doch die halbherzigen Massnahmen, die ergriffen wurden, beschädigen die Demokratie. Hier glauben die Leute fälschlicherweise, dass Europas Stärke seine Industrie und die Technologie seien, und deshalb finanzieren sie Putins Krieg weiter – dabei ist die wichtigste Errungenschaft die Freiheit. Wenn du, wie die Menschen in Russland, keine Freiheit hast, begreifst du ihre Wichtigkeit.»
So wütend er auf den Zynismus auch ist, möchte Makitschjan doch eine Brücke schlagen. «Wir kämpfen dafür, dass die Menschen in der Ukraine und in Russland mit ihrem normalen Leben fortfahren können. Es ist wichtig, über Frieden zu sprechen, aber einen ohne Putin. Denn sein Frieden wird ein kannibalischer sein.» Seine Sicht der Dinge hat er auch schon wiederholt deutschen Politiker:innen zu erklären versucht. Ohne Erfolg, ein Treffen mit der Aussenministerin klappte nicht, andere reagierten gar nicht erst auf seine Anfrage. «Jene, die im Gefängnis sitzen oder im Ausland sind, besitzen als Einzige die Legitimität, die russische Öffentlichkeit zu repräsentieren», findet er. Doch in den westlichen Debatten hätten diese Leute keinen Platz.
Einen ähnlichen Kampf wie Arschak Makitschjan führt auch Katja Rumiantseva: einen gegen das Unwissen. Wo Makitschjan den russischen Widerstand in den Fokus rückt, versucht Rumiantseva, die Situation in Belarus sichtbar zu machen. Wie er verwendet aber auch sie seit Februar viel Energie darauf, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

Die 21-Jährige lebt in Berlin und bloggt unter dem Pseudonym «KaciaBerlin» auf Instagram über das Land, aus dem ihr Vater kommt, aber auch über die anderen Staaten, die früher zur Sowjetunion gehörten, sie organisiert Demos, spricht auf Veranstaltungen. Und sie ist Teil von Razem, der ersten und grössten Vertretung von in Deutschland lebenden Belarus:innen. Der Verein fördert kulturelle Projekte, sammelt Spenden für die Familien politischer Gefangener, hilft dabei, die Flucht aus der Diktatur zu organisieren.
2020 ist Rumiantseva erstmals wahlberechtigt, bei der belarusischen Präsidentschaftswahl im August gibt sie ihre Stimme ab, bekommt hautnah mit, wie das Regime das Ergebnis manipuliert. Anschliessend brechen riesige Proteste aus, Hunderttausende gehen gegen den verhassten Machthaber auf die Strasse, der zu diesem Zeitpunkt schon seit 26 Jahren im Amt ist. Was folgt, ist eine ungekannte Repressionswelle, Kritiker:innen werden verhaftet und gefoltert, manche verschwinden spurlos, andere werden aus dem Land vertrieben. Die Menschenrechtsorganisation Wjasna, deren Gründer Ales Bjaljatzki kürzlich den Friedensnobelpreis erhielt, zählt aktuell weit über 1400 politische Häftlinge.
«Die Ereignisse haben mich politisiert, sich aber auch unveränderlich mit meiner Identität und der eigenen Familiengeschichte verknüpft», sagt Rumiantseva. Seit sie das Geschehen dokumentiert, kann sie, die früher jeden Sommer in Minsk verbrachte, ihre Verwandten nicht mehr besuchen, schon allein mit ihnen zu sprechen, ist zu gefährlich. «Je mehr Zeit vergeht, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich mir meine Identität anlese, dass ich mich immer weiter von dem Land entferne.»
Aufhören ist für Rumiantseva dennoch keine Option. Sie beklagt, wie wenig sich die Menschen in Westeuropa für Belarus interessieren. Nur ein paarmal habe es jeweils ein kurzes Momentum der Aufmerksamkeit gegeben: bei den Protesten gegen das Regime vor zwei Jahren, als Diktator Alexander Lukaschenko ein Ryanair-Flugzeug entführen liess, um eines Regimegegners habhaft zu werden, und erneut, als er Geflüchtete an die Grenze zu Polen lotste.
Jetzt tauche das Land immer wieder in den Schlagzeilen zum Krieg gegen die Ukraine auf, doch die Berichte würden der ambivalenten Rolle nicht gerecht, die Belarus in dem Krieg spiele, seit Lukaschenko zulasse, dass Russland sein Nachbarland als Militärstützpunkt benutze. Unermüdlich versucht Rumiantseva, Informationen über diese Zusammenhänge zu vermitteln, die Instagram-Ästhetik hilft ihr dabei. «Diese Arbeit nimmt mein halbes Leben ein», sagt die Studentin lachend.
Wie kommt ihr Aktivismus bei den Leuten an? «Die belarusische Community ist zu meiner Familie geworden. Das ist grossartig, wir unterstützen uns gegenseitig. Egal in welche Stadt ich komme, überall gibt es eine Connection», sagt Rumiantseva. Doch auch Hass bekomme sie zu spüren – von Rechtsextremen, weil sie ihnen mit ihrem ausländischen Namen nicht passt, von Russ:innen, die ihren Account mit Beleidigungen vollspammen, aber auch von deutschen Linken, die es nicht mögen, wenn die Aktivistin die Sowjetunion kritisiert.
Und dann wären da noch jene, die Kritik an Waffenlieferungen in die Ukraine äussern. Auch diesen Leuten hält Rumiantseva die Erfahrung in Belarus entgegen. «Als wir gewaltfrei protestiert haben, wäre die Zeit gewesen, uns zu unterstützen. Damals wäre es mit Sanktionen ein Leichtes gewesen, Lukaschenko zu isolieren und letztlich aus dem Amt zu heben. Aber damals haben wir keine Unterstützung gespürt.»
Rumiantseva berichtet auch vom Spagat zwischen Linken in den postsowjetischen Ländern und jenen in Westeuropa: «Ein Freund von mir, ein belarusischer Anarchist, erzählte mir von einem Besuch westlicher Linker in Minsk. ‹Ihr müsst einen lokalen Safe Space aufbauen›, haben sie zu ihm gesagt. Und die Belarusen schauen sie an und sagen: ‹Mach so einen auf, und in zwei Minuten stehen die Cops da und prügeln dich ins nächste Gefängnis. So funktioniert das hier nicht.› Das ist eine Vorstellung, die man sich nur leisten kann, wenn man in einer Demokratie lebt.»
Wie geht sie damit um, wenn sich das eigene Leben in einem ständigen Zwischenraum abspielt? Diese Frage stelle sie sich schon eine ganze Weile, sagt Rumiantseva. «2020 ist für mich eine Welt zusammengebrochen, später habe ich erfahren, dass ich eine sekundäre Traumatisierung erfahren habe, weil ich ständig am Handy war und die ganze Gewalt gesehen habe.» Mittlerweile hat sie gelernt, damit umzugehen, sich Freund:innen gesucht, die ihren Schmerz auffangen können, Menschen, denen es ähnlich geht wie ihr, die Verbindungen zu Russland, Belarus oder der Ukraine haben. Auch wenn im Moment Gespräche untereinander zuweilen schwierig sind.
8. Szenen aus dem Widerstand
«Taschen werden durchsucht, der Rucksack durchwühlt,
die progressive Jugend zündet einen Gefangenentransporter an,
denn nichts wird sich von selbst regeln,
wir werden herausfinden, wem die Strasse gehört!»
Zhadan i Sobaky: «Awtosak», 2021
Fragt man Juliana Schemetowez, wieso sie als Belarusin die Ukraine in ihrem Kampf gegen das russische Regime unterstütze, zögert sie keine Sekunde. «Die Solidarität basiert nicht nur auf moralischen Überlegungen, sondern liegt auch in unserem strategischen Interesse: Ein Sieg der Ukraine bedeutet Schwäche für Russland und damit neue Möglichkeiten für Belarus.» Und auf diese neuen Möglichkeiten arbeitet die 28-Jährige schon lange hin.

Schemetowez ist Regimegegnerin, seit sie ein Teenager war. Aufgewachsen ist sie in Minsk, dort hat sie auch Politik studiert. Weil sie auf keinen Fall für den Apparat von Machthaber Lukaschenko arbeiten wollte, zog sie 2016 für ihr Masterstudium nach New York. «Ich wollte wissen, wie es ist, im Westen zu arbeiten, um dieses Wissen später in meinem Land nutzen zu können», sagt Schemetowez an einem Sonntag im September im Dachstock des Zürcher Neumarkt-Theaters. Mit ihrer weissen Bluse, dem strengen Pferdeschwanz und der markanten schwarzen Brille sieht sie eher wie eine Wirtschaftsanwältin aus als wie das Mitglied einer klandestinen Organisation. Doch Schemetowez ist an diesem Tag hier, um von ihrer Tätigkeit als Sprecherin der Hacktivist:innengruppe Belarusian Cyber-Partisans zu erzählen.
In ihrer Zeit in New York ist die Politologin Teil der belarusischen Diaspora, organisiert Veranstaltungen und lobbyiert für die Interessen der Opposition. Vor allem seit 2014 sei meistens die Ukraine im Zentrum internationaler Aufmerksamkeit, was natürlich Sinn ergebe, sagt sie. Lukaschenko hingegen habe kaum jemanden interessiert. «Viele im Westen denken sich: Klar, er ist ein Diktator, aber er arbeitet mit uns zusammen und bringt Stabilität in die Region.» Die Europäer:innen hätten vor allem gewollt, dass keine Geflüchteten kämen und die Geschäfte weiterliefen, spottet sie. «Realpolitik eben.»
Als in Belarus die Proteste beginnen, will Schemetowez sofort hinfahren, wegen der Visabestimmungen muss sie aber in New York bleiben. «Vielleicht war das auch gut so, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich im Gefängnis», sagt sie. Also beobachtet sie den Aufstand – und dessen Niederschlagung – aus der Ferne. «Als das Regime immer brutaler gegen friedliche Demonstranten vorging, verstanden wir, dass wir niemals gewinnen, wenn wir einfach mit Blumen auf die Strasse gehen, dass wir uns verteidigen, aktiv werden müssen.» In dieser Zeit gründet eine kleine Gruppe Gleichgesinnter die «Cyberpartisanen». Der Name ist eine historische Referenz – denn vielen in Belarus ist der Kampf der Partisan:innen im Zweiten Weltkrieg noch präsent, in Literatur und Folklore lebt er fort.
Die ersten Aktionen des Kollektivs sind vergleichsweise harmlos. Sie hacken das Staatsfernsehen und senden dort Bilder von Polizeigewalt. Zuerst sei es mehr darum gegangen zu zeigen, was auf der Strasse vor sich gehe, sagt Schemetowez. Über die Zeit bildete sich das Ziel heraus, Infrastruktur und Institutionen des Staates zu zerstören – um das diktatorische Regime von Lukaschenko zu stürzen und eine Übergangsphase zu starten.
Die Cyberpartisan:innen sind Teil einer Koalition namens Supratiw, was auf Belarusisch so viel wie Widerstand bedeutet. Daneben gibt es die «Selbstverteidigungsbrigaden», die Demonstrierende bei zukünftigen Protesten schützen und ihnen beibringen sollen, wie man sich verteidigt und versteckt. Und die Busly Ljazjaz, die «Fliegenden Störche», die sich auf «physische Operationen» fokussieren, wie Schemetowez es ausdrückt, also etwa die Quartiere der Spezialeinheiten angreifen. Hinzu kommt der politische Arm, der Verhandlungen mit anderen oppositionellen Gruppen führt, sich auf ein Belarus nach Lukaschenko vorbereitet und die Übergangsphase organisiert.
Nach einer spektakulären Aktion der Cyberpartisan:innen im Sommer 2021, als es dem inzwischen fünfzehnköpfigen Kollektiv gelingt, das Innenministerium zu hacken und die Passinformationen sämtlicher belarusischer Bürger:innen zu erbeuten, sucht die Gruppe nach einem Gesicht, einer Person, die der Öffentlichkeit Ziele und Motivation erklärt und mit westlichen Organisationen und Regierungen kommuniziert. Da kommt Juliana Schemetowez ins Spiel.
Die Aufrechten von heute werden auch im Russland der Zukunft die Debatte über den Krieg organisieren müssen.
«Zuerst habe ich abgelehnt, weil ich Angst vor den Konsequenzen hatte, aber dann wurden Freund:innen von mir in Belarus verhaftet», erzählt sie. Doch zu einer Zeit, als die Menschen solche Angst vor den Repressionen hatten, dass sie sich nicht einmal trauten, mit ihren engsten Gefährt:innen über Politik zu reden, seien die Cyberpartisan:innen die einzige Gruppe gewesen, die Hoffnung und Inspiration verbreitet habe – Held:innen. «Ich weiss, das tönt idealistisch. Aber ich habe mir gesagt, dass ich mir niemals vergeben kann, wenn ich nicht alles für einen Regimewechsel mache, wie ich ihn mir seit meinen Teenagerjahren erträumt habe.»


Seit Kriegsbeginn sind rund sechzig Freiwillige unter der Fahne der Cyberpartisan:innen aktiv, Leute aus dem IT-Sektor, «weder links noch rechts», wie Schemetowez sagt. Neben den Attacken stellt das Kollektiv dem belarusischen Widerstand technische Mittel zur Verfügung, etwa die sichere Telegram-Alternative «Partisan-Telegram». Inzwischen wird die Anwendung nicht nur in Belarus selbst, sondern auch in den besetzten Gebieten der Ukraine und neuerdings auch von den Protestierenden im Iran verwendet. Auch mit den ukrainischen Behörden arbeitet die Gruppe punktuell zusammen.
Die aus Sicht der Cyberpartisan:innen wichtigste Aktion fand letzten Winter statt, als sie nach eigenen Angaben den Zugverkehr in Belarus lahmlegten, indem sie die Computersysteme der staatlichen Eisenbahn hackten. «Das Ziel war, russische Truppentransporte zu unterbinden, und das ist uns gelungen», sagt Schemetowez. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht, doch legen offizielle Angaben der Behörden eine Störung der Systeme nahe. Bekannt wurden in dieser Zeit auch Aktionen mutiger Gewerkschafter:innen, die Schienen sabotierten und Züge umleiteten und so russische Truppen von der Versorgung abschnitten. Auch die historische Partisanenbewegung war schon auf den Zugverkehr fokussiert.
Einigen der Gewerkschafter:innen droht für ihre Sabotageaktionen nun wegen «Terrorismus» die Todesstrafe – und auch gegen die Cyberpartisan:innen geht das Regime vor: Es hat die Gruppe – und auch Juliana Schemetowez persönlich – als «terroristisch» eingestuft. Für die junge Frau hat das gravierende Konsequenzen: «Sie haben meine Wohnung verwüstet, und ich kann nicht mehr einreisen, weil mir Verhaftung droht. Zudem habe ich keinen Kontakt zu meiner Mutter, weil sie das gefährden würde, habe Angst, mit Freunden zu sprechen.» Natürlich sei sie nicht so sehr in Gefahr wie all jene, die in Belarus ausharrten und vor Ort weiterkämpften, beeilt sich Schemetowez sofort nachzuschieben. Doch auch sie zahlt für ihren Kampf einen hohen Preis.
Auch wenn es kaum noch Bilder des Widerstands gegen den Krieg gibt, wie Fotograf Ewgenij Feldman beschreibt, geht auch in Russland der Protest weiter. Gewerkschafter Kirill Buketow zählt auch jene dazu, die den Kriegsdienst verweigern – ob aus persönlichen oder politischen Motiven: «Es ist eine Form, wenn nicht des Widerstands, dann zumindest der Sabotage.» Er wünsche sich, dass mehr Leute sich aktiv weigerten, wie Schlachtvieh an die Front geschickt zu werden. «Je mehr es von diesen Leuten gäbe, desto eher müsste das Regime sich mit ihnen beschäftigen, was wiederum Ressourcen binden würde.»
Buketow erwähnt auch die Brandanschläge auf Einberufungsbüros im ganzen Land, Dutzende sind in den letzten Monaten registriert worden – und die Tat eines jungen Mannes, der Ende September auf einen Einberufungsoffizier geschossen hat. Der studierte Historiker ist sich sicher, dass solche Taten viel häufiger vorkommen, als die offiziellen Zahlen suggerieren. «Alle haben gerade ihre eigene Strategie, Widerstand zu leisten, eine kollektive sehe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass eine solche möglich wäre. Es geht ja nicht nur darum, den Krieg zu stoppen, sondern auch um einen Regimewechsel. Solange im Kreml solche Leute sitzen, werden die Kriege einfach reproduziert.»
9. Blick in die Zukunft
Der Raum, der gemeinhin postsowjetisch genannt wird, ist durch seine Geschichte untrennbar verbunden. Doch der russische Angriff auf die Ukraine hat tiefe Gräben hinterlassen, die Gemeinsamkeiten zunichtegemacht, zumindest in der Wahrnehmung vieler Ukrainer:innen. Und zugleich hat der Krieg das Schicksal von Russland, Belarus und der Ukraine auf ein Neues miteinander verknüpft. Die Situation in einem der Länder wirkt sich zwangsweise auf die beiden anderen aus.
Für Bloggerin Katja Rumiantseva steckt Russland «in einer tiefen Krise», habe eigentlich sogar aufgehört zu existieren. Die Frage werde sein, welche Form der Staat annehme – und welche Gefahr in Zukunft von ihm ausgehe. Bei Belarus sei die Sache deutlich klarer. «Das Ende der Diktatur ist längst besiegelt, länger als zehn Jahre wird sie nicht halten», ist sie überzeugt. Ob das Land eine Zukunft habe, werde gerade an der Front in der Ukraine entschieden.
Historikerin Olha Martynyuk sorgt sich derweil um die Zukunft ihres Landes. «Leider ist abzusehen, dass die Ukraine nach dem Krieg ein stärker militarisiertes Land sein wird.» Sie befürchtet deshalb eine Entwicklung hin zum Autoritären, hofft aber auch, dass die Solidarität, die Fähigkeit, das öffentliche Interesse über das eigene zu stellen – Eigenschaften, die sich die Ukrainer:innen in den letzten Monaten angeeignet hätten –, die Entwicklung positiv beeinflussen. «Die grossen Fragen werden sein: Schafft es die Ukraine, ihre demokratischen Errungenschaften zu bewahren? Und wird die russische Gesellschaft in der Lage sein, Verantwortung für den Krieg in der Ukraine zu übernehmen?»
Und woran denkt Theatermacher Pavlo Arie, wenn er in die Zukunft blickt? «Im Wartesaal des Exils bewegt man sich nicht weiter, kann nicht selbst entscheiden, etwas beeinflussen oder ein Leben aufbauen.» Lion Feuchtwangers Roman «Exil» aus den dreissiger Jahren habe ihm geholfen, mit der Situation umzugehen, weil der deutsche Schriftsteller darin vieles auf den Punkt bringe, was Arie nicht in Worte zu fassen vermag. Er helfe ihm dabei, mit seinen Sorgen und Gewissensbissen umzugehen. Wie es für ihn weitergeht, wann er nach Kyjiw zurückkann, weiss Arie nicht, es hängt vom Verlauf des Krieges ab. Vielleicht nächsten Sommer. Der Wartesaal ist kein guter Ort zum Pläneschmieden.
Zehn persönliche Geschichten habe ich bei meiner Reise durch den Zwischenraum gehört, Geschichten vom Scheitern, von einer verlorenen Generation, aber auch vom Widerstand. Geschichten davon, wie der Krieg nicht nur Tausende Leben nimmt und Infrastruktur zerstört, sondern auch Spuren in den Biografien der Überlebenden hinterlässt. Geschichten aber auch, die hoffen lassen, dass die neue Generation in Russland und Belarus doch noch eine Veränderung herbeiführt, wie sie die sowjetische Band Kino einst in ihrem berühmtesten Song einforderte. Diese Geschichten geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus, trotz allem.
Optimistisch stimmt mich auch eine Episode im Gespräch mit der Historikerin Irina Scherbakowa. «Die Voraussetzung für Veränderungen ist Putins Niederlage – sonst hat Russland keine Chance», sagt sie an einer Stelle. Ihre Organisation Memorial ist nicht nur Russlands historisches Gewissen, nicht nur immens wichtig für den Umgang mit der Vergangenheit. Die Aufrechten von heute werden, mit ihren Erfahrungen und Misserfolgen, auch in einem Russland der Zukunft die gesellschaftliche Debatte über den Krieg organisieren müssen – auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist.
Gerade will ich Scherbakowa eine Frage zu dieser Zukunft stellen, da blickt sie auf ihr Handy. Kurz ist zu hören, wie sie tief einatmet. «Wir haben den Friedensnobelpreis gewonnen!»
Die in diesem Text verwendeten Zitate stammen aus folgenden Büchern:
Andreas Kappeler: «Kleine Geschichte der Ukraine». Verlag C. H. Beck. München 2019.
Angelika Nussberger, Martin Aust, Andreas Heinemann-Grüder, Ulrich Schmid: «Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg. Besichtigung einer Epoche». Suhrkamp Verlag. Berlin 2022.
Anna Politkowskaja: «Russisches Tagebuch». Fischer Verlag. Frankfurt 2008.
Karl Schlögel: «Das sowjetische Jahrhundert». Verlag C. H. Beck. München 2017.
Yuliya Yurchenko: «Ukraine and the Empire of Capital. From Marketisation to Armed Conflict». Pluto Press. London 2018.