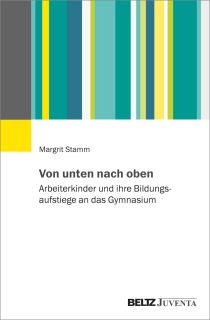Bildung und Klasse: Die falsche Dominanz der «Bildungsnahen»
Intellektuelle Begabung spielt nur eine Nebenrolle: Warum das Wort «bildungsfern» diskriminierend ist und überwunden werden muss, um die Chancengleichheit in der Schule zu fördern.
Auf seinem neusten Album, «The Death of Slim Shady», erzählt Eminem davon, wie er, aufgewachsen in einer bitterarmen, von Kriminalität geprägten Vorstadt von Detroit, mit seinen primitiven Raps noch heute gern die Jugend vergiftet. Auch wenn ihn die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm nicht im Blick gehabt haben dürfte, als sie ihr Buch «Von unten nach oben» schrieb: Der US-Rapper reflektiert in seinem Song mit dem sprechenden Titel «Habits» genau das, was Stamms Buch auszeichnet, eine kritische Befragung des Habitusbegriffs. Im Fokus stehen Arbeiterkinder und ihre ungleichen Chancen auf einen Bildungsaufstieg.
Warum, so fragt Stamm, geben vor allem «bildungsnahe» Menschen in der Schule nach wie vor den Ton an? Warum darf ihr Habitus unhinterfragt als Norm hinhalten? Im pädagogischen Diskurs gehören räumliche Metaphern von Nähe und Distanz zu den üblichen Mitteln der Verständigung. Leute, die gern Zeitung und Bücher lesen, sich für Kunst und Kultur interessieren, ja sogar an einer Hochschule studiert haben, gelten als «bildungsnah». Die alleinerziehende Spitex-Mitarbeiterin mit Migrationsgeschichte oder der Metallbauschlosser vom Land, die sich in der Schule vergeblich abmühten und jetzt ein Leben zwischen Lohnarbeit, Haushalt und Familienbetreuung führen, gelten als «bildungsfern».
Wie kommt es, dass gut Gebildete einen derart überheblichen, selbstgerechten, ja abfälligen Sprachgebrauch an den Tag legen? Der Geist dahinter hat mit dem je eigenen Habitus zu tun. Der Begriff taucht bereits bei Aristoteles als «Hexis» oder Haltung auf, geprägt hat ihn vor allem der französische Soziologe Pierre Bourdieu: als eine verinnerlichte, oft unbewusste Denk- und Verhaltensweise, die Menschen aufgrund ihres sozialen Umfelds entwickeln, in dem sie aufwachsen. So erzählt auch Eminem im Song «Habits» von seiner als Kind erlernten und zur Gewohnheit gewordenen Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, darin zu denken und zu handeln.
Das Problem der blinden Flecken
Margrit Stamm stellt klar, dass Arbeiterkinder unbedingt auf den Radar gehören. Empirische Studien zeigen: Bei der Frage, welche Kinder es ans Gymnasium schaffen, spielt die intellektuelle Begabung nur eine Nebenrolle. Viel wichtiger ist die soziale Herkunft. Haben die Eltern studiert, tun dies achtzig Prozent ihrer Kinder ebenso. Aus Arbeiterfamilien schafft es hingegen nur jedes vierte Kind «nach oben». Wenige Parameter genügen, um dies zu erklären: die elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben, die externe Lernunterstützung, das selbstbewusstere Auftreten höher gebildeter Eltern; dazu gehört auch deren Neigung, bei ungenügenden Leistungen ihrer Schützlinge sogleich Beschwerde einzureichen.
Die Pisa-Studien der OECD verwenden für die Etikettierung der Bildungsnähe oder -ferne vier Kriterien: die Anzahl Meter an Büchern einer Familie, die räumliche Ausstattung (etwa die Grösse der Kinderzimmer), die Ausbildung der Eltern sowie das Bildungskapital der Familie (Besuch von Bibliotheken, Museen oder Konzerten). Margrit Stamm streicht heraus, dass es immer gut situierte Familien geben wird, die kraft ihrer finanziellen Möglichkeiten mehr aus ihrem Nachwuchs «herausholen» können. Erfolg in der Schule wird – ebenso wie ökonomisches Kapital – vor allem vererbt. Nur dass hier niemand Erbschaftssteuern bezahlt.
Der Habitus einer Grundschülerin verweist auf ihre soziale Position: Hat sie einen differenzierten Wortschatz, einen auserlesenen Freundeskreis oder Hobbys, die viel Geld kosten, sind ihr schulische Vorteile gewiss. Nicht etwa, weil die Lehrer:innen parteiisch sind, sondern wegen des «Mittelschichtsbias»: das unterschwellig wirkende Phänomen, dass sich die Erwartungen der Schule am Ideal von «bildungsnahen» Familien der Mittelschicht orientieren. Weil auch die Lehrer:innen mehrheitlich der Mittelschicht entstammen, bleibt die pädagogische Alltagsarbeit nur zu oft in diesem Denken haften. Kinder haben «von Natur aus» kreativ, neugierig und aufgeweckt zu sein, und sie wissen, wie man sich anständig benimmt. Wer dieser Norm (noch) nicht entspricht, ist in der Schule automatisch im Nachteil.
Stamms Ansatz ist ein anderer: Sie hat sich mit den Geschichten von Ausnahmen, die die Regel bestätigen, auseinandergesetzt – Kindern aus einfachen Verhältnissen, die es trotz grosser Hürden ans Gymnasium geschafft haben. Dadurch vermag sie umso plausiblere Wege aufzuzeigen, wie Arbeiterkinder auf ihrem Weg «nach oben» pädagogisch besser unterstützt werden können. Es geht der Autorin nicht darum, dass möglichst alle Kinder das Gymnasium absolvieren, sondern darum, dass einzig die Neigungen und die Fähigkeiten der Kinder über ihre schulische Laufbahn entscheiden sollten – und nicht ihre soziale Herkunft.
Ungerechtigkeiten brechen
Bei gross angelegten Reformen im Bildungssystem bleibe die soziale Frage aussen vor, kritisiert Stamm. Viel zielführender sei es, wenn Pädagog:innen ihre Haltung hinterfragten. Es brauche einen Perspektivenwechsel in den Köpfen. Unter dem Stichwort «Habitussensibilität» plädiert sie dafür, dass die mittelschichtsorientierte Volksschule ihre Haltung ändert, damit sie besser zur Entfaltung der Ich-Identität von Arbeiterkindern beizutragen vermag. Lehrer:innen sollen einen positiven, ressourcenorientierten Blick entwickeln, um die Interessen und die Begabungen auch von benachteiligten Kindern zu entdecken, anzuerkennen und – vor allem – verantwortungsvoll zu fördern.
Um diese Kinder im Unterricht abzuholen und in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken, müssen Lehrer:innen auch inhaltlich an deren Alltagswelt anknüpfen. In welchem Land sind sie aufgewachsen? Was arbeiten ihre Eltern und Grosseltern? Was machen sie in ihrer Freizeit? Welche Werte werden in diesen Familien weitergegeben? Viele Lehrmittel blenden solche Fragen von vornherein aus und orientieren sich an der «bildungsnahen» Schweizer Mittelschicht.
Margrit Stamm ist mit ihrer Kritik an der systemischen Ungerechtigkeit pädagogischen Denkens und Handelns nicht allein. Unlängst hat auch der Zürcher Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach einen Essay veröffentlicht, in dem er eine Pädagogik hinterfragt, die das einzelne Kind ins Zentrum stellt. Das viel gepriesene, aber letztlich neoliberale Ideal der «Individualisierung» in Schule und Unterricht spielt vor allem den Leistungsstarken und Privilegierten in die Hände. Darum räumt Reichenbach mit pädagogischen Mythen auf, die sich wie selbstverständlich in der Schulpraxis festgesetzt haben: der Rolle der Eigenerfahrung etwa, dem Ideal des selbstorganisierten, aber auch digitalen Lernens – oder der Vorstellung, dass sich Lehrer:in und Schüler:in in der Schule «auf gleicher Augenhöhe» begegnen.
Stamm und Reichenbach machen sich für eine pädagogische Leitidee stark, die nicht das digitale Lehrmittel oder das individuelle Gehirn, sondern das Engagement der Lehrperson ins Zentrum rückt: «Ich unterstütze dich, dass du das schaffst.» Lehrer:innen sollen nicht länger glauben, sie müssten einem Arbeiterkind ein «realistisches Bild» der Anforderungen am Gymnasium vermitteln, um es vor dem möglichen Scheitern zu bewahren.